»Peter’s Friends« & Hugh Laurie als Fabulator
(Eintrag No. 459; Film, Woanders, Phantastik & Komödie, Geheimagent) — Heute habe ich mich zum Jubel von Oli über »Peter’s Friends« in seinem Blog dazugesellt. Im Folgenden mein Kommentar von dort, plus einer kleinen Kostprobe des zum Niederknien dollen Räuberpistolen-Romanerstlings von Hugh ›Dr. House‹ Laurie.
Abgesehen vom Spaß den »Peter’s Friends« für’s Publikum bietet, finde ich, dass dieser Film (wie auch einige vergleichbare Werke von Woody Allen) jedem selbst-kreativen Phantasten als beherzigenswerte ›unphantastische‹ Inspiration dienen kann. Hier gibts keine Magie, nichts Wundersames, keine Gadgets, aber eben erfrischend, schockierendes, komisches, absurdes und weises Geschmenschel hochkonzentriert. — Unter anderem die Latte, die dieser Film vorlegt läßt mich (noch) zögern, selber als Fabulatur (professionell) hervorzutreten. Wenn, dann würde ich selbst zu gerne etwas vorlegen können, was Ernst und Alberei wunderbar versöhnt wie »Peter’s Friends«. Allein die Idee, wilde (Genre-)Phantastik zu betreiben, die aber zugleich so berührend einfach nur vom Auf und Ab des ›Person-Sein‹ erzählt, treibt mich seit Jahren um.
Im weitesten Sinne des Wortes ›Phantasie‹ (= sehen machen, erscheinen lassen) finde ich nämlich solche menschlich, allzu menschlichen Dramen überaus ›phantastisch‹, denn in bester Theatermanier werden hier unsichtbare, innere Vorgänge (Ängste, Hoffnungen, Irrungen und Überzeugungen) anschaulich gemacht.
Und nicht zuletzt brilliert Branagh ja auch mit seiner Regie, bzw. bietet der Film atemberaubende (Steady Cam-)Bildarbeit, z.B. bei der großen Ankunftsszene auf der Eingangstreppe zu Peters Haus.
Was Branaghs Ruf und Stellung angeht: an den Vorwürfen, dass dieser umtriebige irische Energiebolzen an einer übergroßen Portion Eitelkeit krankt, ist ja was dran; und auch, dass er nicht immer ein gutes Händchen bei seinen Projekten hatte. Ich für meinen Teil aber verzeihe diese Schwächen gerne einem, der es immer wieder so gut versteht seine Zuschauer mit seiner Begeisterung anzustecken. Wo ich echte Leidenschaft zu spüren meine, bin ich milde mit Kritik.
Und natürlich ist dieser Film für mich Kult, weil Hugh Laurie hier als Mundtrompeter brilliert.
Apropos Laurie: sehr empfehlenswert ist dessen (ich glaub) bisher einziger Roman »Der Waffenhändler« (antiquarisch als Haffmans-Buch zu haben; gut übersetzt von Ulrich Blumenbach! Aber was die Preise angeht, spinnen die Damen/Herren Anbieter da wohl derzeit heftig. Neuauflage als Taschenbuch tut Not, liebe Inhaber der deutschen Rechte.)
 Mit »Der Waffenhändler« (»The Gun Seller«) reicht Laurie seinen Lesern einen betörenden Mix aus James Bond und P.G. Woodehouse, wenn Thomas Lang, Ex-Geheimagent, in eine üble Intriegenkiste verstrickt wird und sich zudem noch in die Tochter des Kerls verliebt, den er killen soll.
Mit »Der Waffenhändler« (»The Gun Seller«) reicht Laurie seinen Lesern einen betörenden Mix aus James Bond und P.G. Woodehouse, wenn Thomas Lang, Ex-Geheimagent, in eine üble Intriegenkiste verstrickt wird und sich zudem noch in die Tochter des Kerls verliebt, den er killen soll.
Da der Roman ja dereit schwerst vergriffen ist, hier als Trost und Probestückerl der Anfang:
Stellen Sie sich vor, Sie müssen jemandem den Arm brechen.
Den rechten oder den linken — spielt keine Rolle. Wichtig ist, Sie müssen ihn brechen, denn wenn nicht … egal, das spielt auch keine Rolle. Sagen wir einfach, wenn nicht, passiert etwas Furchtbares.
Nun frage ich Sie: Brechen Sie den Arm schnell — knacks, hoppla, ‘tschuldigung, kann ich ihnen beim improvisierten Schienen behilflich sein —, oder ziehen Sie die Sache genüßlich in die Länge, erhöhen ab und zu in winzigen Stufen den Druck, bis der Schmerz rosa und grün und heiß und kalt und ganz generell brüllend unerträglich wird?
Jawohl. Genau. Das Richtige, das einzig Richtige ist, daß Sie es möglichst schnell hinter sich bringen. Brechen Sie den Arm, holen Sie den Brandy, seien Sie ein guter Bürger. Eine andere Antwort gibt es nicht.
Außer.
Außer außer außer.
Was ist, wenn Sie die Person am anderen Armende hassen? Und ich meine hassen, richtig hassen.
Diese Überlegung mußte ich jetzt in Betracht ziehen.
Gilbert Keith Chesterton: »Apollos Auge«
Erstellt von molosovsky um 11:42
in
Literatur,
The Sandman,
Klassiker,
Jorge Luis Borges,
Humor,
Carl Amery,
Phantastik,
C. K. Chesterton,
Krimi,
Verschwörung,
Bibliothek von Babel,
Buch-Rezension
DRITTE FOLGE VON MOLOS WANDERUNGEN DURCH
 DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
 Eintrag No. 412 — Es freut mich, in dieser dritten Folge meiner Empfehlungen der von Jorge Luis Borges zusammengestellten »Bibliothek von Babel« nun einen Autoren vorstellen zu können, der sich wie wenige andere ästhetische Denktäter dazu eignet Brücken zu bauen und Denkschranken einzureißen. Aus der Leseecke aus der ich komme, dem Schmuddelkinderwinkel der Comic- und Phantastik-Narren, ist Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) zuvörderst bekannt als einer der großen englischen Witzereisser und Kapriolenkapazunder, der sich mit jungenhafter Unbekümmertheit über so ziemlich alles hinwegsetzt, wenn dabei nur eine geistreiche Pointe rumkommt.
Eintrag No. 412 — Es freut mich, in dieser dritten Folge meiner Empfehlungen der von Jorge Luis Borges zusammengestellten »Bibliothek von Babel« nun einen Autoren vorstellen zu können, der sich wie wenige andere ästhetische Denktäter dazu eignet Brücken zu bauen und Denkschranken einzureißen. Aus der Leseecke aus der ich komme, dem Schmuddelkinderwinkel der Comic- und Phantastik-Narren, ist Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) zuvörderst bekannt als einer der großen englischen Witzereisser und Kapriolenkapazunder, der sich mit jungenhafter Unbekümmertheit über so ziemlich alles hinwegsetzt, wenn dabei nur eine geistreiche Pointe rumkommt.
Hier geht es zu den Folgen eins (über den Borges-Band »25. August 1983«) und zwei (über den Dunsany-Band »Das Land des Yann«). Hier nun meine geschwätzige Abschweifung dazu…
AUF IN'S REICH VON ›PRINZ PARADOX‹
Zum ersten Mal bin ich Chesterton vor etwa 17 Jahren dank Neil Gaimans beeindruckenden, zehnteiligen Comicromans »The Sandman« begegnet. 1990 habe ich mir den zweiten Sammelband »Das Puppenhaus« (The Doll's House) dieser facettenreichen Saga über Morpheus, den Herrscher der Träume zugelegt. Darin wird erzählt, wie Morpheus vier mächtige Einwohner seines Reiches bändigt, die aus den Traumlanden ausgebüchst sind. Einer dieser vier Davongelaufenen ist allerdings kein Wesen, sondern ein Ort, genauer: das aus irischem Seemannsgarn bekannte ›Fiddlers Green‹ (wo fortwährend Fröhlichkeit herrscht, die Fidel nie verstummt und die Tänzer nicht müde werden). Dieses idyllische Traumgefilde hat sich in die irdische Sphäre begeben, um eine eng mit dem Schicksal des Traumreiches verbandelte Familie zu beschützen, und dazu hat Fiddlers Green, sich Gilbert nennend, eben das körperliche Aussehen und Gebahren von Chesterton entliehen. Eine wundervolle Hommage von Comicmeister Gaiman und als jemand, der gern mal solch einem Fingerzeig folgt, hab ich damals so Chesterton für mich entdeckt.
Darin wird erzählt, wie Morpheus vier mächtige Einwohner seines Reiches bändigt, die aus den Traumlanden ausgebüchst sind. Einer dieser vier Davongelaufenen ist allerdings kein Wesen, sondern ein Ort, genauer: das aus irischem Seemannsgarn bekannte ›Fiddlers Green‹ (wo fortwährend Fröhlichkeit herrscht, die Fidel nie verstummt und die Tänzer nicht müde werden). Dieses idyllische Traumgefilde hat sich in die irdische Sphäre begeben, um eine eng mit dem Schicksal des Traumreiches verbandelte Familie zu beschützen, und dazu hat Fiddlers Green, sich Gilbert nennend, eben das körperliche Aussehen und Gebahren von Chesterton entliehen. Eine wundervolle Hommage von Comicmeister Gaiman und als jemand, der gern mal solch einem Fingerzeig folgt, hab ich damals so Chesterton für mich entdeckt.
Als Spontispruch-Opa ist Chesterton zwar nicht so ehrwürdig antik wie Heraklid, aber dafür gibts von ihm auch mehr, als nur ein paar raunende Fragmente. Als kalauernder Phantast kann er dem munteren Ideenanachismus der Marx Brothers das Wasser reichen, wenn auch um den Preis der ein oder anderen treugläubigen Naivität. Und als Gattungsspringinsfeld versteht er es, seine Leser mit einen bunten Strauß verschiedenster Textsorten zu erfreuen, mal mit Kriminalgeschichten, mal mit Essays und Sachbüchern, mal mit Gedichten und Dramen und schließlich, last but not least, eben auch mit hirneschleuderner Phantastik.
Die vielleicht schwindelerregenste Akkrobatenleistung der letztgenannten Spielart von Chestertons freiem Geist, »Der Mann der Donnerstag war«, habe ich 2003 glühend empfohlen, und vor kurzem konnte ich zu meiner großen Freude jene Rezi zu diesem allerzeit hochaktuellen Metaphysik-Spionage-Alptraum um Verehrermeldungen u.a. des von mir hochverehrten Daniel Kehlmann ergänzen. Es ist schon erstaunlich, daß mit Chesterton (wiedermal) ein lohnender und einflußreicher Klassiker englischer Fabulierinbrunst bei uns kaum mehr als eine Fußnote für Außenseiter ist. Dabei gehört zu diesen Chesterton-begeisterten Außenseiten auch der mittlerweile durch den Büchnerpreis nobilitierte Martin Moosebach, der Keith Gilbert trefflich charakterisiert als ›Seehund, der es im Spiel seiner unerschöpflichen Begabung mit niemals ausgehender Lust genoß, sich von einem Felsen ins schäumende Wasser zu werfen.‹[01]
Grad faselte ich schon von Spontis. Da kann ich nachreichen, wie einer der streitbarsten und originellsten anarcho-katholischen Querulanten der deutschen bayerischen Nachkriegszeit, Carl Amery, Meister Chesterton als Ahnherren aller Unangepassten lobt:[02]
Vor einigen Jahren bereiste ich im Auftrag einer Rundfunkstation die britische Alternativszene, die damals der deutschen noch weit voraus war. {…} Wir unterhielten uns über den historischen Platz der grün-alternativen Bewegung, über mögliche Traditionen, über den romantischen Protest als legitime Ausdrucksform der gesellschaftlichen Kritik. Und wir suchten einen möglichen Ahnen. »Chesterton!«, sagten wir fast gleichzeitig. {…} Im Deutschland der Zwanzigerjahre wurde Chesterton hauptsächlich von einem katholischen Publikum gelesen, das in der neuromatischen Tradition des Renoveau Catholique und der deutschen Jugendbewegung stand. Chesterton wurde folgerichtig als eine Art katholisch-römischer Märchenonkel gelesen. Wie schon aus der eingangs erwähnten Renaissance unserer Autors in den Kreisen der Alternativbewegung hervorgeht, ist eine solche Einschätzung nicht mehr zu halten.
»APOLLOS AUGE«
Wie jeder Band der »Bibliothek von Babel«-Anthologie, eröffnet ein Vorwort von Jorge Luis Borges mit der für ihn typischen Mischung aus Konzentriertheit und Spielerei die Auswahl.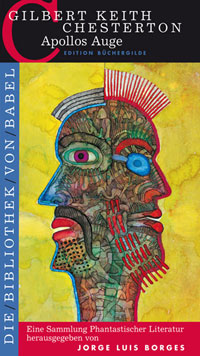 Borges klärt uns darüber auf, daß Chesterton ursprünglich die Malerei zu seiner Profession machen wollte, und liefert folgenden Beispielreigen um Chestertons überaus visuelles Metapherntalent vorzuführen:[03]
Borges klärt uns darüber auf, daß Chesterton ursprünglich die Malerei zu seiner Profession machen wollte, und liefert folgenden Beispielreigen um Chestertons überaus visuelles Metapherntalent vorzuführen:[03]
So vergleicht er die Gewächse eines Gartens mit angeketten Tieren, den Marmor mit erstarrtem Mondlicht, das Gold mit zu Eis gewordener Flamme und die Nacht mit einer Wolke, die größer ist als die Welt, ein Ungeheuer, das aus Augen besteht.
Gemäß dem Gefühl von Borges ist »Die drei Reiter der Apokalypse«[04] die beste Kurzgeschichte Chestertons. Hier belauschen wir die gemütliche Herrenklubrunde von Mr. Pond, der seinen Kumpels zur Kurzweil von einem haarsträubend vetrackten Befehlsgeknäul der preussischen Arme während des ersten Weltkrieges berichtet. Es geht um den polnischen Dichter-Patriot Paul Petrowski, der in preussischer Haft darbt und das Hin- und Her dazu, ob er begnadigt oder erschossen werden soll. Die Rätsel-Nuß geht so (S. 17):
»Die ganze Sache ging schief, weil die Disziplin zu gut war. Grocks {Oberbefehlshaber der Preussen bei der Belagerung von Posen} Soldaten gehrochten ihm zu gut, so daß er einfach nicht machen konnte, was er wollte.«
Als vergnügliches und enorm stimmungsreiches Lehrstück über Befehlsketten-Knieschüsse kommt dieses Soldatendurcheinander daher, komplett mit Schlachtfeld-Schwärmerei für ritterliche Hussaren und Schelte für atheistische Nihilisten. Für hiesige Leser ist hierbei insbesondere reizvoll, wie der Engländer Chesterton mittells der verschiedenen vorgeführten Preussen hier darüber reflektiert, wie kalte Effizienz sich durch Stress & Hektik selbst zu Fall bringen kann.
Die vier restlichen Geschichten hat Borges aus dem Fundus der etwa 52 Pater Brown-Geschichten ausgewählt.[05] Hier wird freilich die Toleranz der Phantastikgenre-Grenzwächter strapaziert, handelt sich sich doch strengstgenommen nicht um Phantastik-Fiktionen, in denen Fabelwesen sich die Klinge in die Hand drücken, oder tatsächlich übernatürliche Magie am Werke ist. Die Kriminalstücke mit dem spitzbübischen katholischen Pfarrer aber feiern die Verwirrung stocksteifer Nüchternheit durch (scheinbar) übernatürliche Rästel. — Hier kann ich nun nicht anders und muß ein klein wenig raunzen: Die Art und Weise wie Chesterton Pater Brown als neunmalklugen Menschendurchschauer inszeniert ist für mich als religionskritischer Bright stellenweise schon enervierend. Religiöse geraten darob sicher weniger ins bittere denn heitere Kirchern[06], aber Nichtgläubigen sei dennoch empfohlen, bei solchen Propaganda-Huppeln ruhig Blut zu bewahren und trotz dieser Eigentümlichkeit den Hütchenspieler-Witz Chestertons mit nachsichtiger Neugier zu verköstigen.[07] Schließlich kann auch ein Bright durch G.K.Cs exemplarisches »Crea quia absurdum«-Gentänzel etwas lernen.
Ein ›Erzengel der Unverschämtheit‹ sorgt für »Die seltsamen Schritte«[08] beim jählichen Festmahl des oligarisch-snobistischen Klubs der ›Zwölf wahren Fischer‹ im exklusiven Edelrestaurant des Hotels Vernon. Zum einen begeistert mich hier Chestertons anklagende Analyse der Dünkel reicher Gesellen, wenn er deren eigentümliche Scham beschreibt (S. 62 und 63):
»{…} jene Mischung aus moderner Gefühlsduselei und dem schrecklichen, modernen Abgrund zwischen den Seelen der Reichen und denen der Armen. {…} Sie {die Reichen} wollten nicht brutal sein, aber sie schreckten davor zurück, gütig sein zu müssen.«
Zum zweiten liefert diese Geschichte ihrem Titel folgend (sozusagen) akkustische Phantastik, wenn der mit analytischer Vorstellungskraft gesegnete Pater Brown Klangereignisse erfolgreich zu deuten versteht.
Mit ihrer berauschenden Sinnlichkeit entzückt »Die Ehre des Israel Gow«[09], wenn Pater Brown und seine Freunde in einem düsteren schottischen Tal weilen, um die Rästel von Tod und Testament des letzten Lord Glengyle zu ergründen. Da raunt einem geballt die Athmo düsterer Wälder, heruntergeommener Burgen, irrsinniger Lords und ihrer Gärtner und heidnischer Traurigkeit an, wenn Brown und seine Helfer bei schlechtem Wetter Gräber ausheben und Burg-Inventar begutachten.
In »Apollos Auge«[10] läßt Chesterton seinen kecken Spott weiblicher Technikbegeisterung und esoterischer Sonnenpriester-Scharlatanerie angedeihen. Spätestens mit dieser dritten Geschichte dürfte den Lesern dämmern, daß G.K.C zwar über die tatsächlichen Wirrnisse menschlicher Herzen, Reden und Taten schreibt, sich dazu aber überzeichneter Karikaturen in Kasperltheatermanier statt plausibler Personen bedient. Ein funkelndes Gemmen-Beispiel für Chestertons verbale Comiczeichnerei bietet diese knappe Beschreibung des übermenschenaffinien Apollokirchen-Priesters Kalon und seines raumfüllenden Charismas (S. 121):
»Seine {Kalons} von der Robe umwallte Figur schien den ganzen Raum mit klassischem Faltenwurf zu tapezieren; seine epischen Gesten schienen ihm größere Ausdehnung zu verleiehen, bis die kleine, schwarze Gestalt des modernen Priesters völlig Fehl am Platze schien, ein runder, schwarzer Fleck auf hellenischer Pracht.«
 Auch in der letzte Geschichte des Bandes, »Das Duell des Dr. Hirsch«[11] dribbelt der allerweil verschmitzte Pater Brown mit seinem vernünftigen Irrationalismus die phantasielose Rationalität seiner atheistischen Begleiter aus, als es gilt, das Geheimnis staatsgefährdener Spionagemacheleukes zu entzaubern. Aber auch hier, diesmal durch einen Verweis auf den empörenden Dreyfus-Skandal des Jahres 1894, versteht es Chesterton trotz allen Firlefanzes dem Leser Erhellendes über realweltliche Probleme angewandter Infowar-Taktik zu vermitteln.
Auch in der letzte Geschichte des Bandes, »Das Duell des Dr. Hirsch«[11] dribbelt der allerweil verschmitzte Pater Brown mit seinem vernünftigen Irrationalismus die phantasielose Rationalität seiner atheistischen Begleiter aus, als es gilt, das Geheimnis staatsgefährdener Spionagemacheleukes zu entzaubern. Aber auch hier, diesmal durch einen Verweis auf den empörenden Dreyfus-Skandal des Jahres 1894, versteht es Chesterton trotz allen Firlefanzes dem Leser Erhellendes über realweltliche Probleme angewandter Infowar-Taktik zu vermitteln.
Statt eines Resummees bitte ich für das Schlußwort ehrfürchtig einen der deutschen Urblogger aufs MoloPodium: Kurt Tuchsolsky[12], der einige Male mit Fanboy-Begeisterung von seinen Chesterton-Lektüreerlebnissen berichtet hat.
Er hat soviel Fett wie Humor. {…} Es wäre hübsch, wenn sich recht viele Deutsche an dieser blitzenden Weisheit eines Krämergeistes jenseits des Kanals erfreuten. Wir habens nötig.
•••
LINK-SERVICE
- ›Cronn‹ für »Roter Dorn«:
Chestertons Stil ist leichtfüßig und dabei dennoch nicht niveaulos. {…}
- Oliver Kotowski für »Fantasyguide«:
Die Kurzgeschichten dieser Sammlung sind zwar weniger phantastisch, denn ungewöhnlich, aber dennoch immer überraschend und humorvoll. Wer Club Stories und Tall Tales mag, wird hier voll auf seine Kosten kommen.
- Thomas Harbach für »SF-Radio«:
Was die Kurzgeschichte (Drei Reiter der Apokalypse) allerdings zu einem Lesevergnügen erster Güte macht, sind die vielen auch in der deutschen Übersetzung gelungenen Wortspiele, die auch die Phantasie des Lesers zu beschäftigen wissen. {…} Die Geschichten überraschen durch eine überraschende Themenvielfalt {…} Sie sind intelligent konstruiert, auch wenn sie manchmal das Verbrechen nur als unbedeutenden Aufhänger für theologische Diskussionen nutzen.
- Als immer schon überzeugter Freund der Phantastik gerade ich fast in Versuchung (obwohl ich jünger bin), Burkhard Müllers Frohlocken für die »Süddeutsche Zeitung« mit sowas wie onkelhaftem Amusement zur Kenntnis zu nehmen, wenn er jauchzt:
Das ist nicht nur von Anfang an fesselnd, das ist auch noch Literatur!
und kann seinem Resummee ganzen Herzens zustimmen, wenn er schreibt:
{»Apollos Auge«} ist ein Buch zum Mitgruseln, Mitträumen, besonders aber zum Mitdenken.
•••
ANMERKUNGEN:
[01] Paraphrase von mir auf Moosebachs Vorwort zu
»Orthodoxie« (1908), Eichborn/Die Andere Bibliothek Band 187 (2000), Seitze 13. •••
Zurück
[02] Nachwort zu
»Der Held von Notting Hill«, Kerle Verlag 1981, Seite 245. •••
Zurück
[05] Im Nachlass von G.K.C. fand man noch eine Handvoll Pater Brown-Stories. •••
Zurück
[06] Entsprechend lobtpreist der evangelistische US-Autor
Philip Yancy in seinem Nachwort für
»Orthodoxie« G.K.C. folgendermaßen:
»Sooft ich spüre, daß mein Glaube wieder einmal zu verdorren droht, wandere ich zum Buchregal und nehme ein Buch von G.K. Chesterton heraus, und das Abenteuer beginnt von vorne.«
(Eichborn/Die Andere Bibliothek 2000), Seite 304. ••• Zurück
[07] Alberto Manuel plaudert in seinem Essay
»Chesterton beim Wort genommen« anregend über das Leben, sowie die Schatten- und Lichtschimmer im Werk von G.K.C in
»Im Spiegelreich« (Into to Looking Glass Wood, 1998), Verlag Volk & Welt 1999, Seite 271ff. •••
Zurück
[12] Aus dem Text
»Feuerwerk« über den Chesterton-Essayband
»Verteidigung des Unsinns, der Demut, des Schundromans und anderer mißachteter Dinge«, in
»Kurt Tucholsky: Gesammelte Werke, Bd 2, 1919-1920«, Rowohlt 1975, S 167f. •••
Zurück
Molos Empfehlungen für Web-Glotzer
Erstellt von molosovsky um 13:52
in
Gesellschaft,
Woanders,
Peter Sloterdijk,
Rüdiger Safranski,
Neil Gaiman,
H. P. Lovecraft,
J. R. R. Tolkien,
Richard Dawkins,
Jonathan Miller,
Colin McGinn,
Steven Weinberg,
Arthur Miller,
Denys Turner,
Danniel C. Dennett,
Bill Plympton,
Humor,
Religion,
Philosophie,
Literatur
(Eintrag No. 410; Gesellschaft, Medien, Phantastik, Bildung & Unterhaltung) — Obwohl ich schon einige Monate mit einer komfortablen Breitbandleitung durchs Web gurke, habe ich erst in diesem Monat angefangen, mich in entsprechenden Portalen umzuschaun, wie es um lohnende Filmchen bestellt ist. Hier eine mehr oder weniger munter-unsortierte Auswahl lohnender Clips und Streams.
Kann sein, daß meine Links nicht lange online, oder die entsprechenden URLs schnell wieder unaktuell sind und wieder verschwinden. Gebt halt ggf. als Kommentar hier bescheid, wenn dem so sein sollte.
Den Anfang macht das einzige Web-TV-Angebot der öffentlich-rechtlichen, das ich regelmäßig verfolge: »Das Philosophische Quartett« mit Peter Sloterdijk und Rüdiger Safranski. Für mich, der ich mir kaum leisten kann abends mal aufn Bier zum Klönen wohinzugehen, sozusagen mein Stamtischersatz. Glaubt bloß nicht, ich nehm alles ernst, was die Damen und Herren des Quartetts so daherphilosophieren. Aber genau das, Daherphilosophieren (und zwar unaufgeregt), ists, was diese Sendung für mich so reizvoll macht. Leider reicht das Archiv nicht allzuweit in die Vergangenheit.
Ein Abend mit Neil Gaiman. Ich habe Gaiman ja im Frühjahr 2007 in Leipzig erlebt und kann sagen: Der Mann weiß, wie man einen vergnüglichen Leseabend gestaltet. Der hier verlinkte Fora.tv-Beitrag dauert fast 2 Stunden. Neil liest aus neustem Kurzgeschichtenband »Fragile Things«, inkl. Frage und Antwortspiel. Nict versäumen sollte man die Story »Secret Brides Of The Faceless Slaves Of The Forbidden House Of The Nameless Night Of The Castle Of Dread Desire«, ein Muss für alle, die eine deftige Parodie auf Gothic Novel-Schwulst abkönnen (zugleich aber auch eine köstliche Verteidigung der Phantastik). — Knackig auch Neil Gaimans Gedanken über Horror- und Weird Fiction Papst H. P. Lovecraft.
Apropos H.P.L.: Hier gibt Howard Philip Lovecraft Auskunft (1933). Fast möcht ich meinen, daß es sich hier um einen geschickten Fake handelt, aber der Clip wurde augenscheinlich von Lovecraft-Experten S.T. Joshi beigesteuert.
J.R.R. Tolkien spricht über die seine Mythologie. Man braucht schlaue Ohren, um das murmelnde Gebabbel vom Papa Hobbit zu verstehen, aber es lohnt sich. Was dieser Clip zeigt: Ian McKellen hat alle zuhandenen Filmaufnehmen des Meisters studiert und gibt als Gandalf eine beeindruckende Hommage auf Tolkien.
Richard Dawkins: Der streitbare Atheist, Autor von »Das egoisische Gen« und dem jetzt vieldiskutierten »The God Delusion« geht in Teil 1 den Wirrnissen des Aberglaubens (Astrologie & Co) nach, in Teil 2 widmet er sich der Scharlatanerie alternativer Heilmethoden (Homöopathie & Co.).
Der Neurologe, Humorist, Theater- und Opernregiesseur Jonathan Miller hat für die BBC versucht eine »Rough History of Atheism« auszubreiten. Kein leichtes Unterfangen, haben doch aus Angst vor gröberer Unbill lange Zeit Atheisten gezögert, sich als solche zu outen. Die Dokumentation hat drei Teile, die jeweils in etwa 10-minütige Clips aufgeteilt wurden. Hier zu den ersten Abschnitten von Sendung eins (»Shadows of Doubt«), zwei (»Noughts and Crosses«) und drei (»The Final Hour«). — Eine der schönsten Gemmen dieser Reihe ist Millers Unwohlsein mit dem Begriff ›Atheist‹. Immerhin: Warum sollte man speziell dem Nichtglauben an GOtt (oder Göttern) einen eigenen Namen geben? Gibt es ein besonderes Wort für Menschen, die nicht an Geister, Kobolde und Einhörner glauben? Eben. — Zusätzlich hat Jonathan Miller mit einer Reiher prominenter Nichtgläuber (und einem Gläubigen) Interviews geführt, die schon in seiner »Rough History« gekürzt verwendet wurden. Unter dem Titel »Atheism Tapes« kann man aber die ganzen Gespräche goutieren. Hier gehts zu den jeweils ersten Clips der Interviews mit Colin McGinn (Wissenschafts-Philosoph), Steven Weinberg (Physiker), Arthur Miller (Dramatiker), Richard Dawkins (Biologe), Denys Turner (Theologe), Danniel C. Dennett (Wissenschafts-Philosoph). — Wer nicht glotzen will, kann die kompletten Transkripte der Gespräche hier lesen.
Nach so viel ernsten Zeug über Glauben und Nichtglauben, hier noch ein Clip mit den englischen Humoristen, Schauspielern und Autoren Stephen Fry und Hugh Laurie, die in England berühmt sind für ihre Sendung »A Bit of Fry & Laurie«. — Unsterblich genial ist dieser Scetch »On Language«. Jupp: so isses.
Und als Schlußzuckerl schließlich noch zu den beiden haarsträubend grotesken kurzen Filmchen des amerikanischen Animationskünstlers Bill Plympton (einigen Freaks hierzulande bekannt als Schöpfer des gandiosen Films »The Tune«): »How to Kiss« und »25 Ways to Quit Smoking«.
Viel Vergnügen.
Laßt uns doch über den Gröfaz lachen
(Eintrag No. 323; Geselschaft, Film, Dröttös Roich, Woanders) — Daniel Levy und Helge Schneider verhohnepiepeln Hitler und freilich wird sich schon im Vorfeld fett darüber echaufiert.
Nix lachen über Hitler! Böser Humor! usw.
Ich finde es sehr traurig, wie arg verklemmt bei uns der spielerisch-ästhetische Umgang mit der Nazivergangenheit ist. Was ist so schwer daran, die Nazis, deren Leithammel und ›die armen von denen verführten Mitläufer und willigen Helfer‹ als depperte Gestörte vorzuführen (oder auch als knackig-unheimliche Monster)? Für mich ergibt sich häufig prickelnde Schönheit (die ja nicht immer eindeutig sein muß um interessant zu sein), wenn man die glorreiche und meiner Meinung heilsame Tradition aufgreift, die durch Chaplin, Lubitsch und Co begründet wurde.
Andrea hat das hiesige Hickhack zum Thema in »die allerhöchstwahrste wahrheit über adolf hitler« bereits fruchtbar kommentiert.
Ergänzend dazu noch ein Fund von mir. In »Sour Krauts, Not a Bit« verteidigt der Enländer Roger Boyes ›uns Deutsche‹ gegen den Vorwurf, daß wir so völlig humorfrei sind. Das ganze ist Teil eines Vorabberichts zum mittlerweile erscheinenen Buch »My Dear Krauts«, in dem der ehemalige Teutonenskeptiker Boyes schildert, wie er in seinen Jahren als Deutschland-Korrespondent der Times seine Vorurteile über z.B. die berüchtigte Humorfreiheit der Deutschen korrigierte. Hier ein Zitat aus dem seinem Artikel in der »Times2« zum Levy/Schneider-Film:
The big test will come in the new year in the form of the first German-made comedy about Hitler. The Führer is shown as an impotent bed-wetter who likes to play in the bath. Judging by the press preview, German audiences will be rolling in the aisles. My bet is that British audiences will not — we have laughed ourselves dry about the Nazis. But I don’t begrudge the Germans their chance to laugh at Hitler — because I trust them not to mock or forget Hitler’s victims. That is why I feel more relaxed with, and about, the Germans. They have been liberated not by Sherman tanks but by Benny Hill and Borat.
Desweiteren finde ich folgende Ansichten aus »Sour Krauts…« bemerkenswert:
What the Germans seem to object to is a sudden switch from slapstick to sarcasm or irony.
In Germany, humour is stockaded, kept apart from everyday life … they will fail to spot the inherent absurdities of their own office life.
The Germans really do laugh, loudly and with only a slight delay, at British humour.
Und ich stimme dieser tragischen Analyse zu:
I have a theory about this banter-less society, but when I tried to advance it in a radio show it was greeted with a glacial silence. It is simply this: the fast barrow-boy wit of the urban proletariat has its roots in Yiddish, arriving in the East End or the Bronx via a generation or two of East European immigration. It came to German cities too — and, for all the familiar reasons, disappeared. So we try not to mention that.
Im Dezember 06 hatte man auch im englischen SpOn über Boyes berichtet. Dort wird der Appell Boyes hervorgehoben, daß in Deutschland eine ›Entwicklungshilfe in Sachen Humor‹ von Nöthen ist. Knackig und erhellend:
…the Germans like to be mocked and criticized. It's the masochistic element in their mentality.
Besides, I don't think there's anything wrong with being fascinated with the Nazi period. It was a uniquely evil period and I don't think there's anything unhealthy about reflecting what the roots of evil are.
Letzteres sehe ich zwar durchaus heikler als Boyes, denn ich glaube durchaus, daß eine ›Faszination für das Böse‹ zur obsessiven Fixierung umkippen, und zu einer ungesunden ›Infektion des Bösen‹ führen kann. — Dennoch: es ist nun mal ein himmelweiter Unterschied, ob man den Nazis und Schickelgruber Apologien angedeihen läßt, oder man sich über diese Bagage und ihren Obermotz lustig macht. — So gar nicht verstehen kann ich die Argumentation, daß man die Opfer verhöhnt, wenn man die Täter verulkt. Ist mir schlicht zu hoch.
Buchmesse 2006 (8): Drei kuriose Knochen im Tal der Drachen, oder: »Bone«, das Fantasy-Comic-Epos von Jeff Smith.
<img src="molochronik.antville.org" align="right"style="margin-left:10px;">Eintrag No. 305 — Das ursprünglich als s/w-Comic erschienene ›funny fantasy epic comic‹ »Bone« von Jeff Smith ist eine der diesjährigen Ausstellungen im Comic-Bereich der Halle 3.0 gewidmet.
Da bin ich rundum enthusiasmiert, denn seit 1998/99 ich bin ein ›Fan‹ von »Bone«. Als jemand, der sonst eher grimmig-düstere Fantasy bevorzugt, war »Bone« für mich wie ein Licht aus einer anderen Welt. Immerhin ist »Bone« ein Garn für alle Altersgruppen von ca. 10 Jahren aufwärts. Solche Unternehmen fallen bei mir Monster- und Krassheiten-Wertschätzer schnell durch die Entsorgungsklappe für allzu sehr das Leserhändchen tätschelnde Butzi-Bussi-Belästigungen. — Nicht so »Bone«. Ich weiß sehr zu schätzen, wie Jeff Smith es geschickt versteht, zärtlich das Herz seiner Leser zu berühren. Ich geb zu, daß bei mir Zeichner (wenn sie eben so gut sind wie eben z.B. Smith) leichter meine entsprechenden Ressentiments überwinden, die ich erstmal gegenüber träumerischer und naiver Romantik nun mal hab (mich schüttelst heut noch ›mit Grausen‹ wegen des »Narnia«-Lichtspiel). Jeff Smith führt mir vor, daß alle Pauschalablehnung bestimmter ›Geschmacksrichtungen‹ (wie ›Kitsch‹, ›Trash‹ ect pp ff) durch Ausnahme-Gemmen in Frage gestellt werden. Für mich sind halt ›Trost‹, ›Sentimentalität‹ und ›Naivität‹ arge Reize bei denen es mir schnell mal zu heftig wird, so wie für jene, die sich am entgegengesetzten Ästhetik-Pol orientieren, ›Ekel‹, ›Angst‹ und ›Explikationshärten‹ eben HARDCORE sind. Wirklich Exzellentes, auf das man sich als ästhetisch allgemein Neugieriger einlassen kann, gibt es überall zu finden.
<img src="molochronik.antville.org" align="right"style="margin-left:10px;">— Rundum baff war ich, als ich vor einigen Wochen mitbekommen habe, daß Tokyopop diesen hinreissenden Comicroman in neuer Übersetzung, sowohl in ursprünglichem Schwarz-Weiß-, als auch im neuen Digital-Kolorierungs-Format raus bringt; zu Preisen, die ich mehr als fair nennen kann (Info zur gebunden & zur Taschenbuch-Ausgabe). Gestern am Stand des Verlages, hab ich den netten Damen und dem Herren von Tokyopop ein Beigeisterungstirilieren und -gefuchtel angedeihen lassen. Wann gabs denn auch zuletzt so schöne farbige, gebundene Sammelbände von Serien, bei denen die deutschen Ausgaben dann um so vieles günstiger waren, als vergleichbare Original-Ausgaben?
Zwar finde ich als über-kritischer Fantasy-Freund auch bei »Bone« ein paar Scharten und Splitter (wie einige eher unoriginell eingesetzte Monomythos-Rezepte und knarzende ›High Fantasy‹-Iconographien {z.B. geheimnisvolle ritterliche Kaputzentypen}, vor allem in den beiden ›bellezistischen‹ Schwert & Klaue-Finalbänden); — aber: dennoch überwiegt bei mir mit Leichtigkeit der Eindruck, daß die 1434 Seiten (und circa 6460 Kästchen) die Aufmerksamkeit und Schmöker-Hingabe wert sind, die das neunbändige Queste- und Schlachten-Epos auf sich zu locken vermag. Ich schreib ›Hingabe‹, weil die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, daß die Geschichte und die schönen Zeichnungen, wenn sie dich erstmal am Haken haben, vollends in ihren Bann ziehen, und du dir z.B. heißen Tee einschenkst, aber als ersten Schluck kalten Tee trinkst.
Das Bemerkenswerteste an »Bone« ist für mich die Art und Weise, wie hier ›J. R. R. Tolkien‹- oder ›Alexander Llyod‹-artige, klassische ›Heldenromanzen‹-Fantasy mit zeitlosem ›kleine lustige Männeken-Slapstick‹-Humor vermengt werden (»Ich liebe es, wenn kleine Wesen sich zanken«, sagte in etwa ja schon Napoleon, allerings nicht in unserer Welt).
Der Comicroman breitet zudem eine vielstimmige und abwechslungsreiche (und doch irgendwie am Ende hübsch übersichtliche) Fantasy-Welt aus, in der es bedrohliche Rattenwesen und fruchteinflößende Riesenpumas gibt (coole Monster halt); in der alte Omas es an Agilität und Kampfeskraft mit den orientalischen Altersgenossen wie Meister Li (z.B. in den »Chinese Ghost Story«-Filmen) aufnehmen kann; in der hinreißend putzige Waldtierchen (vom Käfer über Oppossum-Nachwuchs bis zu Schildkröten) heldenhaft gegen viel größere Böse kämpfen; und in der untote Unglücks-Propheten mit mysteriösen Stimmen in Dunklem babbeln; es gibt Flüchtlingslager- und Indiana Jones-Passagen; und naiv-brilliante Liebeslyrik, und und und …
… und es gibt es die Gebrüder Bone, drei an Walt Kellys sanfte Formensprache erinnernde ›Cartoon‹-Figuren, in einer ansonsten überwiegend eher ›realistisch‹ vorgestellten Welt. Das Durcheinander an Dialog- und Situations-Komik, das der grantige und machtgeile Phoney (sözusagen ohngeföhr Groucho), der faule und subversive Smiley (Chico) und der phantasievolle und mitfühlende Fone (ein Harpo der aber reden kann) bieten, ist schlichtweg köstlichste Humoristik. Eigentlich sind die drei unglücklicherweise in eine große Fantasy-Geschichte gestolpert, und begleiten als Nebenfiguren die eigentlichen Epik-Protagonisten. Und dieses Erzählen aus der Sicht von buchstäblich planlos Dahergelaufenen, verleiht dem sich langsam entfaltenden Großdrama einen Kick, mit dem selbst für mich als Skeptiker gegenüber Schlachten- und Adels-Fantasy die große Abenteuer-Queste stabil trägt und beste Laune bereitet.
Zuckerl (1): Der Meister bloggt selber
Jeff Smith berichtet selber grad hier aus Frankfurt von der Buchmesse. Einfach mal dort sich exemplarisch vorführen lassen, wie man als Autor und Künstler das Bloggen als Werkstatt- und Alltagsmeldungs-Medium/Nexus nutzen kann.
Zuckerl (2): Zahlenfetischismus
Bei Tokyopop harrte man meiner Zählergebnisse! — ›Circa‹, weil ich gestern abend nur einmal die neun Bände durchgezählt hab, als Nach-Buchmessentrubel-Entspannung. — Für Kapitelübersicht-haben-Woller in Kleinschrift noch die Aufdröselung der Zahlen (sorry, daß ich die englischen Titel anführe, aber ich hab nun mal keine deutsche Ausgabe im Haus):
••• Teil eins: VENERAL EQUINOX
• Band 1: »Out Of Boneville«; 142 Seiten, ca. 773 Kästchen.
• Band 2: »The Great Cow Race«; 143 S., ca. 630 Kästchen.
• Band 3: »Eyes Of The Storm«; 180 S., ca. 788 Kästchen.
••• Teil zwei: SOLSTICE
• Band 4: »The Dragonslayer«; 182 S., ca. 899 Kästchen.
• Band 5: »Rock Jaw«; 124 S., ca. 544 Kästchen.
• Band 6: »Old Man's Cave«; 126 S., ca. 565 Kästchen.
••• Teil drei: HARVEST
• Band 7: »Ghost Circles«; 158 S., ca. 673 Kästchen.
• Band 8: »Treasure Hunters«; 140 S., ca. 604 Kästchen.
• Band 9: »Crown Of Horns«; 229 S., ca. 984 Kästchen.
»Her mit dem Schwert, ich muß die Welt retten!«, oder: Diana Wynne Jones und ihr »Tough Guide to Fantasyland«
Eintrag No. 230 — Diana Wynne Jones wird in England seit vielen Jahren als Fantasy-Autorin geschätzt. Mit der diesertage in unseren Kinos laufenden Verfilmung von »Das wandelnde Schloß« durch die japanischen Ghibli-Animationsstudios von Meister Miyazaki wird Diana Wynne Jones nun wohl auch bei uns mehr zu einem geläufigen Geheimtip unter Jugendbuch- und Fantasy-Kennern (wer immer das sein mag). Sie hat selbst noch Vorlesungen von J. R. R. Tolkien und C. S. Lewis besucht, und gibt dennoch (oder gerade deshalb) mit »The Tough Guide to Fantasyland« (etwa: »Der herbe Reiseführer nach Fantasyland«) ein humorgeballtes Kontra auf all die zu liebgewonnenen Versatzstücke des Fantasy-Genres.
Lob und Jubel von mir nachträglich für den Bastei-Verlag, der das Buch 2000 unter dem Titel »Einmal zaubern, Touristenklasse« verlegte.
 Wir erinnern uns: In den Fünfizigerjahren des letzten Jahrhunderts erschienen die drei Bände der »Herr der Ringe«-Trilogie von Tolkien. Erwartet hatte man eine Fortsetzung des erfolgreichen Kinderbuches »Der Kleine Hobbit« und bekommen hatte man eine überbordende Super-Queste nach einem Ausweg, um der sich alles unterwerfenden Macht der Moderne zu entkommen. Nicht viel geschah, bis die Hippies in den Sechzigern den zum Großmärchen aufgeblasenen Kriegs-Epos des Kampfes zwischen Gut und Böse für sich entdeckten. Der Meister von Mittelerde selbst war entsetzt über seine neue Leserschaft, die er als ›langhaarige Irre‹ bezeichnete.
Wir erinnern uns: In den Fünfizigerjahren des letzten Jahrhunderts erschienen die drei Bände der »Herr der Ringe«-Trilogie von Tolkien. Erwartet hatte man eine Fortsetzung des erfolgreichen Kinderbuches »Der Kleine Hobbit« und bekommen hatte man eine überbordende Super-Queste nach einem Ausweg, um der sich alles unterwerfenden Macht der Moderne zu entkommen. Nicht viel geschah, bis die Hippies in den Sechzigern den zum Großmärchen aufgeblasenen Kriegs-Epos des Kampfes zwischen Gut und Böse für sich entdeckten. Der Meister von Mittelerde selbst war entsetzt über seine neue Leserschaft, die er als ›langhaarige Irre‹ bezeichnete.
Wer jemals den Disco-Song »Where there is a whip, there is a will« aus der Zeichentrickfassung des »Herren der Ringe« gehört hat, wird Tolkien verstehen können. Hier in Deutschland ist dieses Lied aus der TV-Fortsetzung von Ralph Bashkis Kino-Fassung kaum bekannt.
Wie man's auch nimmt, hat Tolkiens Mittelerde einen enormen Einfluß auf die populäre Kultur. Dieser exzentrische Linguist hat das Erfinden einer eigenen Welt mit einer Ernsthaftigkeit durchgezogen, die es bis dahin nicht gab. Frühere Phantasie-Welten sind im Vergleich zu Tolkien ehr oberflächlich und unverästelt. Niemals zuvor hat ein Autor in diesem Umfang zuerst Kosmologien, Landkarten, Genealogien, Geschichts-Chroniken, Legenden, Lieder, Verse und verschiedene Sprachen erstellt, um erst dann seine Geschichte in dieser Welt zu erzählen. Vor Tolkien blieb entsprechend veranlagten Lesern nur, die Felder der echten Geschichte, der Religionen, Großideologien und der Esoterik zu besuchen, wenn sie sich einer umfassenden literarischen ›Wirklichkeit‹ zwecks Selbstergänzung hingeben wollten.
Bis heute wird diese mächtige Sinnmachmaschinen-Qualität der ›Fantasy‹ von den Hardcore-Verfechtern der sogenannten ›richtigen und ernsthaften‹ Literatur scheel beäugt. Kein Wunder: Haben doch mit dem Fortschreiten des von Tolkien selbst so verachteten Moloch Moderne — der alles in kleine Konsumier-Portionen für Club-Urlaube abpackt — mehr oder weniger geschickte Pauschal-Reiseveranstalter Routen ins Tolkien'sche Terrain etabliert, auf denen die Touristen immer-tröstliche Helden- und Märchengeschichten genießen können.
<a href=""www.amazon.de"">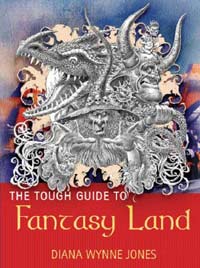 Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.
Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.
So ist keine ›Tour‹ vollständig ohne eine ›Karte‹. Touristen gelangen oft mittels eines ›Portals‹ an ihren ›Ausgangsort‹, zum Beispiel der kleinen Stadt Gna'ash.
Tja, mancher Leser wird bereits von derartig exotischen Ortsnamen wie Gna'ash verwirrt. Von solchen Irritationen rührt viel des schlechten Rufes der Fantasy und Phantastik. Wie gut, daß bereits zu solch grundlegenden Dingen wie ›Apostophen‹ und ›Namen‹ der »Tough Guide« den Fantasy-Unkundigen Verständnishilfe reicht. So gibt es drei Theorien zur Aussprache eines Ortsnamens wie Gna'ash.
1. Man ignoriert den Apostroph und einfach nur das Wort aus. (Dann Gna'ash = Gnash.)
2. Man läßt eine Pause oder Lücke an der Stelle des Apostrophen. (Dann Gna'ash = Gna-ash.)
3. Man macht eine Art Gluckslaut für den Apostrophen. (Dann Gna'ash = Gnaglunkash.) Personen mit unsicher sitzenden Mandeln sollten mit einer der ersten beiden Theorien vorlieb nehmen.
Hat man in Gna'ash das örtliche ›Wirtshaus‹ gefunden, sucht man dort seine Tour-›Gefährten‹ zusammen, ißt seinen ›Eintopf‹, mietet eine ›Kammer‹ für die Nacht und nimmt (wers braucht) an einer ›Kneipenschlägerei‹ teil. Am nächsten Tag kauft man auf dem ›Marktplatz‹ seine ›Kleidung‹ — zu der unbedingt ein ›Kapuzenumhang‹ gehört —, sein ›Schwert‹, ›Pferd‹ und den ganzen anderen Krempel für eine ›Queste‹. Bevor man aufbricht, sollte man noch den ansäßigen ›Magier‹ wegen des Schwertes konsultieren. Immerhin ist der längste Einträg des »Tough Guide« diesen Erz-Gadgets der Fantasy gewidmet.
Nun gehts auf zur großformatigen von ›Mystischen Meistern‹ moderierten Schnitzeljagd durch alle Gebiete die auf der ›Karte‹ zu finden sind. Gewürzt wird diese Schatzsuche nach einem ›Quest-Gegenstand‹ durch schwieriges Terrain und den ›Finsteren Herrscher‹. Hat man nach verschiedenen ›Zwischenfällen‹, ›Konfrontationen‹ und ›Kämpfen‹ das ›Quest-Objekt‹ gefunden, geht man daran, den ›Finsteren Herrscher‹ zu besiegen und/oder packt die ›Weltrettung‹ an. Wie auch immer: im dritten (oder auch fünften) Teil der Trilogie kommt es zum ›Abschluß‹ der Geschichte, siehe ›Geburtsrecht‹, siehe ›Verschollener Thronfolger‹.
Diana Wynne Jones kratzt mit ihren Einträgen zu ›Wirtschaft‹ (Ökonomie, siehe auch ›Stickereiarbeiten‹), ›Umwelt‹ (Ökologie, siehe auch ›Läuse‹) und ›Import/Export‹ an der oberflächlichen Daumenlutscher-Komplexität vieler Fantasy. Die zusammenkonstruierten Handlungen nimmt sie auseinander, indem sie darlegt, daß in ›Fantasyland‹ eben ›Legenden‹, ›Prophezeiungen‹ und ›Träume‹ als Informationsquelle für die ›Helden‹ weitaus zuverläßiger sind als ›Geschichtsschreibung‹. Sprach- und Stilkritik übt sie, wenn sie uns das ›Management‹ der Tour, sowie deren ›Formelle Bezeichnungen der Reiseveranstalter‹ (Official Management Terms) vorstellt. Eine Pest sucht eine Gegegend eben heim und hat Städte im Griff.
Kenner und Liebhaber von Genre-Fantasy können sich über die vielen geistreichen Beobachtungen und trockenen Kommentare abhärten oder aufregen, lachen oder grollen. Allen, die sich selbst in der Kunst der Fantasy-Schriftstellerei und Weltenerfinderei versuchen, empfehle ich den »Tough Guide« zur inniglichen Beherzigung. Jones legt umfangreich die verbreitesten Handgriffe (Fehler) für öd-gewöhnlichste Fantasy-Topffrisuren dar. Der »Tough Guide« ist eine praktische Bürste, mit der man seine eigenen Fantasy-Entwürfe gegen den Strich bürsten kann.
Ein Zuckerl des Buches sind die das Alphabet unterteilenden ›Gnomenworte‹ (nebst einem Barbarenlied). Die gebundene Auflage des Jahres 2004 des englischen Gollancz-Verlages (ISBN 0-575-07592-9) wird neben einer ›Karte‹ von Dave Senior durch acht feine Bleistiftzeichnungen (und Umschlagszier) von Douglas Carrel geschmückt.
Wenn du deine eigene Tocher an Banditen verkaufst, und dafür selbst mit deiner Tocher freigelassen wirst, das ist dann Politik.
Ka'a Orto'o, Gnomenworte, XXXI ii
•••
Dieser Artikel ist zugleich mein erster Beitrag für das Phantastik-Portal FictionFantasy.
 Mit »Der Waffenhändler« (»The Gun Seller«) reicht Laurie seinen Lesern einen betörenden Mix aus James Bond und P.G. Woodehouse, wenn Thomas Lang, Ex-Geheimagent, in eine üble Intriegenkiste verstrickt wird und sich zudem noch in die Tochter des Kerls verliebt, den er killen soll.
Mit »Der Waffenhändler« (»The Gun Seller«) reicht Laurie seinen Lesern einen betörenden Mix aus James Bond und P.G. Woodehouse, wenn Thomas Lang, Ex-Geheimagent, in eine üble Intriegenkiste verstrickt wird und sich zudem noch in die Tochter des Kerls verliebt, den er killen soll.


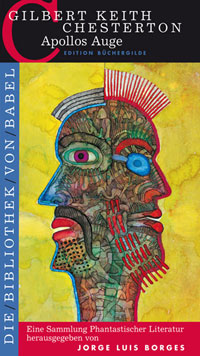


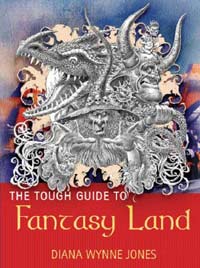 Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.
Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.