Richtig gute SF — Neal Stephenson: »The Diamond Age«
 Eintrag No. 96 — Zu der Frage, was gute SF sei, habe ich im SF-Netzwerk einige Beiträge geschrieben (hier ein Link zu meiner ersten Meldung dort).
Eintrag No. 96 — Zu der Frage, was gute SF sei, habe ich im SF-Netzwerk einige Beiträge geschrieben (hier ein Link zu meiner ersten Meldung dort).
Neal Stephenson bietet für meinen Geschmack mit »The Diamond Age« ein feines Beispiel für gute Science-Fiction an. Auf Englisch habe ich den Roman vor einigen Jahren mal angefangen, bin aber durch einen Umzug unterbrochen worden. Vor Kurzem habe ich die hiesige Taschenbuchausgabe aus dem Ramsch gezogen und nutzte die Gelegenheit, das Buch bilingual fertig zu lesen.
Zur Handlung:
Die Welt nach der nanotechnologischen Wende irgendwann gegen Ende des 21. Jahrhunderts. Die Handlung spielt größtenteils in Shanghai, Nebenschauplätze sind Vancouver, Californien, London. Erste Stärke für mich dabei: keine genaue Festlegung des Datums der Handlung, oder der vorausgegangenen fiktiven zukünftigen historischen Weltereignisse.
Da ist die Handlung um Hackworth, genialer Artifex der Nanotechnik, Angehöriger der Viktorianer (einer der mächtigsten Stämme, Clans, Gruppen, oder wie immer man die nicht-territorialen Patchwort-Staaten nennen mag; andere sind die Küstenrepubliken, das Himmlische Königreich und viele mehr). Für den Dividenden-Lord Finkle-McGraw entwirft und fertigt er das Original der »Fibel für junge Damen«, ein Wunderwerk der Kombination von Buch, Nanotechnik, Pädagoge, Künstlicher Intelligenz. Hackworth fertigt mit Hilfe des mysteriösen Dr. X. eine illegle Kopie der Fibel an, wird auf dem Heimweg überfallen und die Kopie landet bei der kleinen Nell.
Nell ist die Heldin des Buches im Doppelsinn: einmal als Primärprotagonistin, deren Leben »The Diamond Age« über circa 20 Jahre begleitet, und innerhalb der Geschichte als Schülerin der sie erziehenden und beschützenden Fibel. Stephenson schwingt sich zu iconographischen Höhenflügen auf, die man nur noch mit der christlichen oder superheldencomicartigen Bildsphäre vergleichen kann (Nell als Heilige, als erste weibliche große erfolgreiche Revolutionsgestalt der Geschichte als Ende von Kapitel 72). Die vierjährige Nell stammt aus den den unteren Sozialstrata der Zukunftsgesellschaft, lebt bei ihrer alleinerziehenden Mutter, und wird von der Fibel regelrecht errettet.
Das Buch geizt nicht mit Nebenfiguren, die für meinen Geschmack sehr gut und anschaulich (lebendig) geschildert sind. So die Cyber-Schauspielerin Miranda die der Fibel die echte menschliche Stimme verleiht und zu einer niegesehenen Mutter für Nell wird, und ihr Boss Carl Hollywood; oder Richter Fang von den Küstenrepubliken, seine Beziehung zu dem Bösewicht Dr. X., aus dem Himmlischen Königreich und seine Ermittlungen … um nur einige der wichtigen interessanten Figuren zu nennen, deren Handlungen alle irgendwie mit dem Schicksal von Nell und ihrer Fibel zusammenhängen.
Der Schluß, also die letzten 50 Seiten sind ein Wahnsinn. Der große Schlußakkord an Aktion und Ineinander der Motive erfolgt wirklich auf den letzten Zeilen … mir fällt als vergleichbar lediglich das Ende von Helmut Kraussers »Melodien« oder John Irvings »Owen Meany« ein.
Struktur und Summa:
 Das Buch teil sich in zwei Hälften. Die Kapitel sind in der Regel kurz gehalten, so daß es auf den 575 Seiten 74 davon gibt, jedes mit einer notizhaften Inhaltsangabe überschrieben (schöne Referenz an Tradition, siehe alte Bücher). Stephenson schreibt weitestgehend elegant, nur manchmal war mir das clevere Erklärungsgeklimper zu den zugestanden originellen Technikvisionen zu lang … aber ich habs halt nicht so mit Haarkleinbeschreibungen von Technik in Romanen. Aufgefallen ist mir, daß mich in der zweiten Hälfte des Buches kaum noch etwas was den Figuren widerfährt so gefesselt hat, wie in der ersten Hälfte. Spätestens im letzten Drittel übernimmt mehr und mehr die Spannung, wie die vielen einzelnen Fäden des Buches zusammenfinden. Das ähnelt im Guten (Suspense) wie im Schlechten (Sterilität) dem Eindruck, wenn man ein Uhrwerk oder eine Automate beobachtet … anders gesagt: die Programm-Natur, die aller Kunst innewohnt, tritt markant hervor. Das hat mich nur einmal (in der zweiten Hälfte) bei Passagen über die finsternsten Aspekte von Nells Leben gestört. Nell wird von Aufständischen als Spaßsklavin gehalten, sexuell mißbraucht (wie schon in ihrer Kindheit) und mehrfach vergewaltigt - für meinen Geschmack bedient sich Stephenson hier ca. 2 Seiten lang einen zu aseptischen Ton (Kapitel 72, Seite 542). Ist aber heikle Kiste, ich will darüber nicht richten müssen.
Das Buch teil sich in zwei Hälften. Die Kapitel sind in der Regel kurz gehalten, so daß es auf den 575 Seiten 74 davon gibt, jedes mit einer notizhaften Inhaltsangabe überschrieben (schöne Referenz an Tradition, siehe alte Bücher). Stephenson schreibt weitestgehend elegant, nur manchmal war mir das clevere Erklärungsgeklimper zu den zugestanden originellen Technikvisionen zu lang … aber ich habs halt nicht so mit Haarkleinbeschreibungen von Technik in Romanen. Aufgefallen ist mir, daß mich in der zweiten Hälfte des Buches kaum noch etwas was den Figuren widerfährt so gefesselt hat, wie in der ersten Hälfte. Spätestens im letzten Drittel übernimmt mehr und mehr die Spannung, wie die vielen einzelnen Fäden des Buches zusammenfinden. Das ähnelt im Guten (Suspense) wie im Schlechten (Sterilität) dem Eindruck, wenn man ein Uhrwerk oder eine Automate beobachtet … anders gesagt: die Programm-Natur, die aller Kunst innewohnt, tritt markant hervor. Das hat mich nur einmal (in der zweiten Hälfte) bei Passagen über die finsternsten Aspekte von Nells Leben gestört. Nell wird von Aufständischen als Spaßsklavin gehalten, sexuell mißbraucht (wie schon in ihrer Kindheit) und mehrfach vergewaltigt - für meinen Geschmack bedient sich Stephenson hier ca. 2 Seiten lang einen zu aseptischen Ton (Kapitel 72, Seite 542). Ist aber heikle Kiste, ich will darüber nicht richten müssen.
Der große Aufhäger von »Diamond Age«, der radikale weltweite Strukturwandel durch die fruchtbare Anwendung von Nanotechnologie in allen erdenklichen Lebens- und Gesellschaftsbelangen, von Energiegewinnung, über Güter-Produktion und Konsumtion, Kommunikation und Informationsverarbeitung ist gut druchdacht. Mir symphatisch dabei, daß Stephenson trotz der vielen extrapolierten Details uns nix vorjubeln will, wie toll das alles doch ist. In seiner facettenreichen Technik-Utopie versteht er es zum Beispiel, das glitzende Zukunftsglück und die faszinierenden Gadgets seiner Welt mit menschlichen Alltagsmiseren und sozialem Elend zu konstrastieren, und sozusagen nebenbei einige der ewigen Menschenprobleme zu behandeln.
Nach »The Diamond Age« vertraue ich Stephenson soweit, daß ich mir »Quicksilver« besorgt habe und mich dort inzwischen hochvergnügt auf Seite 200 tummle. Stephenson hat für ein weinig Irritation sowohl bei SF-Fans als auch im Feuilliton (damit meine ich die nicht nur auf Deutschland beschränkte etablierte allgemeine Literaturkritik) gesorgt, als er ankündigte einen dreiteiligen dickbuchigen Zyklus über die Epoche des Barock zu schreiben, mit Newton, Peyps, Leibnitz und anderen historischen Persönlchkeiten als Romanfiguren, sowie einem Vorfahren des Helden Waterhouse aus »Cryptonomicon« (auch schon keine richtige SF mehr). Das alles begrüße ich als Weg eines Schriftstellers, der sich von Genre-Grenzen oder anderen Betrachtungsschubladen in seinem erzählerischen Fortgang nicht irritieren läßt und seinem Thema in der jeweils besten Umgebung nachgeht … ein Vermittler zwischen verschiedenen Traditionen der Literatur, hochgebildeter Kenner vieler Wissensgebiete und besorgter Beobachter der Zeitläufte. All diese allgemeinen Qualitäten von Stephenson bietet auch »The Diamond Age«. Kann man mehr von einem Buch verlangen?
SPOILER WARNUNG: Wer den Roman noch nicht gelesen hat, möchte diesen Beitrag bitte vorsichtig lesen, ich verrate viel vom Inhalt, was einem die Freud am Buch verderben könnte.
Auszüge und Anmerkungen:
Meine persönlichen Anmerkungen stehen in {geschwungenen} Klammern.
 Wohl eine der deutlichsten Reflektion über Form und Stil im Buch findet sich auf
Wohl eine der deutlichsten Reflektion über Form und Stil im Buch findet sich auf
Seite 87: Hackworth hatte sich die Mühe gemacht, einige chinesische Schriftzeichen zu lernen und sich mit den Grundprinzipien der fremden Denkweise vertraut zu machen, aber im großen und ganzen hatte er seine Transzendenz lieber unverhohlen und bloßliegend, so daß er sie im Auge behalten konnte — beispielsweise in einem hübschen Schaukasten aus Glas —, und nicht in den Stoff des Lebens eingewoben wie Goldfäden in Brokat.
Über Öffentlichkeit, Politik und Moral:
Seite 223: »Wissen Sie, als ich ein junger Mann war, galt Scheinheiligkeit als schlimmstes aller Laster«, sagte Finkle-McGraw. »Das lag einzig und allein am moralischen Relativismus. Sehen Sie, in jenem Klima stand es einem nicht zu, andere zu kritisieren - immerhin, wenn es kein absolutes Richtig oder Falsch gibt, welche Basis gäbe es dann für Kritik?« {…}
Seite 224: »Nun, das führte zu einer Menge allgemeiner Frusttration, denn die Menschen sond von Natur aus tadelsüchtig und lieben nichts mehr, als die Unzulänglichkeiten anderer zu kritisieren. Aus diesem Grund stürzten sie sich auf die Scheinheiligkeit und erhoben sie von einer läßlichen Sunde in den Rang der Königin aller Laster. Denn, sehen Sie, selbst es kein Richtig oder Falsch gibt, kann man Gründe finden, einen anderen Menschen zu kritisieren, indem man vergleicht, was er sagt und wie er tatsächlich handelt. In diesem Falle maßt man sich kein Urteil darüber an, ob seine Ansichten oder die Moral seines Verhaltens richtig oder falsch sind — man weißt lediglich darauf hin, daß er etwas predigt, aber etwas anderes tut. In meiner Jugendzeit lief pralktisch der gesamte politische Diskurs darauf hinaus, die Scheinheiligkeit auszurotten.« {…}
Seite 225: »Weil sie scheinheilig waren … wurden die Viktorianer Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts verachtet. Selbstverständlich hatten sich viele Leute, die diesen Standpunkt teilten, selbst des schändlichsten Verhaltens schuldig gemacht, und doch sahen sie kein Paradoxon in ihren Ansichten, da sie selbst nicht scheinheilig waren — sie erhoben keine moralischen Maßstäbe und lebten nach keinen.« / »Demnach waren sie den Viktorianern moralisch überlegen … obwohl — besser gesagt, weil — sie gar keine Moral hatten.«
Tja, welche Lehre läßt sich ziehen aus der Erkenntnis (oder Ansicht), daß Kritik nicht möglich ist, wenn allgemeine Abmachung darüber fehlen, was richtig oder falsch ist, gut oder schlecht? Für meinen Teil will ich mich nicht auf meinen Geschmack als Refugium meiner persönlichen Freiheit zurückziehen, um ansonsten anzunehmen, daß sowas wie die natürliche Fress- und Hackordnung die feine oder bescheidene Position einer ästhetischen Haltung bestimmt.
Schöne Spekulation über den Grund der Sehnsucht nach einer Rückkehr der guten Sitten:
Seite 226: In einer Ära, wo man alles überwachen kann, bleibt uns nichts anderes als die Höflichkeit.
Richter Fang zitiert in Gedanken Konfuzius und läßt damit das große Thema von »The Diamond Age« erklingen. Gar nicht so weit weg von dem, was ich unter Aufklärung verstehe:
Seite 287: Die Alten, welche überall im Königreich erhabene Tugend demonstrieren wollten, brachten zuerst ihr eigenes Dasein in Ordnung. Im Wunsch, ihr eigenes Dasein in Ordnung zu bringen, reglementierten sie zuerst ihre Familien. In dem Wunsch, ihre Familien zu reglementieren, kultivierten sie als erstes ihre Persönlichkeit. In dem Wunsch, ihre Persönlichkeit zu kultivieren, korrgierten sie zuerst ihr Herz. In dem Wunsch, ihr Herz zu korrigieren, trachteten sie als erstes danach, aufrichtigen Denkens zu sein. In dem Wunsch, aufrichtigen Denkens zu sein, erwarben sie als erstes höchstes Wissen. Dieser Erwerb höchsten Wissens lag in der Untersuchung von Dingen … Vom Sohn des Himmels bis hinab zur Masse des Wolkes müssen alle die Kultivierung ihrer Persönlichkeit als Wurzel für alles andere betrachten.
Über die Auflösung der Nationalstaaten. Wir leben meiner Ansicht nach ja derzeit in der Phase, wo sie sich noch heftig in Todeskrämpfen winden.
Seite 317: Carl Hoillywood: »Das Mediennetz wurde von Grund auf konstruiert, um Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten, damit die Leute es auch für Geldtransfers benutzen konnten. Das ist ein Grund, weswegen die Nationalstaaten zerfallen sind — sobald das Mediennetz errichtet war, konnten die Regierungen finanzielle Transaktionen nicht mehr überwachen, und das Steuersystem wurde hinfällig.«
Das Mediennetz in dem Buch ist eine Weiterentwicklung des Internets von heute. So unterscheidet man zwischen klassischen (oder altmodischen) Passiven, womit Filme wie wir sie kennen gemeint sind, und Raktiven, vergleichbar den Star Trek-Holodecks, also Live-Rollenspiel in einem komponierten Narrationsgitter. Siehe auch: die Macher von »Deus Ex« sprechen bei den Levels ihres PC-Spiels von Möglichkeitsräumen.
Beste »Dracula«-Empfindsamkeit und Zurückhaltung. »Dracula« von Bram Stoker kann man getrost als einen Schlüsselroman der Viktorianischen Epoche bezeichnen, und es überrascht mich also nicht, hier Spuren seines emotionellen Taktes wiederzufinden.
Seite 336: Gwendoline Hackworth: »Mein Mann schreibt mir jede Woche Briefe, aber sie sind überaus allgemein gehalten, unverbindlich und oberflächlich. In den letzten Monaten tauchen immer mehr befremdliche Bilder und Emotionen in diesen Briefen auf. Sind sind - bizarr. Ich fürchte um die geistige Stabilität meines Mannes und um die Aussichten eines jeden Unterfangens, das von seinem Urteilsvermögen abhängen könnte.«
Über Sinnvermittlung.
Seite 351: Mr. Beck: »Lästige Unterscheidungen interessieren mich nicht. Ich interessiere mich nur für eines … und das ist der Einsatz von Technologie, um Sinn zu vermitteln.« Zumindest vom anglo-amerikanischen Narrationstzerrain weiß ich (oder habe den Eindruck), daß dort das Motiv vom aus dem Unter- oder Hintergrund agierenden Aufkläreren verbreiteter ist, als in Deutschland … hierzulande ehr anrüchiig und bisweilen ein Tabu, kann aber auch sein, daß ich diesbezüglich leicht paranoid bin.
Weitere Passage zu der Spannung zwischen Ethik und Technik.
Seite 384: Der Vatikan hatte eine große Zahl ernster ethischer Vorbehalte gegen die Nanotechnologie, aber schoießlich hatte man sich darauf geeinigt, daß sie okey war, wenn nicht mit der DNS herumgespielt oder direkte Schnittstellen mit dem menschlichen Gehirn geschaffen wurden.
Die beschriebene Ansicht empfinde ich als sehr richtig. Ich kann die vorauseilende Bereitschaft von Zeitgenossen zum Einbau von Hirnbuchsen (oder sonstiger Schnittstellen zwischen Hirn und Technik) nicht nachvollziehen.
Weiteres zu Moral, inzwischen von Hauptfigur Nell selbst.
Seite 410: »Ich glaube, ich bin endlich dahintergekommen, was Sie mir vor Jahren sagen wollten, über die Notwendigkeit, intelligent zu sein. {…} Die Vickys {= Neo-Viktorianer} haben einen komplizierten Moral- und Verhaltenskodex. Er entstand aufgrund der moralischen Verkommenheit einer früheren Generation, genau wie den ursprünglichen Viktorianiern die Gregorianer und die Regentschaft vorausgegangen sind. Die alte Garde glaubt an diesen Kodex, weil sie durch Schaden klug geworden sind. Sie erziehen ihre Kinder dazu, den Kodex zu respektieren - aber ihre Kinder glauben aus gänzlich anderen Grunden daran. {…} Einige stellen ihn niemals in Frage - sie wachsen zu kleingeistigen Menschen heran, die sagen können, was sie glauben, aber nicht, warum. Andere, desillusioniert die Scheinheiligkeit der Gesellschaft, und sie rebellieren.« / »Für welchen Weg entscheidest du dich, Nell?«, fragte der Constable … »Konformismus oder Rebellion?« / »Weder noch. Beide sind ein wenig schlicht - sie sind nur für Menschen, die nicht mit Widersprüchen und Zweideutigkeit fertig werden.«
Ein Buch des von mir wertgeschätzten Umberto Eco aus den Jahren 1964/1978 heißt »Apokalyptiker und Intergierte - Zur kritischen Kritik der Massenkultur«, in dem es bisweilen um die gleichen Dinge geht, wie bei Stephenson … nur nicht mit soviel Spezial FX natürlich.
Die Neo-Viktorianer wollen mehr Künstler in ihrer Gesellschaft.
Seite 421: Dividenden-Lord Finkle-McGraw fragt Carl Hollywood: »Glauben Sie, wir ermutigen unsere eigenen Kinder nicht genug, sich den Künsten zuzuwenden, oder sind wir für Männer ihres Schlages nicht anziehend genug, oder beides?« / »Bei allem gebührenden respekt, Euer Gnaden, bin ich mit Ihrer Prämisse nicht unbedingt einverstanden. New Atlantis kann auf zahlreiche bedeutende Künstler zurückgreifen.« / »Ach kommen Sie. Warum kommen sie denn alle von außerhalb des Stamms wie Sie selbst? Im Ernst, Mr. Hollywood, hätten Sie den Eid überhaupt abgelegt, wenn es aufgrund Ihrer Tätigkeit als Theaterpriduzent nicht von Vorteil für Sie gewesen wäre? {…} Es kommt Ihnen gut zupaß, weil Sie inzwischen ein gewissen Alter erreicht haben. Sie sind ein erfolgreicher und etablierter Künstler. Das unstete Leben eines Bohemiens kann Ihnen nichts mehr bieten. Aber hätten Sie Ihre derzeitige Position erreicht, wenn Sie dieses Leben nicht früher geführt hätten?« / »Jetzt, wo Sie es so ausdrücken … stimme ich zu, daß wir versuchen könnten, in Zukunft gewisse Vorkehrungen zu treffen, für junge Bohemiens — « / »Das würde nicht funktionieren … darüber denke ich schon seit Jahren nach. Ich hatte denselben Einfall: eine Art Freizeitpark für junge künstlerische Bohemiens einzurichten, in allen Städten verstreut, damit junge Atlanter mit entsprechenden Neigungen sich versammeln und subversiv sein können, falls ihnen danach zu mute ist. Aber die Vorstellung allein ist ein Widerspruch in sich, Mr. Hollywod, ich habe im vergangenen Jahrzehnt oder so viel Mühe darauf verwandt, das Subversive systematisch zu ermutigen.«
Denn:
Seite 421: »… darin liegt die Daseinsberechtigung eines Dividenden-Lords - die Interessen der gesamten Gesellschaft im Blick zu haben, anstatt die eigene Firma zu melken oder was immer.«
Angesichts der Politiker-, Manager- und Beraterskandale hierzulande (aber auch anderswo) spricht mich zumindest diese Passage sehr an. Leben wir wirklich noch in einer primitiven Zeit, in der jeder (und vor allem die Mächtigen, alle mit ›Gelegenheit‹) nur den eigenen Beutel füllt, oder verstehe ich kleiner Fuzzi die Handlungen der Mächtigen und Reichen nicht, die sich durchaus im Sinne der Weltgemeinschaft Sorgen und entsprechend agieren?
Teil einer »So ist der Lauf der Welt«-Rede von Madame Ping zu Nell.
Seite 429: »Im Grunde genommen gibt es nur zwei Industriezweige. Das ist immer so gewesen. {…} Die Industrie der Sachen und die Industrie der Unterhaltung. Die Industrie der Sachen kommt zuerst. Sie hält uns am Leben. Aber heutzutage, wo wir den Feeder haben, ist es nicht mehr schwer, Sachen zu machen. Es ist keine besonders interessante Branche mehr. / Wenn die Menschen alles haben, was sie zum Leben brauchen, ist der Rest nur noch Unterhaltung. Alles.«
Interessant wie sich diese Passage mit der Aussage von Mr. Beck im Auszug von Seite 351 reibt, denn Mr. Beck geht es primär um die Vermittlung von Sinn. Sinn taucht bei Madame Ping aber nicht auf, außer weitläufig im Bereich der Sachen, so wie Lebensmittel sinnvoll sind, wenn man hungerig ist.
Nell denkt über ihre Arbeit (Design von Raktiven) nach.
Seite 464: Seit frühester Kindheit erfand sie Geschichten und erzählte sie der Fibel, und nicht selten wurden sie verarbeitet und in die Geschichten der Fibel eingegliedert. Für Nell war es ganz natürlich, dieselbe Arbeit für madame Ping zu tun. Aber nun hatte ihre Chefin von einer Darbietung gesprochen, und Nell mußte gestehen, daß es in gewissem Sinne eine war. Ihre Geschichten wurden verarbeitet, zwar nicht von der Fibel, sondern von einem anderen Menschen, und so wurden so Bestandteil des Denkens dieser anderen Person. / Das schien durchaus einfach zu sein, aber die Vorstellung beunruhigte sie aus einem Grund, der ihr erst bewußt wurde, als sie mehrere Stunden im Halbschlag darüber nachgedacht hatte.
Wohl jeder angehende oder etablierte Autor (oder allgemein Künstler/Unterhalter) hat sich darüber schon mal den Kopf zerbrochen … oder sollte es zumindest. Will ich nur unterhalten, will ich Sinn vermitteln, Trost spenden (siehe Tolkien), Sozialkritik üben? usw.
ZUGABE: Schmankerl:
Ha, ein deutsches Wort im Original (ROK-Taschebuchausgabe).
Seite 337: »It didn't matter which brain a {Nano}´site was in. The all talked to one another indiscriminately, forming a network. Get some Drummers together in a dark room, and they become a gestalt society.«
Übersetzt (wieder ausm Goldmann-Tachenbuch).
Seite 389: »Es spielte keine Rolle, in welchem Gehirn sich die ´siten befanden. Sie redeten alle gleichwertig miteinander und bildeten eine Art Netz. Pferchen Sie ein paar Tromler in einem dunklem Raum zusammen, und sie werden zu einer Gestaltgesellschaft.«
Habe laut gelacht bei folgendem Satz.
Seite 375: Er sollte besser von hier verschwinden, bevor er wieder Sex mit jemanden hatte, den er nicht kannte.
Wirklich lustiger Schnitzer — naja — mangelndes Fingerspitzengefühl von Joachim Körber. Mannbarkeit wird von ihm ernsthaft auf eine Vertreterin des weiblichen Geschlechtes angewendet.
Seite 380: Die Mannbarkeit hatte ihr jede Menge Merkmale verliehen, die die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts und von Frauen mit entsprechenden Neigungen auf sich zogen.
Zum Vergleich die gleiche Stelle im Original:
Seite 329: Maturity had given her any number of features that would draw the attention of the opposite sex, and of women so inclined.
Geiler historischer Fachbegriff des 21. Jahrhunderts bezüglich der Massenvernichtungswaffen des 20. Jahrhunderts:
Seite 443: Elizabethanische Atombomben.
Bumm und Ende.
Gilbert Keith Chesterton: »Der Mann der Donnerstag war«, oder: Bombe und Kursbuch
Eintrag No. 20
Version 1.0 erschienen in
»MAGIRA 2003 – Jahrbuch zur Fantasy« , herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert.
Version 2.0 vom 20. September 2007: Portrait und viele Links eingepflegt, um Verehrerrundschau erweitert Fehler gemerzt.
 Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) zählt neben Herbert George Wells, Arthur Conan Doyle und Rudyard Kipling zu den klassischen Alleskönnerautoren Englands am Ende der Viktorianischen Epoche bis zum Ende des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts. Wie diese hat er Texte verschiedenster Art hinterlassen, darunter äußerst originelle Beiträge zur Phantastik. Und wie Tolkien gehört er zu den ›schrulligen Katholiken‹ der anglikanischen Insel (siehe die beiden Essay-Bände »Ketzer« und »Orthodoxie«). In Deutschland ist er wohl, wenn überhaupt, vor allem als Erfinder des von Heinz Rühmann (bzw. Ottfried Fischer) dargestellten Pater Brown bekannt. Comiclesern ist vielleicht sein Aussehen bekannt, immerhin leiht sich das die Figur (bzw. der Ort) Fiddlers Green in Neil Gaimans »The Sandman«.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) zählt neben Herbert George Wells, Arthur Conan Doyle und Rudyard Kipling zu den klassischen Alleskönnerautoren Englands am Ende der Viktorianischen Epoche bis zum Ende des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts. Wie diese hat er Texte verschiedenster Art hinterlassen, darunter äußerst originelle Beiträge zur Phantastik. Und wie Tolkien gehört er zu den ›schrulligen Katholiken‹ der anglikanischen Insel (siehe die beiden Essay-Bände »Ketzer« und »Orthodoxie«). In Deutschland ist er wohl, wenn überhaupt, vor allem als Erfinder des von Heinz Rühmann (bzw. Ottfried Fischer) dargestellten Pater Brown bekannt. Comiclesern ist vielleicht sein Aussehen bekannt, immerhin leiht sich das die Figur (bzw. der Ort) Fiddlers Green in Neil Gaimans »The Sandman«.
Der Wagenbach-Verlag hat dankenswerterweise »Der Mann der Donnerstag war« wieder mal dem deutschem Leser zugänglich gemacht, wenn auch in einer gewöhnungsbedürftigen Übersetzung aus dem Jahre 1910.
Das 1908 erstmals erschienene Buch handelt vom apltraumdurchwirkten Ringen um eine gesicherte Sicht auf die Auseinandersetzung zwischen Anarchie und Ordnung. Es beginnt mit der Begegnung zweier gegensätzlicher Poeten in einem Künstlerviertel Londons. Der Platzhirsch des Saffron Park, Lucien Gregor, verherrlicht den Archetypen des bombenwerfenden Anarchisten als DEN Künstler schlechthin. Seinem Herausforderer Gabriel Syme dünkt das Chaos aber öde und er preist lieber den Zugfahrplan als Triumph des menschlichen Willens. Gregor möchte nicht nur Konventionen und Regierungen, sondern sogar Gott abschaffen, Syme aber wirft ihm vor, es mit dem Anarchismus nicht wirklich ernst zu meinen. Gregor will Syme von seiner Ernsthaftigkeit überzeugen und Syme folgt Greogor zu einem geheimen Treffen. Beide offenbaren zuvor einander ihre Geheimnisse und geloben Verschwiegenheit darüber. Gregor entpuppt sich als Anarchist, Syme als Geheimpolizist, beide nur als Poeten getarnt. Beklommen stellen die sie fest, daß ihre Angst aufzufliegen und ihre Ehrenworte sie voneinander abhängig machen.
Bei einem Treffen des geheimen Anarchistenzirkels schafft es Syme, Gregor den Posten des Donnerstag wegzuschnappen. Die sieben Oberanarchisten sind nämlich nach den Wochentagen benannt, womit sich der seltsame Titel des Romans erklärt. Montag ist ein Sekretär, Dienstag ein polnischer Fanatiker, Mittwoch ein dubioser Marquis, Donnerstag in Person Symes ein Poet, Freitag ein alter Professor und Samstag ein praktischer Arzt. Anführer ist der monströse Präsident Sonntag, der sich selbst ›den Frieden Gottes‹ nennt. Der Rat beschließt ein Bombenattentat auf den russischen Zaren und den französischen König in Paris, das Syme und Greogor verhindern wollen. Von da an geht es zunehmend drunter und drüber.
Chesterton hatte merklich großen Spaß daran, Atmosphären zu übertreiben und moderne Allegorien zu erschaffen. Nichts ist, was es scheint, und die Verschwörer stolpern von einer Bredouille in die nächste.
Besonders bemerkenswert ist der Oberbösewicht Sonntag, eine grandiose Übersteigerung der Figur des Verbrecherkönigs. Er ist eine prophetische Mischung aus Goldfinger und Groucho Marx, wenn er z.B. bei der finalen dadaistischen Verfolgungsjagd nicht nur immer aberwitzigere Fluchtuntersätze nutzt, sondern dabei auch noch ständig Zettel mit rätselhaften Unsinnsmitteilungen hinterläßt. Durch solche Kapriolen wirkt der Roman über weite Strecken, wie eine Vorwegnahme von höherem Zeichntrickblödsinn. Dabei wird immer wieder auf das Grundproblem angespielt: die unvereinbare Gegensätzlichkeit der menschlichen Wünsche nach Ordnung, Kontrolle und Sicherheit einerseits, nach Freiheit, Individualität und Vertrauen andererseits.
Chestertons satirische Gesellschaftsphantastik ist allemal ein Wiederentdecktwerden wert, besonders anempfohlen in unseren Zeiten, da man als Echtweltbürger feststellt, daß die Grenzen zwischen Ordnung und Chaos sich immer mehr verwischen, und der Übersichtlichkeit halber amal neu definiert werden müßten. Egal ob man sich (aus welchen Grund auch immer) für Bombe oder Kursbuch entscheidet, die Gegenseite lauert immer und überall.
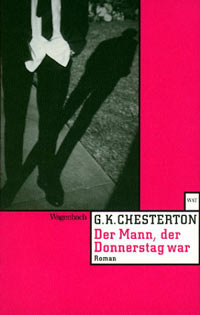 Meine liebste Fundstelle des Romans illustriert das dialektisch-paradoxe Ideenjoungliervergnügen, das ich mich Chesterton hab. Im ersten Kapitel werden zwei gegensätzliche Dichter — der dandyhafte Anarchist Lucien Gregor und der bürgerliche Ordnungs-Anakreont Gabriel Syme — im Streitgespräch gegenübergestellt.
Meine liebste Fundstelle des Romans illustriert das dialektisch-paradoxe Ideenjoungliervergnügen, das ich mich Chesterton hab. Im ersten Kapitel werden zwei gegensätzliche Dichter — der dandyhafte Anarchist Lucien Gregor und der bürgerliche Ordnungs-Anakreont Gabriel Syme — im Streitgespräch gegenübergestellt.
Gregor: »Ein Künstler ist dasselbe wie ein Anarchist. Man kann auch umgekehrt sagen: ein Anarchist ist ein Künstler. Der Mann, der eine Bombe wirft, ist ein Künstler, weil er einen großen Augenblick allem anderen vorzieht. Er erkennt, wie viel wertvoller das einmalige Aufflammen, der einmalige Donnerschlag einer wirkungsvollen Explosion ist, als die alltäglichen Körper von ein paar Polizisten. Ein Künstler kümmert sich um keine Regierung, er bricht mit jeglichem Herkommen. Den Dichter erfreut nur die Verwirrung. Wäre dem nicht so, dann müßte das poetischte Ding der Welt die Untergrundbahn sein.«
Syme: »[...] Chaos ist öde, weil im Chaos der Zug tatsächlich irgendwohin gehen würde, nach Baker Street oder nach Bagdad. Der Mensch aber ist ein Magier, und seine ganze Magie besteht darin, daß er sagt: Victoria {Station}, und siehe da, es ist Victoria. Nein, behalten Sie Ihre Bücher mitsamt Ihrer Poesie und Prosa und lassen Sie mich einen Fahrplan lesen mit Tränen des Stolzes. Behalten Sie nur Ihren Byron, der die Niederlagen der Menschheit feiert und geben Sie mir das Kursbuch, das ihre Siege verherrlicht.
[...] Sie behaupten verächtlich, es sei selbstverständlich, daß einer nach Victoria kommen muß, wenn er Sloane Square verlassen hat. Ich aber behaupte, daß in der Zwischenzeit tausenderlei Dinge geschehen könnten und ich jedesmal, wenn ich wirklich mein Ziel erreicht habe, den Eindruck habe, mit knapper Not davongekommen zu sein.«
Zitiert nach der Ausgabe bei Heyne »Der G. K. Chesterton Omnibus 1«.
Und wer mehr von diesem außergewöhnlich unbekannten Werk kennenlernen möchte: hier der ganze Roman auf englisch und noch ein Link zu einer netten Chesterton-Page.
BLICK IN DIE RUNDE DER VEREHRER:
- Wie klassisch dieser Roman im anglo-amerikanischen Raum ist, und wie lebendig er dort auch von jüngeren Genreationen goutiert wird, führt das Computerspiel »Deus Ex« vor, das u.a. von »Der Mann der Donnerstag« deutlich inspiriert wurde und in dessen Levels der Spieler immer wieder auf Zitate aus dem Buch stößt.
- Neil Gaiman schreibt in seinem Blog:
»The Man Who Was Thursday« is one of the most ambiguous books I've ever encountered, and its morals are deeply uncertain.
(Molos Übersetzung) »Der Mann der Donnerstag war« ist eines der undurchschaubarsten Bücher das mir je untergekommen sind, moralisch zutiefst unbestimmbar.
- Susanna Clarke zählt »Der Mann der Donnerstag war« zu ihren Lieblingsbüchern:
Es ist so etwas wie ein sehr aufregender Detektivroman und fast wie ein Gedicht und wie ein theologisches Rätsel — und die meisten Dialoge lesen sich, als hätte Oscar Wilde sie geschrieben. Es ist etwas ganz Besonderes. Die Szenen laufen als eine Serie von Bildern ab — präzise, überraschende, einfache, farbenfrohe Bilder. Es ist wie eine wunderschöne Halluzination oder ein angenehmer Alptraum. Wie in allen Detektivromanen (oder Gedichten oder theologischen Rätseln) können die einfachsten Gegenstände oder Handlungen eine immense Bedeutung haben. Gleichzeitig zeichnet das Buch ein interessantes Bild der Zeit und vermittelt einen guten Eindruck davon, was es hieß, im Jahr 1908 ein dandyhafter englischer Gentleman zu sein.
- Hierzulande hat z.B. Carl Amery G.K.C. enthusiasmiert bejubelt, wie im Vorwort zu »Der G. C. Chesterton Omnibus 1« (Heyne 1993)
Chestertons Romane sind, da ist kaum ein Zweifel möglich, durchaus der modernen Form der Science Fiction, das heißt des spekulativen Genres zugehörig. »Was wäre wenn…?« oder auch: »Was wäre gewesen, wenn…?« — das ist die Frage, welche die wundersamen Maschinen dieses Genres in Bewegung setzt. {…} Wer von all den wissenschaftlich orientierten Prognostikern hat die Geburt des Tory-Faschismus (in »Don Quijotes Wiederkehr«), die Islamisierung Englands (in »Fliegendes Wirtshaus«), die totale Abstrusität des Terrorismus und der Terrorismus-Bekampfer (in »Der Mann der Donnerstag war«) so scharfsinnig antizipiert? Wer hat die Schnappfallen des bürokratischen Wohlfahrtsstaates, die Diktatur der psychiatrischen Normalitäts-Festsetzer, die Reduktion der Kunst zu Ware und die Reduktion der menschlichen Geschicklichkeiten durch die gloabe Normierung so gut gewittert und so amüsant ins Erzählerische übersetzt?
- Michael ›Harry Potter ist superduper‹ Maar zitiert in seinem feinen Rundfunkessay für den SWR den Chesterton-Kenner Joachim Kalka, der folgendermaßen »Der Mann der Donnerstag war« lobpreist:
Der {Roman} hat viel von genialer Kolportage. Das eigenartige Lächeln des Montags, des Sekretärs, der nur auf einer Seite des Gesichts den Mund verzieht, erscheint später großartig als coup de théatre. Ganz in der Ferne scheint es, als ob man eine Menge von Verfolgern drohend herandringen sähe; die Helden mustern den Auflauf unruhig durchs Fernglas. Die Anführer tragen schwarze Halbmasken. Und »schließlich lächelten sie während ihres Gespräches alle, und einer von ihnen lächelte nur auf einer Seite.« An solchen Momenten, in denen es den Leser leise überläuft (…), ist das Buch überreich: Maske und Duell, Attentat und Flucht, Hetzjagd und Verschwörung. Es ist kennzeichnend für Chestertons Werk, daß die stärksten Wirkungen im Ineinander von romance und Reflexion liegen.
- Und in »Cicero« (Sept. 2007) begeistert sich Daniel Kehlmann (nebenbei auch erfrischend über die hiesige Verlagslandschaft spottent) für Chestertons Alptraum, indem er z.B. schreibt:
Ein aktuelles Buch? Aber natürlich — denn es geht um Terror und terroristische Geheimorganistaionen, es geht um den Übereifer bei der Verfolgung des Bösen, es geht darum, dass Zivilisation und Glauben plötzlich selbst jene Gefahren sein können, vor denen sie uns schützen wollen.
•••
Der Mann der Donnerstag war (The Man who was Thuesday, 1908) aus dem Englischen von Heinrich Lautensack; 192 Seiten; Taschenbuch; Wagenbach-Verlag; Berlin, 2002.
oder antiquarisch z.B.:
übersetzt von Bernhard Sengfelder in der Bearbeitung, einem Vorwort und herausgegeben von Carl Amery; zusammen mit »Der Held von Notting-Hill« in »Der G. K. Chesterton Omnibus 1«; 428 Seiten; Taschebuch; Heyne, ›Bibliothek der Science Fiction Literatur‹; München 1993. — Aufgrund der deutlich flexibleren, klareren Sprache zu bevorzugen.
 Eintrag No. 96 — Zu der Frage, was gute SF sei, habe ich im SF-Netzwerk einige Beiträge geschrieben (hier ein Link zu meiner ersten Meldung dort).
Eintrag No. 96 — Zu der Frage, was gute SF sei, habe ich im SF-Netzwerk einige Beiträge geschrieben (hier ein Link zu meiner ersten Meldung dort). Das Buch teil sich in zwei Hälften. Die Kapitel sind in der Regel kurz gehalten, so daß es auf den 575 Seiten 74 davon gibt, jedes mit einer notizhaften Inhaltsangabe überschrieben (schöne Referenz an Tradition, siehe alte Bücher). Stephenson schreibt weitestgehend elegant, nur manchmal war mir das clevere Erklärungsgeklimper zu den zugestanden originellen Technikvisionen zu lang … aber ich habs halt nicht so mit Haarkleinbeschreibungen von Technik in Romanen. Aufgefallen ist mir, daß mich in der zweiten Hälfte des Buches kaum noch etwas was den Figuren widerfährt so gefesselt hat, wie in der ersten Hälfte. Spätestens im letzten Drittel übernimmt mehr und mehr die Spannung, wie die vielen einzelnen Fäden des Buches zusammenfinden. Das ähnelt im Guten (Suspense) wie im Schlechten (Sterilität) dem Eindruck, wenn man ein Uhrwerk oder eine Automate beobachtet … anders gesagt: die Programm-Natur, die aller Kunst innewohnt, tritt markant hervor. Das hat mich nur einmal (in der zweiten Hälfte) bei Passagen über die finsternsten Aspekte von Nells Leben gestört. Nell wird von Aufständischen als Spaßsklavin gehalten, sexuell mißbraucht (wie schon in ihrer Kindheit) und mehrfach vergewaltigt - für meinen Geschmack bedient sich Stephenson hier ca. 2 Seiten lang einen zu aseptischen Ton (Kapitel 72, Seite 542). Ist aber heikle Kiste, ich will darüber nicht richten müssen.
Das Buch teil sich in zwei Hälften. Die Kapitel sind in der Regel kurz gehalten, so daß es auf den 575 Seiten 74 davon gibt, jedes mit einer notizhaften Inhaltsangabe überschrieben (schöne Referenz an Tradition, siehe alte Bücher). Stephenson schreibt weitestgehend elegant, nur manchmal war mir das clevere Erklärungsgeklimper zu den zugestanden originellen Technikvisionen zu lang … aber ich habs halt nicht so mit Haarkleinbeschreibungen von Technik in Romanen. Aufgefallen ist mir, daß mich in der zweiten Hälfte des Buches kaum noch etwas was den Figuren widerfährt so gefesselt hat, wie in der ersten Hälfte. Spätestens im letzten Drittel übernimmt mehr und mehr die Spannung, wie die vielen einzelnen Fäden des Buches zusammenfinden. Das ähnelt im Guten (Suspense) wie im Schlechten (Sterilität) dem Eindruck, wenn man ein Uhrwerk oder eine Automate beobachtet … anders gesagt: die Programm-Natur, die aller Kunst innewohnt, tritt markant hervor. Das hat mich nur einmal (in der zweiten Hälfte) bei Passagen über die finsternsten Aspekte von Nells Leben gestört. Nell wird von Aufständischen als Spaßsklavin gehalten, sexuell mißbraucht (wie schon in ihrer Kindheit) und mehrfach vergewaltigt - für meinen Geschmack bedient sich Stephenson hier ca. 2 Seiten lang einen zu aseptischen Ton (Kapitel 72, Seite 542). Ist aber heikle Kiste, ich will darüber nicht richten müssen. Wohl eine der deutlichsten Reflektion über Form und Stil im Buch findet sich auf
Wohl eine der deutlichsten Reflektion über Form und Stil im Buch findet sich auf
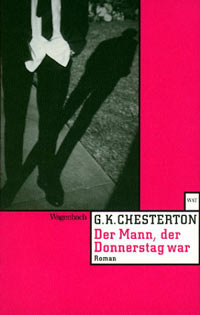 Meine liebste Fundstelle des Romans illustriert das dialektisch-paradoxe Ideenjoungliervergnügen, das ich mich Chesterton hab. Im ersten Kapitel werden zwei gegensätzliche Dichter — der dandyhafte Anarchist Lucien Gregor und der bürgerliche Ordnungs-Anakreont Gabriel Syme — im Streitgespräch gegenübergestellt.
Meine liebste Fundstelle des Romans illustriert das dialektisch-paradoxe Ideenjoungliervergnügen, das ich mich Chesterton hab. Im ersten Kapitel werden zwei gegensätzliche Dichter — der dandyhafte Anarchist Lucien Gregor und der bürgerliche Ordnungs-Anakreont Gabriel Syme — im Streitgespräch gegenübergestellt.