Ian R. MacLeod: »AETHER« oder: Vom melancholischem Leben im Takt der Maschinen
Eintrag No. 376
•••
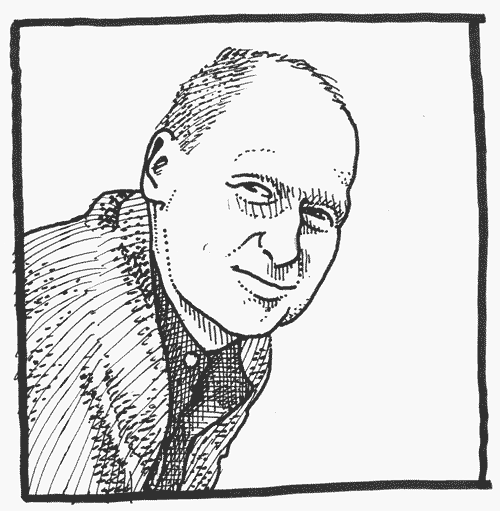 2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.
2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.
So beginnt »Aether« (The Light Ages) des aus Birmingham stammenden Ian R. MacLeod (1956). Dabei sei gleich davor gewarnt, daß dieser auktorial erzählte Rahmenhandlungsanfang erst nach dem Höhepunkt des Buches am Ende wieder geschlossen wird. Den Löwenanteil des Buches bildet die Icherzählerrückblende von Hochmeister Borrows.
—So Charles Dickens mit Fantasy und Steampunk halt ist allerdings ist ein reichlich vager ›in etwa so‹-Vergleich. Nur weil etwas in England und überwiegend in London spielt, sowie arme, reiche und einige kuriose Leute auftreten, ist etwas noch lange nicht so ähnlich wie Charles Dickens, der deutlich sprunghafter als MacLeod erzählt und zwischendurch auch immer wieder gern dick aufträgt, übertreibt oder abschweift. MacLeod selbst ›gesteht‹ in einem Interview[02], sich nu’ auch weniger an Dickens orientiert zu haben, sondern daß vielmehr Autoren wie D. H. Lawrence (für die Schilderung von Roberts Kindheit) oder Henry James (bei den Passagen über gesellschaftliche Zusammenkünfte) als bewusst gewählte ›Paten‹ dienten. Das zeugt dann Prosa, die sich an geduldigere Leser wendet, die mit dem Tonfall von ›klassischen‹ Edelfedern froh zu werden verstehen. Das soll nicht bedeuten, daß MacLeod verkopft schreibt, umständlich erzählt, oder sich gar zu angegilbten Sentimentalitäten hinreißen lässt.
Einige englischsprachige Rezensenten umschreiben den Roman ganz vorzüglich, indem sie sich den deutschen Begriff ›Bildungsroman‹ ausleihen. Immerhin wird eine spannende Lebensreise vom jungen zum alten Menschen ausgebreitet. Um so besser, wenn wie bei »Aether« die Lebensentwicklung des Helden viele Aspekte ihrer Zeit, ihrer Kultur, kurz: der Welt und Wirklichkeiten des Protagonisten streift, wenn er also als exemplarischer Repräsentativmensch plastisch erscheint. —Ich habe das bedrückende Leid der Armen geteilt, und an den Luxustafeln der Reichen gespeist, könnte ich Hochmeister Borrows übermütig in den Mund legen. Ian R. MacLeod alternative Aether-Welt bietet zwar genug von der Echtweltwirklichkeit abweichende Eigenschaften, daß sich in ihr spektakuläre Achterbahnfahrten veranstalten ließen oder übergroße Helden und Schurken auftreten könnten, aber der Autor hat mit seiner Alternativwelt anderes im Sinn, als große Spektakel aufzuführen.
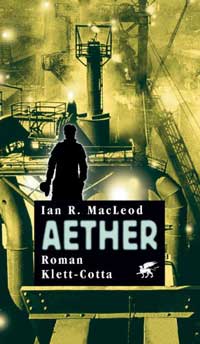 Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.
Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.
Dann dämmert dem jungen Robert langsam, daß mit seiner Mutter etwas nicht stimmt. Bei einem Arbeitsunfall vor vielen Jahren wurde sie mit Aether ›verseucht‹ und leidet seitdem an einer schleichend kulminierenden Veränderung zu einem Wechselbalg, einem wilden Aether-Geist. Diese beklemmenden Kindheitserlebnisse hab ich als originelle Variation des Jekyll & Hyde-Motivs gelesen. Wechselbälger, Trolle und andere Aethergeschädigte werden von den Gilden kassiert, mit schwarzen Kutschen und Wägen in geschlossene Anstalten gebracht, um ein tristes Dasein zu fristen und als Probanten der Aether-forschung zu nützen. Hauptsache, sie verschwinden aus den Augen der Öffentlichkeit. Ein Schicksal, dem Roberts Mutter mit dem tragischsten aller Mittel zu entkommen sucht.
Moment, ich will nicht[03] andeuten, daß »Aether« eine entmutigende Depri-Lektüre ist. MacLeod gönnt dem Leser schon auch längere Passagen mit idyllischen Szenen, z.B. wenn Robert den Märchengeschichten über das magische ›Arkadien‹ Einfell lauscht oder mit seiner Mutter einen Ausflug nordwärts unternimmt. Per Eisenbahn und zu Fuß suchen die beiden die aufgegebene Aethermine Redhouse auf und treffen dort zwei vom Aether Veränderte, die sich dem Zugriff durch die Gilden entziehen konnten: die alte Kräutermeisterin Summerton und Anna Winters, die etwa so alt wie Robert ist. Summerton und Anna sind jedoch keine hässlich-furchterregenden Monster, im Gegenteil wurden sie durch die seltsame Natur des Aethers in so etwas wie ›Lichtalben‹ verwandelt, die allerdings auf ihre Art ebenfalls nicht ganz geheuer sind.
Wieder nix mit einfacher Töpfchen-Kröpfchen-Verteilung von Gut und Böse, dafür ein atmosphärisch dichtes und glaubwürdiges Durcheinander von Abhängigkeiten, Widersprüchen, Faszinationen und Impressionen. So mag es zumindest ich.
Man erwartet von Robert, der Karriere seines Vater zu folgen und als Angehöriger der Niederen Gilde der Werkzeugmacher in der Aetherfabrik von Bracebridge zu arbeiten. Nun wäre kein Bildungsroman komplett ohne vertuschte Geheimnisse, und entsprechend stolpert auch Robert als Gildenlehrling über beunruhigende Spuren und Gerüchte aus der Vergangenheit, die mit dem Arbeitsunfall seiner Mutter zusammenhängen. Im Dritten der sechs Abteilungen des Romans flüchtet Robert aus der ihm zu engen Provinz nach London. Hier schließt er bald Freundschaft mit dem Taschendieb Saul, dem Sohn der Betreiberin eines Traumhauses, einer Art Bordell und Rauschgifthöhle, nur auch mit Aether-Drogen statt Opium. Saul und Robert engagieren sich für eine revolutionäre Bürgerbewegung, die gegen die Missstände der Gildenherrschaft antritt, und sie liefern bissige und beflügelnde Beiträge für die Zeitung ›Der Neue Morgen‹.
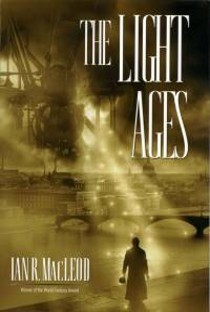 Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.
Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.
Wunderbar versetzt MacLeod die Leser in die ›Froschperpektive‹ Roberts, der erfreulicherweise kein flacher oder lascher Charakter ist, vielmehr eine plausible Mischung aus aufmüpfiger Eigenwilligkeit und naiver Kurzsichtigkeit. Schön ist es, mitgehen zu können, wenn Robert z.B. von quasi-marxistischer Kapitalismus-Kritik begeistert wird; oder mit ihm über die mannigfachen Besonderheiten der Aetherwelt zu staunen; oder sich mit ihm in eine junge Dame aus bester Gesellschaft zu verlieben. Auch wenn die Rahmenhandlung des alten Großmeisters einen gebrochenen Helden zeigt, der verzweifelt seinen Träumen nachspürt, und Roberts Lebensgeschichte einen tragischen Bogen spannt, schimmern immer wieder wundersame Hoffnungslichter im üppig-›realistischen‹ Weltenbau auf. Abgesehen von seinen unterhaltenden Qualitäten verführt »Aether« dazu, über die Begriffe Magie und Technik nachzudenken.
Was man als Magie und was als Technik betrachtet hängt entscheidend vom jeweiligen Wissensstand, bzw. Einweihungsgrad ab. Unsere Echtweltzivilisation blühte in den letzten Jahrhunderten durch die Perfektionierung des Einsatzes von fossilen Energielieferanten auf. Ist es Schicksal der Natur, oder hat sich die Menschheit damals freiwillig z.B. für den Verbrennungsmotor als Genius der Kultur entschieden? In MacLeods Welt gibt es Magie — Elektrizität und Automobile befinden sich noch im experimentellen Stadium — und dennoch nimmt die gesellschaftliche Entwicklung einen Verlauf, der unserer echten Welt mit ihrer bösen Moderne erstaunlich ähnlich ist. Anglo-phile Phantastikreisende werden diesen politischeren Ton sehr wahrscheinlich wiedererkennen, und man darf sich entsprechend freuen, wie gut sich Ian R. MacLeod einreiht zu den Herren Engländern, die vorzügliche, anspruchsvolle und verführerische London- und Königreich-Fantasia schreiben[04].
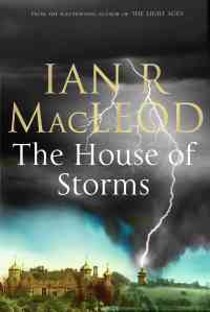 NACHTRAG, Mai 2007:
NACHTRAG, Mai 2007:
Es ist immer ein Glücksfall, wenn Übersetzungen ganz besonders gelingen, grad im sonst oftmals so schluderig gehandhabten Feld der Genre-Phantastik. Es hat mich also besonders gefreut, daß Klett-Cotta Barbara Slawig für die Übersetzung von MacLeods deutschem Debut gewonnen hat. Was ich seit Erscheinen von »Aether« aus dem Gerüchtedschungel erlauschen konnte, läßt mich bangen: »Aether« soll sich nicht so dolle verkauft haben, was ich sehr schade finde, denn dieses Buch bringt alles mit, um sowohl Fantasy/Steampunk-Genrespezialisten zu sättigen, als auch Leser zu erfreuen, die sich nicht speziell für Fantasy, aber eben für England, die Industrielle Revolution, einen gut geschriebenen Roman interessieren. Ich hoffe sehr, daß eine Taschenbuchauflage von »Aether« noch kommt und mit mehr Interesse aufgenommen wird, und ich bange darum, daß die quasi-Fortsertzung »House of Storms« (2005) dem deutschen Publikum noch gereicht wird. »House of Storms« spielt ca. 100 Jahre nach den Geschnehnissen von »Aether« im gleichen Weltenbau, und behandelt u.a. eine Queste um die Evolutionstheorie, einen Bürgerkrieg zwischen West- und Ostengland sowie herausragende Passagen aus der Sicht eines Wechselbalges. Ich persönlich fand diesen zweiten Roman aus der Aetherwelt noch besser, weil eleganter, abwechslungs- und auch äktschnreicher als seinen Vorgänger, und es wäre schade, wenn er hierzulande nur Gesprächsstoff für solche Leser bleibt, die ihre Lektüre auch englisch goutieren.
•••
[03] ERRATA: Dieses
nicht hat durch meine Schlamperei in der Druckfassung dieser Rezension gefehlt, was leider diesen Satz auf den Kopf gestellt hat. Hier also nun korrigiert. •••
Zurück
[04] Eine willkürliche Auswahl: Ian Sinclair, Michael Moorcock, Michael De Larrabetti, Peter Ackroyd, Clive Barker, Kim Newman, Glenn Duncan, Geoff Nicholson; sowie die hier ebenfalls besprochenen Herrn Gaiman und Miéville. •••
Zurück
Tobias O. Meißner: »Das Paradies der Schwerter«, oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt
Eintrag No. 371
•••
 Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[1], dass …
Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[1], dass …
»… {n}iemand dies Buch ohne Verstörung lesen können (wird), …«
… hoffnungsvoll als Kauf- und Leseanreiz.
Das Geständnis vorweg: Ein endgültiges Urteil zu »Das Paradies der Schwerter« will ich nicht wagen. Ich schwebe, was diesen sowohl inhaltlich wie auch sprachlich sehr durchmischten Roman betrifft, in einer Ambivalenz irgendwo zwischen gackernder Kleinjungenbegeisterung und skeptischer Verkopftheit. Ich bewundere Tobias O. Meißner (1967) aufrichtig für seine Chuzpe und Experimentierfreude. Aber ich bin völlig unsicher, ob ich seinen Roman als abenteuerliche Fantasy ernst nehmen kann, vom ›Meisterwerk‹-Ettikett ganz zu schweigen. Zu viele Stilblüten und schiefe Unplausibilitäten türmt er (scheinbar?) munter-unbekümmert aufeinander. Jäger lag also richtig: ich bin verwirrt. Aber ich wollte es ja nicht anders.
Zweifellos bietet aber, wie schon der Titel verspricht, »Das Paradies der Schwerter« zumindest Fresseschläge satt. Üppige Tabelaux mit testosteronprallen Kämpfer-Typen schrecken mich nicht, im Gegenteil. Ich bin so frei, mir durchaus zuzutrauen, solche Geschichten über triebstarke und tatendurstige Kriegerhelden so lesen zu können, dass sie mehr hergeben als lediglich platte Propaganda für bestialisch-›faschistische‹ Männermythen.[2]
Der Bischof der befestigten Stadt am Grünen Fluss im Tal der Glocken lässt ein großes Kampfturnier auf Leben und Tod veranstalten. Sechzehn Kämpfer sollen paarweise in vier Runden gegeneinander antreten. Als Preis wartet ein goldener Stirnreif im Wert von 1000 neuen Talern auf den Turniersieger. Meißner hat also ein kräftiges und altbewährtes Handlungsgerüst gewählt, hochprozentiger lässt sich die große Erzählung über das Dasein als Wettkampf aller gegen alle kaum destillieren.[3]
Die erste Hälfte (Kapitel 1 bis 17 des Buches) kommt als Episoden-Collage daher und stellt dem Leser in sechszehn Strängen erst mal die Teilnehmer des Turniers vor. Das bietet reichlich Anlässe für Stil- und Kulissenwechsel. Eine passende Stelle, um meiner Begeisterung darüber Ausdruck zu verleihen, dass Meißner es wagt, die ästhetische Herausforderung anzunehmen, die die neuen Medien wie z.B. PC- und Konsolenspiele für das schriftliche Erzählen darstellen.
Literatur bleibt im Grunde immer einer linearen Programm-Natur verhaftet, wurscht wie gekonnt der Text den Leser in die Erzählung eintauchen lässt, egal wie gut es dabei gelingt, überzeugend in Mehrdeutigkeiten zu flackern, oder wie sehr auch immer mit Kunstkniffen versucht wird, vieldeutig ›ins Offene‹ zu zeigen. Turniere sind ein klassisches Daddel-Genre, das sich entscheidend dadurch auszeichnet, dass man als Spieler zwischen einer bunten Schar verschiedener Figuren wählen kann, mit denen (bzw. gegen die) man sich dann misst. Auf allzu detaillierte Hintergrundgeschichten wird dabei selten Wert gelegt. Vielmehr helfen bei Spielen (aber auch schon bei Rumsbumsfilmen) mehr die fetzigen Namen, das Styling und Design der Figuren, sowie ihre jeweils eigentümlichen Eigenschaften, Gebärden, Waffen und Tricks, sich verführen zu lassen und in die Charaktere, die Welt und die Äktschn einzutauchen. Dabei generiert jede Spielsession immer wieder eine neue Story-Variante, auch wenn sich diese ›Stories‹, bedingt durch die Begrenzungen des Möglichkeitsraums der Spielarchitektur, bis jetzt noch immer ziemlich ähnlich sind. Hier kann nun, wie Meißner zeigt, Literatur den interaktiven und adrenalinreizenden Spielen Paroli bieten, indem sie tiefere Hintergrundgeschichten statt oberflächlichem Detailreichtum bietet. Prickelnd ist zudem, wie die Leserschaft als Zeuge des ganzen wahnwitzigen Brot-und-Spiele-Irrsinns positioniert wird. Klar sind Romane auf ’ne lahmere Art ›interaktiv‹ als komplizierte virtuelle Digital-Realitäten. Ich nehme schon an, dass Meißner mit »Das Paradies der Schwerter« durchaus mehr anpeilt, als sich nur auf dem Feld der Literatur behaupten zu wollen. Ich vermute, er hatte wohlüberlegterweise im Sinn, sich mit dem Roman auch intermedial an Filmen, Comics und eben digitalen Genrewelten zu messen. —Knackige Äktschn mit Anspruch, wa? Ganz richtig, und ich nähere mich solchen Ambitionen gern mit neugierigem Wohlwollen.
Allerdings brachten mich andererseits Sprachseltsamkeiten des Romans oft zum Stirnerunzeln und Augenbrauenlüpfen, und rabiat-ungestümes Zusammenzimmern von Unterschiedlichstem ließ mich zudem grübeln, ob ich mich ›im Sinne des Buches‹ amüsierte, oder doch eher als ›gegen den Strich-Leser‹ meine Freude damit hatte. Beispielsweise als Piraten nächtens ein Schiff nahe der Küste des Tals der Glocken überfallen, und der junge Wandermönch Wei Guan Zhou, der aus fernen Landen im Osten stammt, Verdana rettet:
»›D … danke …‹, keuchte die junge Frau, eine Einheimische in knapper, Bewegung ermöglichender Abenteurerkleidung.«
[4]Solch moderner Versandhauskatalog-Sound klingt für mich wie ein alberner oder unpassender Anachronismus. Oder ist sowas als satirische Geste, als Insiderjoke auf Rollenspielklischees gedacht? Ich bin nicht sicher. Doch es gibt auch n’hübsches Büschel frech-origineller Anachronismen in Meißners namenloser Prügel-Welt, z.B. drogensüchtige, sprich an der Nadel hängende Glücksritter, oder westernmäßige Shootouts mit kleinen Armbrüsten.
Ein weiteres Beispiel für ein irritierendes Sprachtrumm bietet ein Kapitel mit Waisenkinderschar. Die kleine Lilin rennt aufgeregt durch den Wald, um ihren großen Brüdern von der Turnier-Einladung zu berichten:
»Sie war schnell wie ein Reh. Die Bäume zuckten vorüber, ein Wechsel von Dunkel und Grün, einzig verbunden durch ihre wehenden blonden Haare.«
[5]Leider keine neue Ent-Variante (obwohl hier Bäume mit blonden Haaren zucken), sondern nur eine missverständliche Bezüglichkeit. Ist das nun ‘ne echte Schlamperei des Autoren bzw. seines Lektorats? Oder soll das ein gewollt ›ungewöhnliches‹ Bild sein, vielleicht sogar zu verstehen als Diss gegen allzu impressionistisch-lyrische Töne, die in der Fantasy gern mal zu picksüßer Intensität anschwellen? Nun, ich ärgere mich nicht, sondern bin erstaunt und belustigt und eben unschlüssig. Aber immerhin: es ist durchwegs viel los. Die Tiefe des Weltenbaus, mit seinen manchmal haarsträubenden Vereinfachungen[6], bleibt durchwegs auf Marionettentheater-Niveau. Dafür überschüttet Meißner die Leser mit einem munteren Schwall an (ab und zu platten, doch überwiegend spritzigen) Ideen und Ereignissen. Grober atmosphärischer Kurs dabei: immer schön ordentlich rumscheuchen die Sprache, sowohl zu den niederen Pfaden, wenn’s grimmig, dreckig, martialisch, zornig zugeht, als auch hinauf zu idyllischen Wiesen, wenn Empörung, Mitleid, Sehnsucht und Trauriges zur Sprache kommt. —Haut‘s ummanand, ihr Metaphern, wu-ha!
 Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.
Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.
—Jetzt geeehts loo-oos!, denn mit Turnierbeginn nimmt Meißner neben dem Schreibzeug auch das Rollenspielwürfel- und Tabellenwerkzeug zur Hand, um die Geschichte erst mal auszuspielen, bevor er – selbst zum ohnmächtigen Zuschauer und Analytiker ›degradiert‹ – die Ereignisse des Kampfprotokolls schriftstellerisch aufbereitet.[7] Da nutzt ein Autor die Praxis und das Werkzeug des Rollenspielgenres, aber nicht um eine Serie loszutreten, oder als eines von vielen Rädchen den steten Produktausstoß einer Marke zu gewährleisten, sondern um einen Roman lang sein eigenes Experiment aufzuführen: —Hut ab! Als Leser schaute Meißner neugierig und gespannt dabei zu, welche ungewöhnlichen Handlungskurven durch die Zufallsentscheidungen der Würfelei gekratzt werden. Allerdings ragen auch hier wacklig-ungebändigte Sprachornamente aus dem Erzählfluss, z.B. vor dem Schlussakkord des ersten Kampfes:
»Über Grotyn Terentius Craos Kopf detonierte die Sonne und überschüttete das trichterförmige Universum mit hochbeschleunigten Magmanadeln.«
[8]Und im dritten Kampf werden Waffen ziemlich unbekümmert vermenschlicht:
»Wieder stöhnte das Schwert auf, schien die Erlösung des Zerbrechens zu erwägen.«
[9]—Doch hinfort mit euch, ihr dummen Nörgelgedanken eines Sprach- und Klangfetischisten.
Für das Publikum besteht die Gaudi eines Turniers zu einem Gutteil darin, dass sich unten in der Arena erbarmungslos eliminiert wird, während sich von oben das Schicksalsgeschehen wunderbar ungeschoren verfolgen und bewerten lässt. Auch diesen Aspekt von Turnierereignissen zapft Tobias O. Meißner auf anregende Art an, und versteht zumeist überzeugend, die Arena als Kessel der Gemütserregungs- und Enttäuschungs-Dynamiken zu inszenieren. Zwischen den Kämpfen kommentieren zwei berühmte Wettkönige in Sportmoderatoren-Manier die Duelle, stellen Prognosen auf und bemühen sich, den zunehmend chaotisch-herben Verlauf des Wettkampfes durch Gewitzel aufzulockern. Durchaus gekonnt unheimlich dabei, wie leicht es diesen beiden Kennern fällt, ›tödliche Spiele‹ als sportiv-ästhetische Darbietung zu genießen. Meißner spottet erfreulich ätzend über z.B. das hysterische Gewese, das in den Massenmedien um Show-Wettkämpfe, Ekel-Tests und Superstar-Erwählungen veranstaltet wird.
Die Arena als Brennglas eines Fantasy-Spektakels über Spektakel, Spektakelindustrie und Spektakel-Lüsternheit. In Sachen Stilsouveränität eine vielleicht etwas schmutzige Linse, die nicht immer die richtige Sprachklang-Tiefenschärfe findet, aber die ›Unbescheidenheit‹ Meißners wiegt das für mich locker auf. So klug und selbstgewahr, wie er sich in dem oben erwähnten Interview äußert, kann er dem Rezensenten und anderen Lesern vielleicht nachsehen, wenn deren ›innere Literaten‹ sich finster grummelnd unter Deck verkriechen. Der Posse von ›inneren Trash-Freaks & Metallern‹ wird mit »Das Paradies der Schwerter« reichlich Gelegenheit geboten, mitzujohlen und headzubangen. Das Buch mag mit enervierenden Makeln gesprenkelt sein, aber das ist nun mal der Preis dafür, wenn man es darauf ankommen lässt, dass Literatur ›rocken‹ soll. Wer sich dafür interessiert, welch interessante Pfade die zeitgenössische, zudem die deutschsprachige, Fantasy einschlagen kann, sollte mal ein Exemplar des Buches in die Hand zu nehmen und ankosten. Subjektiv bin ich nicht sicher, ob der Roman ein krasser Spaß oder alberne Akrobatik ist, aber wenn ich den Inhalt Revue passieren lasse, muss ich innerlich grinsen. Und selbst wenn meine Belustigung nicht immer ›im Sinne des Autors‹ sein mag, nehme ich sie als Hinweis dafür, dass das Buch objektiv betrachtet wohl durchaus was taugt, trotz aller Geschmacks-Grätschen. —Good fight. Good night.
•••
[1] »
Warnung vor einem Meisterwerk –
Das Leben ist ein Turnier: Tobias O. Meißners Kunst der Grausamkeit« in der FAZ vom 27. März 2004.
••• ZURÜCK
[2] Man ›gönne‹ sich z.B. die bestenfalls lapsige, schlimmstenfalls arrogante Begründung von Rainer Zondergeldt, Fantasy und nichteuropäisch-westliche Werke weitestgehend aus seinem
»Lexikon der Phantastischen Literatur« (Suhrkamp Verlag 1983; erweiterte Neufassung zusammen mit Holger E. Wiedenstried, Erdmann Verlag 1998) auszuklammern, wie auch seinen ›tendentiösen‹ (sprich: geringschätzigen) Eintrag zu Robert E. Howard dort.
••• ZURÜCK
[3] Oder wie es der berühmt-berüchtigte
›Medienphilosoph‹ Peter Sloterdijk in seiner großen Menschheitserzählung umschreibt:
»Die Faszination von Turnieren {…}: Bei ihnen wird, analog zur Tierzucht, das Eliminationsverfahren zu einer menschgemachten Selektion. Er oder ich, wir oder sie – das wird in der Arena wie in einer Versuchsanordnung künstlicher Selektion eingeübt. {…} Wenn das griechische Leitwort lautete: Erkenne dich selbst, so heißt das römische: Erkenne die Lage.«
Aus dem Exkurs »Später sterben im Aphitheater. Über den Aufschub, römisch« in »Sphären: Globen – Makrosphärologie«, Suhrkamp 1999, Seite 330 ff.
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
[6] Kapitel 24, S. 277: Eine junge Landadelige, die um einen Teilnehmer (ihren namenlosen Retter aus einer der Vorgeschichten) bangt, und ihren Vater dafür haßt, sie zum Turnier geschleift zu haben, damit Heiratswillige die
›Ware‹ beschauen können. Meißner schreibt:
»Angrica hätte darüber nachgedacht, ihren Vater aus Zorn und Verachtung zu ermorden, aber ihre Erziehung legte ihr den Gedanken an Selbstmord näher.«
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
[8] Kapitel 18, S. 239. Die Sonne explodiert freilich nur metaphorisch.
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
Kritikergedicht
(Eintrag No. 370; Gelegenheitsgedicht) — Gestern abend fiels mir aus dem Kopf.
•••
Ausbuh’n und preisen,
loben und verreissen,
kann ein Rezensent
wenn er sich auskennt.
Jorge Luis Borges: »25. August 1983«
Erstellt von molosovsky um 16:50
in
Literatur,
Jorge Luis Borges,
Mark Z. Danielewski,
Phantastik,
Bibliothek von Babel,
Helmut Krausser,
Klassiker,
Francois Schuiten,
Umberto Eco,
Arno Schmidt,
Buch-Rezension
Eintrag No. 366
ERSTE FOLGE VON MOLOS WANDERUNGEN DURCH
 DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
01. Oktober 2007: Eine Runde Fehlermerzung.
Hurrah, es tut sich etwas in Sachen Phantastik! Nein, ich meine nicht die Schwemme an Genre-(Jugend-)Phantastik, diesen (leider meistens) läppischen Franchisevehikeln, die mit Zauberlehrlingen und Drachenreitern als McHelden Konsumententreue an sich binden wollen.  Ganz im Gegenteil: Ich bin sehr zufrieden, wie die Büchergilde Gutenberg mit ihrer Neuauflage der von Jorge Luis Borges zusammengestellten Anthologie-Reihe »Die Bibliothek von Babel« vorführt, daß man auch auf löbliche Weise auf den gegenwärtigen Phantastik-Hype aufspringen kann.[01]
Ganz im Gegenteil: Ich bin sehr zufrieden, wie die Büchergilde Gutenberg mit ihrer Neuauflage der von Jorge Luis Borges zusammengestellten Anthologie-Reihe »Die Bibliothek von Babel« vorführt, daß man auch auf löbliche Weise auf den gegenwärtigen Phantastik-Hype aufspringen kann.[01]
Traut Euch ruhig, liebe Leser, und folgt mir auf meinem ersten Streifzug durch das Borges'sche ›Fantasyland‹ und lest…
NATÜRLICH, EINE ALTE HANDSCHRIFT (naja, ein Roman aus den frühen Achtzigern)
Den Lyriker, Essayisten und Erzähler Jorge Luis Borges (1899-1986) habe ich als Teen mittels der Lektüre von Umberto Ecos (1932) Roman »Der Name der Rose« (1980 / dt. 1982) entdeckt.
Eco hatte sich bereits in den 60ger- und 70ger-Jahren einen guten Ruf als gründlicher, streitbarer und gewitzter Intellektueller erschrieben. Einerseits trat er mit (nicht gerade immer leicht lesbaren, aber ungemein lehr- & aufschlussreichen) Fachbüchern zu Semiotik hervor (z.B. »Lector in fabula« und »Das Offene Kunstwerk«), andererseits brillierte er durch gewitzt-muntere und jedermensch zugängliche Essays und Kolumnen (z.B. »Sämtliche Glossen und Parodien«). Nicht zuletzt sorgten dann die politischen Wirren der Siebzigerjahre dafür, daß Eco 1978 den Wunsch entwickelte einen Mönch zu vergiften, und »Der Name der Rose« ist die Frucht dieser Mordlust.
Nun ist, wie ich zweifelsohne annehme, Eco ein großer Fan von Borges. Beide darf man als Edelfedern bezeichnen, doch beide pflegen (bzw. pflegten) auch eine Schwäche für Triviales, für Krimis und keck Phantastisches; beide also (für mich) meisterhafte Grenzüberschreiter, die es vorzüglich verstehen (bzw. verstanden) kurzweiliges Fabulieren köstlich mit inspirierender Gelehrsamkeit und philosophischen Kalorien zu vereinen.
Bei ›uns‹ begeisterten Genrelesern ist es nicht selten der Fall, daß sie die Bösewichter reizvoller finden als die Guten. So sind die liebenden Helden von Wilkie Collins »Die Frau in Weiß« fade Pappfiguren verglichen mit dem schillernden Count Fosco[02]. Die Möchtegernweltherrscher — ob Le Chiffre, Goldfinger oder Bloomfeld — der James Bond-Geschichten stellen, was Glamour und Faszinationskraft angeht, den Agentenhelden zumeist locker in den Schatten. Zumindest für einen Genrefreak wie mich ist es da keineswegs verwunderlich oder ungebührlich, wenn Eco seine Verehrung für Borges dadurch zum Ausdruck brachte, daß er Jorge Luis zum ›Vorbild‹ für den Strippenzieher der tödlichen Machenschaften seines mittelalterlichen Kriminal-Schauer-Schlüsselromans erwählte. Zwar sind mir keine Stellungnahmen von Borges zu Ecos »Der Name der Rose« bekannt, aber ich stelle mir gerne vor, daß der alte Borges seine stille Freude daran hatte, wie Eco ihn in der Figur des Jorge von Burgos liebevoll ›negativ portraitierte‹.
Zwar sind mir keine Stellungnahmen von Borges zu Ecos »Der Name der Rose« bekannt, aber ich stelle mir gerne vor, daß der alte Borges seine stille Freude daran hatte, wie Eco ihn in der Figur des Jorge von Burgos liebevoll ›negativ portraitierte‹.
Immerhin: Wer möchte nicht gern der Dungeon-Master und alleinige Geheimnishüter eines mit Fallen gespickten Bibliotheksirrgartens sein, der stimmungsmäßig vielleicht noch am ehesten an die Kerkerphantasien von Piranesi erinnert (die ja tatsächlich dem genialen Filmarchitekten Dante Ferretti als Vorbild für die Bernd Eichinger-Produktion dienten)?
Und dieser (wie Borges selbst auch) blinde Fanatikergreis Jorge von Burgos ist ein zum Niederknien beeindruckend-schröcklicher Bösewicht. Bester Philosophen-Horror, wenn Jorge im Disput mit William von Baskerville das Lachen als teuflisch verdammt. Wunderbar die Volte, wenn Jorge störrisch auf die Deutungshoheit des kirchlichen Machtapperates beharrt[03]:
»Wer zweifelt, wende sich an eine Autorität, befrage die Schriften eines heiligen Vaters oder Gelehrten, und schon endet jeder Zweifel.«
›Volte‹, weil Borges selbst eher (wenn schon denn schon) den fröhlicheren Strömungen eines anarchistischeren Katholizismus etwas abgewinnen konnte[04]:
»{I}ch {hänge} keinem philosophischem System {an}, außer, und hier könnte ich mit
Chesterton übereinstimmen, dem System der Ratlosigkeit.«
Schon vor über zwanzig Jahren als Jugendlicher, war ich (wie heut noch) hin- und hergerissen zwischen Größenwahn und genau dieser Ratlosigkeit, und dank der Hinweise des Buches »Das Geheimnis der Rose entschlüsselt« (Klaus Ickert & Ursula Schick, Heyne 1986) als Kompass, fand ich damals eben bald schon zu meinen ersten Borges-Büchern. Und da ich mich sonst gern und heftig in die Pose des kritischen Lesers/Rezensenten werfe, der bei trostspendenden Literarturen verächtlich abwinkt, freu ich mich ausgleichend gestehen zu können, daß die ›Relevante Phantastik‹ eines Borges zu den wenigen Narrationen gehört, deren tröstende Töne ich gerne vernehme. Vergänglichkeit als Chance sehen, das ist der ganze Trick, so unheimlich er auch anmutet.
DIE GROSSE TRADITION DES DISREPEKTIERLICHEN
Allzu gerne erinnere ich immer wieder an den manchen wohl so gar nicht schmeckenden Umstand, daß Phantastik nicht weniger bezeichnet, denn alles Reden in Metaphern, Allegorien, Symbolen, Sprachbildern, Anwend- und Übertragbarkeiten, eben alles ›sehen machendes‹ und (vor dem inneren Auge) ›erscheinen lassendes‹ Schildern und Erzählen.
Aber Phantastik kann man auf viele verschiedene Arten betreiben. Das fängt im Kleinen und Alltäglichen mit solchen Metaphern wie »Schmetterlinge im Bauch« (fürs Solar Plexus-& Magenkribbeln beim Verliebtsein) oder »Das Glas ist halb voll / halb leer« (für optimistische / pessimistische Realitätstunnelperspektiven) an und geht im Großen und Weltbewegenden weiter, wenn politisch vom »vollen Boot« oder dem »Haus Europas« gebabbbelt wird, oder wenn die Wissenschaften uns mit neuen Fabeltier-Allegorien wie Schrödingers Katze, Pawolows Hund oder Hilberts Hotel die Kompliziertheit des Universums zu erklären trachten. (Und ja: ich mag die Vorstellung, ein Hotel als Fabeltier zu nehmen.)
Das einfache Alltags-Metaphernregister, mit dem wir der Innenwelt unserer Gedanken und Empfindungen Ausdruck verleihen, oder mit denen wir uns die schwer zu fassenden und beobachtbaren Vorgänge der Außenwelt gegenseitig erklären, hat sich schon vor langer Zeit hochverfeinert zu kleinen Erzählungsformen, die sich zuhauf bereits in den Versepen der Altvorderen, in heiligen Texten und Märchen finden lassen. Wie groß ist allein schon das Phantastik-Repertoir der Fabeln, mit ihren königlichen Löwen, kriegerischen Hunden, eitlen Pfauen, diebischen Raben, verschlagenen Füchsen, faulen Musikergrillen und fleissigen Arbeitsameisen. Alles menschliche Eigenschaften, die wir auf die Tiere übertragen, um auf unterhaltsame Weise z.B. moralische Lektionen weiterzugeben. Kaum Einwände vernehme ich, wenn respektable Erzphilosophen sich mit Phantastik behelfen, um ihre welterklärenden Gedanken auszubreiten, wie es der Initiator des ›Ideenkrieges um das Sein‹ Platon mit seinem berühmten Höhlengleichnis und dem nicht ganz so berühmten Sonnengleichnis tat.
Also immer gern her damit, wenn sich nun die Büchergilde Gutenberg mit Jorge Luis Borges einem der großen Phantasten des 20. Jahrhunderts annimmt, indem man von April 2007 bis April 2008 in 5 Staffeln die von Borges ausgewählten 30 Bände der »Bibliothek von Babel« endlich wieder für deutsche Leser zugänglich macht[05]. Ich konnte nicht umhin, den »Die Welt«-Autoren Henrik Werner mit meinem Literturwelt-Eintrag »Die vermeindliche Wirklichkeitsflucht« zu rügen, wenn er dieses mutige Unterfangen der Büchergilde gedankenschwach in einen Topf wirft mit dem oben angesprochenen McFantasy-Hype. Mit großer Freude aber las ich Thomas Klingenmaiers löblich verständnisvolle Jubelmeldung »Der Tod und weitere unseriöse Bekanntschaften« in der Stuttgarter Zeitung. Fast möcht ich meinen, daß Klingenmaier die beiden Schlußabsätze seines Artikels aus meinem Knochenmark abschrieb, so treffend, knapp und überzeugend klärt er die verzwickte Lage der Phantastik wenn es bei ihm heißt (Hervorhebungen von Molo):
Dass Fantasy und Horror nicht nur bei jungen Lesern Lektürefieber entzünden, geht in die Klagen über den Verfall der Lesekultur nicht ein. Die Reputation moderner Fantastik beim literarischen Establishment ist verheerend. Mit Nachsicht kann einzig ausgewiesene Kinder- und Jugendliteratur wie »Harry Potter« rechnen. Ihr wird das Potenzial gutgeschrieben, zur Literatur im Allgemeinen hinzuführen. Liest der Interessierte dann aber Tad Williams statt Martin Walser, gilt die Leseförderung wieder als gescheitert. Gegen solche Arroganz kann »Die Bibliothek von Babel« helfen, auch wenn sie moderne Fantastik nicht umfasst. Das wenig Respektierliche hat eine große Tradition.
Genrefreunde können in Jorge Luis Borges’ Sammlung Texte in anderen Farben als den gewohnten entdecken. Und mancher Rationalist, der angesichts von Elfen, Zwergen und Drachen in der modernen Fantasy erst einmal reflexhaft in Verteidigungsstellung zum Schutz der Vernunft geht, kann sich hier entspannt daran erinnern, das Literatur nicht unbedingt das verdoppeln muss, was wir jeden Tag vor Augen haben, dass es ihr auch erlaubt ist, mit dem zu spielen, was jede Nacht durch unsere Träume geistert.
Phantastik kann eben schnell langweilig und schal werden, wenn das Metaphernregister zur Formelhaftigkeit verkommt, sich aufdröseln läßt wie ein simples Zuordnungsspiel oder ein »Malen nach Zahlen«-Bild. Spannend, aber eben auch schwerer einzuordnen, ist aber Phantastik, bei der die Unmöglichkeiten sowohl für sich stehen, als auch einen Bezug zur tatsächlichen Wirklichkeit anklingen lassen.
»25. AUGUST 1983«
Zu Meister Borges selbst, von dem fünf Erzählungen im fünften Band (erste Staffel, April 2007) der »Bibliothek von Babel«-Anthoreihe geboten werden, nebst einem Vorwort von Martin Gregor-Dellin[06],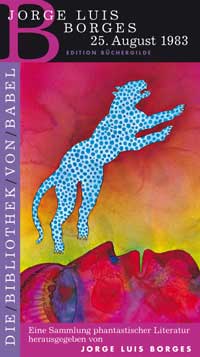 einem Borges-Interview mit Maria Ester Vásquez und einer bio/bibliographischen Zeittafel.
einem Borges-Interview mit Maria Ester Vásquez und einer bio/bibliographischen Zeittafel.
Glücklich macht mich allein schon, daß die 30 Babelbände Lesern (mit Ausnahme einiger Novellen wie z.B Beckfords »Vathek«) ein abwechslungsreiches Potpourrie an Kurzgechichten aufspielt. Völlig zurecht jammert man ja kläglich darüber, daß es in den Mainstream-Printmedien fast gar keine Plattform mehr für Kurzprosa gibt, und daß sich diese Textform auch als Buch bei uns schwer tut.
Da kann ich mich nur verdutzt fragen: Warum eigentlich?
Immerhin eignen sich Kurzgeschichten wie kaum etwas als Unterwegs-, Zu-Bett-geh- und Zwischendurchlektüre, sie bieten stilistischen, strukturellen und perspektivischen Abwechslungsreichtum und anders als Romane, konzentrieren sie sich zumeist auf das zündende Aufblühen einer Idee. Wer hat schon allerweil Lust auf ganze Torten, wenn doch das Naschen verschiedener Pralinee- & Konfektstückchen ebenfalls höchste Genüße bereitet?
Gleich mit der ersten Geschichte der Auswahl, (von der die Antho-Reihe auch ihren Titel entliehen hat), »Die Bibliothek von Babel«[07] wird mit den eröffnenden Worten…
{…d}as Universum, das andere die Bibliothek nennen{…}
…eine riesige Phantastikbühne aufgefahren, ein Gedankenspiel, das so ähnlich allen bibliomanen lesenden Weltenwanderen vertraut sein dürfte. Ein namenloser Einwohner schildert uns das Leben in dieser Bibliothekswelt. Wie er als junger Mensch den Katalog aller Kataloge gesucht hat; daß es…
{…}in der ungeheuer weiträumigen Bibliothek nicht zwei identische Bücher {gibt…}
…und er erzählt von den verschiedenen, z.T. im Streit miteinander lebenden Fraktionen der Bibliothekare: den Mystikern, den Inquisitoren, den Lästerern, den Pietätslosen. Grob trau ich mich zusammenfassen, daß diese Geschichte eine stoisch anmutende Meditation ist, die unerschrocken über Phänomene wie Unendlichkeit, Variationsvielfalt, und die Rätsel von Raum und Zeit spricht. — Literarisch reizvoll ist diese Geschichte auch, weil Borges sich hierbei sozusagen als Fanfiction-Schreiber verhält, oder wie er selbst in einem Interview erklärt[08]:
»Diese Story habe ich geschrieben, als ich besonders versessen darauf war, Kafka nachzuäffen«
 Die zweite Geschichte, »25. August 1983« [09], zeigt nun, wozu sich Phantastik vorzüglich eignet: Borges fabuliert hier mit sich selbst als Protagonisten, mit Spengseln eines feinen zart-bitterem Humors aber durchaus ernst, über die sehr dunkle menschliche Erfahrung des Selbstmorders, bzw. des Selbstmordgedankenspiels. Ich will die Depression nicht verherrlichen, bin aber der Meinung, daß es zu den fundamentalen Aspekten des Lebens gehört, mit dem Gedanken zu flirten der eigenen Existenz ein Ende zu setzten. Immerhin sind wir alle der Sterblichkeit ausgeliefert, und gerade in der Zeit z.B. des Übergangs vom Jugendlichen zum Erwachsenen können erschreckende Vor- & Hinter-den-Kulissen-Erfahrungen mit der Schlechthinigkeit der (Menschen-)Welt dazu führen, daß man auf die Idee kommt, der Misrere des Ausgeliefertseins zum Leben mit eigener Gestaltungsmacht entgegenzuwirken. Borges inszeniert sich hier als Doppelgänger. Ein junger Borges begegnet in einem Hotel einem alten Borges, der sich selbst vergiftet hat, nun sterbend im Bett liegt und mit seinem jüngeren Ich plaudert. Ich finde es zum schmunzeln (aber auch unheimlich), wie die beiden sich gegenseitig ausloten, um herauszubekommen, wer sich da in wessen Traum verirrt hat, oder ob gar beide träumen. Auch wird offen über die Erfahrung des Ekels vor sich selbst gesprochen, wenn der junge Borges zum alten sagt:
Die zweite Geschichte, »25. August 1983« [09], zeigt nun, wozu sich Phantastik vorzüglich eignet: Borges fabuliert hier mit sich selbst als Protagonisten, mit Spengseln eines feinen zart-bitterem Humors aber durchaus ernst, über die sehr dunkle menschliche Erfahrung des Selbstmorders, bzw. des Selbstmordgedankenspiels. Ich will die Depression nicht verherrlichen, bin aber der Meinung, daß es zu den fundamentalen Aspekten des Lebens gehört, mit dem Gedanken zu flirten der eigenen Existenz ein Ende zu setzten. Immerhin sind wir alle der Sterblichkeit ausgeliefert, und gerade in der Zeit z.B. des Übergangs vom Jugendlichen zum Erwachsenen können erschreckende Vor- & Hinter-den-Kulissen-Erfahrungen mit der Schlechthinigkeit der (Menschen-)Welt dazu führen, daß man auf die Idee kommt, der Misrere des Ausgeliefertseins zum Leben mit eigener Gestaltungsmacht entgegenzuwirken. Borges inszeniert sich hier als Doppelgänger. Ein junger Borges begegnet in einem Hotel einem alten Borges, der sich selbst vergiftet hat, nun sterbend im Bett liegt und mit seinem jüngeren Ich plaudert. Ich finde es zum schmunzeln (aber auch unheimlich), wie die beiden sich gegenseitig ausloten, um herauszubekommen, wer sich da in wessen Traum verirrt hat, oder ob gar beide träumen. Auch wird offen über die Erfahrung des Ekels vor sich selbst gesprochen, wenn der junge Borges zum alten sagt:
»Ich hasse dein Gesicht, das meine Karikatur ist, ich hasse deine Stimme, die mich nachäfft, ich hasse deinen geschwollenen Satzbau, der der meine ist.«
Tja, mit sich selbst kann man langfristig wohl nur dann im Reinen bleiben, solange mensch sich als alte Person erträglich vorzustellen vermag.
Die kürzeste Erzählung der Auswahl, »Die Rose des Paracelsus«[10], führt nun den bekannten Renaissancegelehrten als Magier vor. Der hätte gerne einen Schüler, und es folgt eine seltsam-komisch schiefgelaufende Initiationsprüfung. Harry Potter-Fans aufgepasst: es geht um den Stein den Weisen, den der Schüler finden möchte, und von dem Paracelsus meint, daß der Weg zum Stein der Weisen bereits der Stein selbst ist. Außerdem kann man lernen, was man von einem Wunderwirker niemals verlangen darf.
»Blaue Tiger«[11] bietet eine passende Gelegenheit, meiner heftigen Begeisterung für die wunderschönen Titelaquarelle von Bernhard Jäger Platz eimzuräumen, sowie darüber, daß die Büchergilde diesen exzellenten Illustrator über die Herausforderung sprechen läßt, dreißig Bände Phantastik mit Umschlagszier zu versorgen. Und gerade dieser Band 5 mit den Borges-Erzählungen ist für Illustratoren keine leichte Sache, denn wie Jäger schön erklärt:
Borges {…} ist hoch-intellektuell, schwer zu illustrieren. Man muss sich eine Erzählung herausnehmen, ein Schlagwort oder ein Kürzel, und darüber arbeiten. Der Schlaf und der Traum spielen eine große Rolle. Es sind Geschichten, von denen man nicht weiß, sind sie Traum oder Realität. Das realistisch darzustellen, ist unmöglich. Von allen, die ich bisher gelesen habe, ist Borges der intellektuellste, einer, der auch mit dem Genre spielt. Das ist schon toll, das ist große Literatur.
Auch ich hätte mich bei der gegebenen Auwahl für »Blaue Tiger« entschieden, denn hier legt Borges noch am ehesten sowas wie eine ›normale‹ Mystery-Abenteuergeschichte vor, wenn er Alexander Craigie, Prof. für abend- und morgenländische Logik in Lahor, berichten läßt von seiner Queste nach dem Blauen Tiger im Ganghes-Delta. Klassischer Abenteuer- & Phantastik-›Trash‹ geht noch ab, wenn der Europäer auf einen Dschungelstamm abrgläubisch raunender Geheimnisträger trifft; der Borges'sche Sonderpowerboost aber zündet, wenn Craigie statt des gewünschten Tigers rätselhafte blaue Kieselsteine findet, die sich gänzlich unerhört verhalten, auf eine Weise, die vor allem mathematisch angehauchten Gemüthern richtiggehend Lovecraft'schen Kosmischen Schrecken einjagen dürfte. Der Protag aber entpuppt sich als echter Jedivorläufer, da er einen ungewöhnlichen gewaltfreien Weg findet, sich vom Wahnsinn der Steine zu befreien. Da schimmern dann doch die sozialistisch-kommunistischen Wallungen durch, die den jungen Borges durchwallt haben mögen, und von denen er sich einst befreit zu haben glaubte, als er zwei entsprechend tendentiöse Frühwerke vernichtete, ehe er nach einem längeren Europaaufenthalt nach Südamerika zurückkehrte.
Die letzte Geschichte ist die beunruhigende, aber (wie immer bei Borges) mit scheinbar müheloser Elegenaz ausgebreitete Traumdystopie »Utopie eines müden Mannes«[12]. In dieser Geschichte tritt Eudoro Acevedo auf, ein mittlerweile steinalter Prof. für englische und amerikanische Literatur, der selbst Phantastik schreibt, und sich (ohne daß dies große erklärt wird) in einer öden fernen Zukunft der Erde wiederfindet, und sich mit einem der dortigen Bewohner unterhält. Da gibts freche Rempeleien gegen religiöse Scholastenphantastik (…
»Ich entsinne mich«, antwortete er {dem Zukunftsmenschen}, »zwei phantastische Erzählungen ohne Mißfallen gelesen zu haben. Die ›Reisen des Käptäns Lemuel Guilliver‹, die viele für wahr halten, und die ›Summa Theologica‹.«
…) und vermittels einer Platzierung des Namens Adolf Hitler kurz vor Schluß, dämmert wohl auch dem letzten Leser, was für eine düstere Gesellschaftskritik das Geplauder der Erzählung birgt.
Einen munteren und interessanten Blick auf Borges gewährt das abschließende Interview des Autoren mit Maria Esther Vasquez (das leider keine Jahres & Quellenangabe hat, aber ich vermute, daß dieses Gespräch zum Ersterscheinen der Anthoreihe 1973 entstande ist). Borges erzählt über seine frühen Jahre, seine Jugendzeit in Europa, seinen Blick auf das eigene Werk, seine immer wiederkehrenden Themen (Labyrinth, Spiegel, Vielfalt des Ichs, wiederkehrende Zyklen, Tiger, Messer- und Mut-Sekte, Buenos Aires, Säbel), über Politik, Ehrungen & Vorlieben, nordische Sprachen, Leben, eigene Fehler & Tugenden sowie Musik, Malerei & Tod. — Da vergnüg ich mich freilich, wenn Borges und ich ein wenig Geschmack gemein haben, und er freimütig über das Gekleckse eines El Greco lästert, oder Johannes Brahms als einen ihn berührenden Komponisten lobt.
Resummee: ich bin mehr als glücklich über die Großunternehmung der Büchergilde Gutenberg, uns diesen Schatz der ›literarischen Phanatstik‹ neuauflegt wieder zugänglich zu machen (kann man auch als Nicht-Büchergildenmitflied in der Edition Büchergilde erstehen; einzeln oder auch mit ermäßgten Staffelpreisen). Ich gebe zu: man braucht für die ganzen 30 Bände schon einen bessertrainierten Geldbörsenmuskel. Aber für was gibts Feiertags- und Geburtstagsschenkerei?! Diese 30 Bände sind eine Anschaffung fürs Leben.
Ich begebe mich weiter mit Major Grubert-Hut auf Exkursion in die Babelgefilde, verabschiede mich für jetzt, bevor meine Weiterlesetips zum Thema ›Borges-artige moderne Phantastik‹ beginnt, und danke allen, die so ausdauernd meiner Schreibe zu folgen Freude bereitet hat, und hoffe, daß mein Geschmack vielleicht als willkommene Orietierung in Sachen ›Qualitäts-Phantastik‹ dienen konnte.
Bis zur nächsten (zweiten) Folge meiner Babel-Reihe, etwa Mitte Juno
Euer Molosovsky / Alex
•••
ALLE WEGE FÜHREN NACH BABEL
Im Lauf der Zeit bin ich immer wieder auf phantastische Lektüren gestoßen, in denen ich entweder vermeinte, den Einfluß von Borges zu spüren, oder die (Zufall) eine sehr Borges-ähnliche Athmosphäre und Stimmung vermitteln. Viele, ach allzuviele Werke könnte ich anführen, denn das postmoderne erzählerische Spiel mit Mythen, fingierten Artefakten und Schriften aus erdachen Welten und andere Eigentümlichkeiten des Werkes von J. L. Borges lassen sich (zumindest für mich) zuhauf finden. Weiter weg vom Gebiet des guten Geschmacks, aber deshalb nicht minder respektabel spekulativ, ist da z.B. so ein SF-Mystik-Horror-Thriller wie »Cube«, oder auch der düster stimmungsvolle »Dark City«. Aber von Filmen sei hier nicht die Rede. Hier aber eine kleine Übersicht meiner entsprechenden literarischen Favoriten.
 In Werk von Helmut Kraussers Werk tummeln immer wieder obskure und unheimliche Doppelgänger durch die Geschichten (z.B. in »Fette Welt« und »UC«) und/oder verlaufen sich die Protagonisten in verstörenden Verknäulungen wahrgewordener und wahrgeglaubter Mythen (z.B. »Melodien«, »Thanatos«). Die mythische Lebendigkeit von Phantastik hat Helmut Krausser wie kaum einer sonst in meiner bisherigen Lebenszeit so schön poetisch auf den Punkt gebracht wie er es in seinem ›Stimmengemenge vom Veteranenstammtisch‹ »Denotation Babel« (1999) tat. Drei Männerstimmen vom Babelturm erzählen in diesem Gedicht z.B. vom ›Seifenopern‹-, ›Groschenheft‹- und ›Räuberpistolen‹-Charakter der alten Phantastikklassiker:
In Werk von Helmut Kraussers Werk tummeln immer wieder obskure und unheimliche Doppelgänger durch die Geschichten (z.B. in »Fette Welt« und »UC«) und/oder verlaufen sich die Protagonisten in verstörenden Verknäulungen wahrgewordener und wahrgeglaubter Mythen (z.B. »Melodien«, »Thanatos«). Die mythische Lebendigkeit von Phantastik hat Helmut Krausser wie kaum einer sonst in meiner bisherigen Lebenszeit so schön poetisch auf den Punkt gebracht wie er es in seinem ›Stimmengemenge vom Veteranenstammtisch‹ »Denotation Babel« (1999) tat. Drei Männerstimmen vom Babelturm erzählen in diesem Gedicht z.B. vom ›Seifenopern‹-, ›Groschenheft‹- und ›Räuberpistolen‹-Charakter der alten Phantastikklassiker:
Unsere Lieblingsmythen hießen:
»Labyrinth des Minotaurus«,
»Kampf um Troja«, »Herakles«
(der Superheld für unsere Kleinen)
»Salomo und seine Frauen«
(der Höhepunkt im Spätpropgramm)
Zehn schöne Jahre haben wir
»Odysseus' schräge Fahrt« verfolgt
und uns beinah bepisst vor Lachen.
Beim »Brand von Sodom und Gomorrah«,
dem Machwerk eines Radikalen,
haben wir uns abgewandt.
Kann sein, daß HelK die Hände überm Kopf zusammenschlägt wenn ich ihn derart mit Borges verknüpfe, und/oder aufgrund meiner flappsigen Lesart als exzellenten Phantasten preise. Aber für mich als Leser sind die thematischen Ähnlichkeiten kaum zu übersehen.
»Denotation Babel« empfehle ich besonders allen, denen z.B. solche dunklen und überernsten Mythos-Werke wie »The Waste Lands« von T.S. Eliot zu steif und humorlos sind.
 Derzeit (ich bin auf Englisch ca. auf S. 200 von über 700) verirre ich mich genüßlich in dem Wunder-, Schauerkammerbuch von Mark Z. Danielewski »House of Leaves«, daß als »Das Haus« im Herbst 2007 bei Klett-Cotta im allgemeinen Programm erscheinen wird. Schön, daß dieses erzphantastische, sprachlich vielstimmig-brilliante Buch von der exquisiten Übersetzerin Christa Schuenke ins Deutsche übertragen wurde. Immerhin hat diese Meisterin schon solche respektablen Klassiker wie John Donne, Jonathan Swift und Herman Melville und moderne Edelfedern wie John Bannville und Robert McLiam Wilson glänzend übersetzt. Beim Lesen der Originalausgabe von »House of Leaves« frug ich mich oft: »Wie kann man das wohl knackig ins Deutsche wuppen?« — Worum gehts? Bisher trau ich mich sagen, daß Danielewksi mit seinem Debutroman ganz klassisch und zugleich auf der Höhe heutigen Romanschreibens einen unheimlichen Großroman abgeliefert hat. Wer die großzügigen ca. 100 Leseprobeseiten von Klett-Cotta überfliegt, merkt anhand der komplizierten Typographie, daß hier mehrere Handlungs- und Erzählebenen miteinander vermengt sind. Da ist der kalifornische Mitzwanziger und Tatooladengehilfe Johnny Turant, der in den Besitz des äußerst merkwürdigen Manuskrips ›Der Navidson Record‹ gelangt. Ein alter, blinder Exzentriker (sic) namens Zampano, hat über Jahre hindurch an diesem Schriftstück gebosselt. ›Der Navidson Record‹ ist eine erschöpfende Analyse über den gleichnamigen fiktiven Film des Dokumentarfilmers Tom Navidson. Der wollte seine wilden Tage hinter sich lassen, mit seiner Familie ein ruhiges Leben in einem alten Landhaus beginnen, und diese neue Phase mit Videokameras dokumentieren. Doch dann entdeckt er einen Durchgang in dem Haus, der sich alles andere als normal verhält. Die räumliche Exzentrik des Hauses wird langsam zu einer bedrohlichen Unheimlichkeit. Wie kann es sein, daß ein Haus von innen größer ist als von außen? Was ist das für ein Wesen, dessen Grollen Tom bei seiner ersten größeren Expedition in diese räumliche Annomalie kalte Panik einjagd? Zampano hat den nüchternen Sachtext der Filmanalyse von Navidson mit Fußnoten versehen, und Johnny Turant befußnotet Zampano und vermerkt dabei seine eigenen unheimlichen Abenteuer, die ihn heimsuchen, seit er das Zampano-Manuskript liest. Im hinteren Teil des Buches finden sich z.T. Fragment gebliebende Anhänge, in denen man mehr über die Buchpläne von Zampano und die Familiengeschichte von Johnny erfährt, und der Wahnsinn des kosmischen Grauens ist niemals weit, steigert sich meisterhaft sachte und ich beginne mich abseits der Lektüre bereits hektisch nach Zeichen der Invasion des Übernatürlichen umzugucken … so gut ist Danielewski. — Blinde Mystiker, fiktive Werke über fiktive Werke und vor allem die prominente Rolle die der mythische Minotaurus spielt, dürften reichen, damit Borges-Freunde bei »Das Haus« aufhorchen. Wenn Borges eine Neigung zur langen Strecke des Romans gehabt und sich in Arno Schmidt'scher Manier für Schriftgestaltungsspielerein begeistert hätte, so wäre ihm womöglich ein Buch gelungen, daß sich wie Zwilling von Danielewskis beeindruckendem Debut ausnimmt.
Derzeit (ich bin auf Englisch ca. auf S. 200 von über 700) verirre ich mich genüßlich in dem Wunder-, Schauerkammerbuch von Mark Z. Danielewski »House of Leaves«, daß als »Das Haus« im Herbst 2007 bei Klett-Cotta im allgemeinen Programm erscheinen wird. Schön, daß dieses erzphantastische, sprachlich vielstimmig-brilliante Buch von der exquisiten Übersetzerin Christa Schuenke ins Deutsche übertragen wurde. Immerhin hat diese Meisterin schon solche respektablen Klassiker wie John Donne, Jonathan Swift und Herman Melville und moderne Edelfedern wie John Bannville und Robert McLiam Wilson glänzend übersetzt. Beim Lesen der Originalausgabe von »House of Leaves« frug ich mich oft: »Wie kann man das wohl knackig ins Deutsche wuppen?« — Worum gehts? Bisher trau ich mich sagen, daß Danielewksi mit seinem Debutroman ganz klassisch und zugleich auf der Höhe heutigen Romanschreibens einen unheimlichen Großroman abgeliefert hat. Wer die großzügigen ca. 100 Leseprobeseiten von Klett-Cotta überfliegt, merkt anhand der komplizierten Typographie, daß hier mehrere Handlungs- und Erzählebenen miteinander vermengt sind. Da ist der kalifornische Mitzwanziger und Tatooladengehilfe Johnny Turant, der in den Besitz des äußerst merkwürdigen Manuskrips ›Der Navidson Record‹ gelangt. Ein alter, blinder Exzentriker (sic) namens Zampano, hat über Jahre hindurch an diesem Schriftstück gebosselt. ›Der Navidson Record‹ ist eine erschöpfende Analyse über den gleichnamigen fiktiven Film des Dokumentarfilmers Tom Navidson. Der wollte seine wilden Tage hinter sich lassen, mit seiner Familie ein ruhiges Leben in einem alten Landhaus beginnen, und diese neue Phase mit Videokameras dokumentieren. Doch dann entdeckt er einen Durchgang in dem Haus, der sich alles andere als normal verhält. Die räumliche Exzentrik des Hauses wird langsam zu einer bedrohlichen Unheimlichkeit. Wie kann es sein, daß ein Haus von innen größer ist als von außen? Was ist das für ein Wesen, dessen Grollen Tom bei seiner ersten größeren Expedition in diese räumliche Annomalie kalte Panik einjagd? Zampano hat den nüchternen Sachtext der Filmanalyse von Navidson mit Fußnoten versehen, und Johnny Turant befußnotet Zampano und vermerkt dabei seine eigenen unheimlichen Abenteuer, die ihn heimsuchen, seit er das Zampano-Manuskript liest. Im hinteren Teil des Buches finden sich z.T. Fragment gebliebende Anhänge, in denen man mehr über die Buchpläne von Zampano und die Familiengeschichte von Johnny erfährt, und der Wahnsinn des kosmischen Grauens ist niemals weit, steigert sich meisterhaft sachte und ich beginne mich abseits der Lektüre bereits hektisch nach Zeichen der Invasion des Übernatürlichen umzugucken … so gut ist Danielewski. — Blinde Mystiker, fiktive Werke über fiktive Werke und vor allem die prominente Rolle die der mythische Minotaurus spielt, dürften reichen, damit Borges-Freunde bei »Das Haus« aufhorchen. Wenn Borges eine Neigung zur langen Strecke des Romans gehabt und sich in Arno Schmidt'scher Manier für Schriftgestaltungsspielerein begeistert hätte, so wäre ihm womöglich ein Buch gelungen, daß sich wie Zwilling von Danielewskis beeindruckendem Debut ausnimmt.- Die frankoberlgischen
Comic-, äh, Graphiknovellen- & Weltenbau-Magier Francois Schuiten (Illus) und Benoit Peeters (Text) bieten üppige Ausflüge in Welten, die in vielerlei Hinsicht an die Borges'sche Phantastik anknüpfen. Die für sich stehenden und auf lockere Weise einen großen Zyklus ergebenden Einzeltitel der Reihe »Les Cities Obscures« (Die Geheimnisvollen Städte) verführen bei uns seit ca. 20 Jahren zu Reisen in eine von Architektur und Bücherwahn geprägte Parallelwelt. {In geschwungenen Klammern und kleiner Schrift stehen die Titel, die ich noch nicht genauer kenne, weil sie zu teuer sind, als daß ich sie meiner Sammlung derzeit einverleiben könnt}.
- In »Der Turm« (Feest Verlag, 1988). S/W mit einigen farbigen Sprengseln. Der Turm ist alt, der Turm ist gigantisch. Weit unten darbt der Instandhalter Giovanni Baptista und ärgert sich. Lange schon bekommt er keine Rohrpost-Nachrichten aus den höheren Gefilden der Turmbauern; seine benachbarten Kollegen sind verschwunden oder gestorben und Giovanni kommt nicht mehr zurande, die bröckelnden Stellen des Turmes auszubessern. Er macht sich auf die Suche nach den Turmbauern, und entdeckt auf seiner Reise durch die Turmwelt, daß die alte Hierarchie kaporres ist.
- »Das Fieber des Stadtplaners« (Feest Verlag, 1989). S/W. Der Urbitekt Eugen Robik ist ein ungeselliger Technokrat, der niemand außer sich selbst für fähig genug hält, die verwinkelte Altstadt von Urbicande zu modernisieren. Doch Robiks Leben gerät völlig aus den Fugen, als er ein mysteriöses Würfelgitter findet, das unaufhaltsam und in unvorhersehbaren Schüben wächst, und schließlich auch das Gefüge von Urbicande selbst völlig durcheinander wirbelt.
- »Die Mauern von Samaris« (Feest Verlag, 1990). Farbig. Franz Bauer wird von den Stadtführen Xhystos in das ferne Samaris geschickt, da keiner der dorthin entsannten Botschafter Rückmeldung gab. Samaris entpuppt sich als unheimliche Kulissenstadt und Franz ist bald nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, was Maskerade ist und was Wirklichkeit.
 {»Der Archivar« (1991). Großer S/W & farbiger Prachtband. Hier ist ein Doppelgänger von Borges selbst die Hauptfigur. Als Archivar will er den Mysterien der Welt der Geheimnisvollen Städte auf den Grund gehen. Hier der entsprechende Eintrag aus dem englischen Obscure Dictionary zu der Reihe (Stegreifübersetzung von Molo):
{»Der Archivar« (1991). Großer S/W & farbiger Prachtband. Hier ist ein Doppelgänger von Borges selbst die Hauptfigur. Als Archivar will er den Mysterien der Welt der Geheimnisvollen Städte auf den Grund gehen. Hier der entsprechende Eintrag aus dem englischen Obscure Dictionary zu der Reihe (Stegreifübersetzung von Molo):
Louis, Isidore. Archivpfleger der Unterabteilung Mythen und Legenden. Verdächtigt historische Unterlagen in Brüssel gestohlen zu haben, entdeckte er zuletzt bei seinen Recherchen einen Übergang in die Geheimnisvolle Welt, wo er in der Stadt Alta-Plana weiterhin seiner Tätigkeit nachgeht. Wir verdanken ihm mehrere Berichte über die Geheimnisvollen Städte. Siehe »Der Archivar«. Körperlich sieht er Borges sehr ähnlich.
}
- »Der Weg nach Armilia« (Feest Verlag, 1992). Farbig. Ohne zuviel verraten zu wollen, hat diese Story über eine Luftschiff-Reise quer durch die Welt der Geheimnisvollen Stadt eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den Cyberpunk-Thema, das z.B. in »Welt am Draht« und »The Matrix« behandelt wird.
- »Brüsel« (Feest Verlag, 1993). Farbig. Hier treten Schuiten & Peeters am deutlichsten als Kritiker des modernen Städtebaus auf, wenn sie in ihrer fiktiven Doppelgängerstadt des realen Brüsel einen einfachen Blumenhändler durch intrigenreichen Gesellschaftswirren stolpern lassen. Inklusive elektrischer Kuren und Bombenlegerinnen. Womöglich der flotteste Band der Reihe.
- {»Das Stadtecho« (1994). Großfarmatiger quasi-dokumentarischer Prachtband mit vielen S/W, Farb und Photoabbildungen.}
- »Mary« (Feest Verlag, 1996). S/W und manipulierte Photographien. Zwei Wege kreuzen sich: In der Welt der Geheimnisvollen Stadt gerät das persönliche Gravitationsfeld der jungen Dame aus bestem Hause, Mary, aus dem Lot, und von da an schräg daherkommend fäll sie aus ihrem Milieu. In unserer Welt findet ein Maler in einer verlassenen Villa einen Übergang in die Welt der Geheimnisvollen Städte.
- »Der Führer zu den Geheimisvollen Städten« (Feest Verlag, 1998). Quasi-enzyklopädisches Nachschlage- und Schmökerbuch mit ausführlichen Städteportraits, Dossiers über Geschichte der Geheimnisvollen Städte-Welt und einigen ihrer berühmten Persönlichkeiten, zu zu denen auch irdische Leute wie Jules Verne und eben J. L. Borges gehören.
- »Der Schattenmann« (Feest Verlag, 2000). Farbig. Albert Chamisso ist ein höherer Manager und verliehrt während einer alptraumdurchfieberten Krankheit seinen Schatten, genauer: er wird durchscheinend. Dieser Band erzählt, was der Gute aus seiner Misere macht.
- »Jenseits der Grenze 1 & 2« (Edition Moderne, 2002-2004). Farbig. Der junge Karthograph Roland von Cremer trifft bei dem kolossalem Kuppelbau der großen karthographischen Zentrums ein. Im Lauf der beiden Bände kommt es zu einer informationstechnischen Revolution und einem Staatenkrieg. Wunderbar wird hier mit dem Borges-Motiv der ›Karte des Reiches im Maßstab 1:1‹ gespielt (naja, nicht ganz 1:1, aber aberwitzig detailierter Maßstab halt).
•••
ANMERKUNGEN:
[01] Nebenbei: Mein Plan ist, jeden Monat einen Band der
»Bibliothek von Babel«-Reihe vorzustellen. Dieses Unterfangen ist mein Versuch, zu zeigen, wie man sich als Blogger aus Begeisterung und Spaß an der Freud einer ›Mission‹ widmet. Ich Danke der Büchergilde für ihre Unterstützung und den Mut, sich auf einen unprofessionellen Daherschreiber wie mich einzulassen. •••
Zurück
[02] Oder wie es der gute
Arno Schmidt knackig umschreibt in einerm seiner unvergleichlichen Radiodialoge. Aus »
Der Titel Aller Titel ! Betrachtungen zu Wilkie Collins
& seiner ‹Frau in Weiß›« (1966), Haffmans 1991, Werkgruppe II, Band 3, S. 271.
Sprecher A {Berichterstatter}: {…} damals mußte ein Autor halt, hell-angestrahlt in Bühnen=Mitte, 2 Menschen=Attrappen hinstellen, die süß=unbeholfen Hand' & Füß' umeinander legen: als Alibi ! Das wirklich=Wichtige aber spielt sich in, beziehungsweise dicht vor der Culisse ab. Sind dort doch angeblich nur Statisten-Comparsen am Werk; zum Teil ausdrücklich als Bösewichtier & =Wichterinnen deklarriert; Denen man ergo einiges — recht Vieles — : viellecht sogar Alles ! ? — verzeihen kann; ohne sich ob der Sympathie mit, der Freude an, ihnen moralisch belastet vorkommen zu müssen.
Sprecher B {Fragen & Einwände} (begreifend): Achso ! — Durch das chemisch gereinigte Haupt-Paar in Vordergrunds Mitten, wird das ‹Über=Ich› des Lesers auf's respektabelste beruhigt; so daß dann im breiten Rahmen=Rankenwerk allerlei Schalkisches vor sich gehen darf : ‹da Wir ja doch nur träumen, kommt's darauf auch nicht an›.
Sprecher A (bestätigend): Ergibt sich der Satz : ‹Im Viktorianischen Roman sind die Neben=Figuren immer die Haupt=Figuren›.
Arno bringt hier etwas auf den Punkt, daß nicht nur für den Viktorianischen Roman, sondern (da diese Epoche den heutigen Publikumsroman bis heute stark prägt) auch für viele viele Mainstream-Narrationen immer noch gilt. Jüngstes mir genehmes Blockbusterbeispiel gibt da die »Piraten der Karibik«-Trio ab. Keira Kneightly und Orlando Bloom geben die sich anhimmelnden Lämmerlein treffend, und bleiben doch für mich nebensächliche flache Figuren, da die eigentlich interessanten Helden die zwielichtigen, irren und monstösen Figuren sind wie Jack Sparrow, Davy Jones, Barbosa & Co. ••• Zurück
[03] »Der Name der Rose«, Hanser, S. 170. •••
Zurück
[04] »25. August 1983«, Büchergilde Gutenberg, S. 98. •••
Zurück
[05] Ursprünglich 1975 beim italienischen Verlag Ricci erschienen. Es dauerte bis 1981 bis der Wagenbach-Verlag eine deutsche Ausgabe veröffentlichte, die aber bald vergriffen war. Nun endlich also, nach 16 langen Jahren kann eine neue Generation diese prächtige Antho-Reihe für sich entdecken. •••
Zurück
[06] Martin Gregor-Dellin (1926-1988): Schriftsteller, Lektor und Herausgeber. Mir zum Beispiel positiv aufgefallen durch seine Antholgien klassischer (Schauer-)Phantastik
»Die Gespenstertruhe« (1964) und
»Das Wachsfigurenkabinett« (1974). •••
Zurück
[07] Aus der Sammlung
»Fiktionen« (1942-1944). •••
Zurück
[08] Quelle: Anmerkung zur Geschichte in
»Fiktionen«, Hrsg. von Gisbert Haefs & Fritz Arnold, Fischer Taschenbuch 1992, S. 179. •••
Zurück
[09] Aus der Sammlung
»Shakespeares Gedächtnis« (1980/83). •••
Zurück
[10] Aus der Sammlung
»Shakespeares Gedächtnis« (1980/83). •••
Zurück
[11] Aus der Sammlung
»Shakespeares Gedächtnis« (1980/83). •••
Zurück
[12] Aus der Sammlung
»Das Sandbuch« (1975). •••
Zurück
Neil Gaiman in Leipzig als Gedächtnisprotokoll mit Skribbels
Eintrag No. 357 — Donnerstag war Neil Gaiman auf der Leipziger Buchmesse, um die deutsche Ausgabe seines neuesten Roman »Anansi Boys« vorzustellen. Hier einige Spökes vom Nachmittagstermin auf dem ›Schwarzen Sofa‹ in Halle 2, und der abendlichen Lesung im Spizz (hab dort gute Bandnudeln mit Riesengarnelen gegessen; angenehmes, lebhaftes Lokal mit Jazz- und Lesungskeller).

Gaiman ist ein Musterknabe was Buchpromotion, bzw. Kontakthalten zu seiner Fan-Base angeht. Üblicherweise geht er dabei so vor: »Zuerst lese ich ein Stück aus meinem neuen Roman, dann spielen wir ›Frage und Antwort‹ – wobei Ihr die Fragen stellt und ich antworte – und schließlich werde ich signieren bis mir die Hand abfällt.« Beim Signieren malt er in jedes Buch andere Kringel und ›dumme Sprüche‹. Für einen Kumpel habe ich ein »Good Omens«-Exemplar mitgenommen: »Sebastian, burn this book – Neil Gaiman« steht nun drin.
Gaiman wollte als Jugendlicher Rockstar werden, und wenn das nicht aufgehen sollte, dann halt Comicautor & Schriftsteller. Zum Rockstar hats nicht gereicht, aber Gaiman gehört zu jenen wenigen Schriftstellern, für den sich seine Zuhörer im anglo-amerikanischen eng in großen Räume zusammendrängen. Das lohnt sich, denn das sanfte, klare Englisch Gaimans ist eine Wonne für die Ohren; er wirkt wie jemand, der eigentlich im Herzen immer noch ein wild vor sich hinfabulierender Bub ist, und so versteht es vorzüglich, selbst die ödesten Dinge irgendwie kurzweilig zu erzählen (z.B. das Hin- und Her um zustande kommende Verfilmungen seiner Drehbücher).
Im folgenden nun ein Gedächtnisprotokoll einiger Frage & Antwort-Ping Pongs vom Leipziger Donnerstag.
 Nachdem Gaiman lange den mit zweifelhafter Ehre behafteten Titel inne hatte, der Autor zu sein, der die meisten noch nicht verfilmten Drehbücher und Lizenzen in Hollywood verkauft hat, kommen nun in kurzer Folge bald drei neue Filme nach Stoffen von Gaiman in die Lichtspielhäuser. Seit gestern ist der Trailer zu »Stardust« online, einer romatischen Abenteuer-Komödie, in der ein junger Mann für seine Liebste einen Kometen holen will, nur entpuppt sich der Komet als junge Dame. Michelle Pfeiffer, Robert de Niro und Claire Danes spielen in dem ab Oktober laufenden Film mit. Bald darauf im November kommt dann der aufwändige CGI-Film »Beowulf« von Robert Zemeckis zu uns, und u.a. zogen sich Angelina Jolie und Anthony Hopkins dafür Motion Capture-Anzüge an und verliehen den Figuren ihre Stimmen. Und nächstes Jahr trumpft dann nach »Nightmare Before Christmas« und »James und der Riesenpfirsich« der exzellente Puppentrickzauberer Henry Selnik auf, mit der Verfilmung des gruseligen Kinderbuches »Coraline«, diesmal mit Musik und Songs von They Might Be Giants.
Nachdem Gaiman lange den mit zweifelhafter Ehre behafteten Titel inne hatte, der Autor zu sein, der die meisten noch nicht verfilmten Drehbücher und Lizenzen in Hollywood verkauft hat, kommen nun in kurzer Folge bald drei neue Filme nach Stoffen von Gaiman in die Lichtspielhäuser. Seit gestern ist der Trailer zu »Stardust« online, einer romatischen Abenteuer-Komödie, in der ein junger Mann für seine Liebste einen Kometen holen will, nur entpuppt sich der Komet als junge Dame. Michelle Pfeiffer, Robert de Niro und Claire Danes spielen in dem ab Oktober laufenden Film mit. Bald darauf im November kommt dann der aufwändige CGI-Film »Beowulf« von Robert Zemeckis zu uns, und u.a. zogen sich Angelina Jolie und Anthony Hopkins dafür Motion Capture-Anzüge an und verliehen den Figuren ihre Stimmen. Und nächstes Jahr trumpft dann nach »Nightmare Before Christmas« und »James und der Riesenpfirsich« der exzellente Puppentrickzauberer Henry Selnik auf, mit der Verfilmung des gruseligen Kinderbuches »Coraline«, diesmal mit Musik und Songs von They Might Be Giants.
Viele Fans der Terry Pratchett und Neil Gaiman-Cooperation »Good Omens« würden sich über eine weitere Zusammenarbeit der beiden freuen, doch lange hieß es: »Nein, Terry ich werden keine Fortsetzung schreiben.« Aber vor einiger Zeit haben sich die zwei nach Langem wieder mal getroffen und sich dabei aus Fadesse auszumalen begonnen, was die »Good Omens«-Protagonisten mittlerweile wohl treiben könnten. Beide haben also schwer Laune darauf, die Abenteuer von Teufel Crowley und Engel Aziraphale weiterzuspinnen. Falls also Terry und Neil mal 3 bis 4 Monate gemeinsame Zeit (im gleichen Land) übrig haben, könnte vielleicht mal eines Tages ect pp ff … was ja besser ist, als »nie«.
An kommenden Projekten steht an…
- …das nächste Kinderbuch: Arbeitstitel »Graveyard« (Friedhof), von dem Neil meint, es sei bisher sein gruseligstes Werk. Ein Baby verliehrt seine Familie und wird von den untoten Einwohnern des naheliegenden Friedhofs großgezogen. Später, als das Kind größer ist, soll der Friedhof einem Bauvorhaben weichen, und die Lebenden entpuppen sich als weitaus furchterrender als die Friedhofstoten. Übrigens: auf der ganzen Welt hätten laut Neil die deutschen Reporter und Rezensenten am meisten Magengrummeln gehabt, mit dem Gruselfaktor von »Coraline«. Was die wohl erst zu »Graveyard« sagen, fragt sich Neil.
- …das nächste Comic: nach »1602« und »Eternals«, die Neil auf Wunsch von Marvel geschrieben hat, möchte er nun lieber als nächstes wieder ein Comic machen, daß auf seinen eigenen Ambitionen beruht.
- …und dann wird am nächsten Roman für Erwachsene gearbeitet. Inhalt noch unbekannt. Neil erzählt, daß er sich vorkommt, wie ein Flugverkehrs-Dirigent. »Am Himmel kreisen mehrere Ideen in der Warteschleife, und die schwierige Aufgabe ist, daß ich mich entscheiden muß, welches dieser vielen Flugzeuge ich als lächstes einer Landebahn zuweise«. Neil wünscht sich, entweder mehr Zeit, oder mehrere Körper zu haben, um all die Projekte durchziehen zu können, die ihn interessieren. Auf die Frage, ob der nächste Roman eine Fortsetzung (z.B. von »Neverwhere«, »Stardust« oder »American Gods«) oder etwas ganz neues wird, antwortete er: »Gewöhnlicherweise, vor die Wahl gestellt, entscheide ich mich dafür, etwas neues zu machen. Falls ich damit dann zu große Schwierigkeiten habe, kann ich immer noch zu bereits bestehenden Stoffen zurückkehren.«
Am Abend im Leipziger Spizz dann eine wirklich schöne Lesung, mit einem hochaufmerksamen Publikum, das an den richtigen Stellen gelacht hat. Abwechselnd lasen Gerd ›The Piano Has Been Dringking‹ Köster und Neil englisch/deutsch aus »Anansi Boys«. Der schüchterne Fat Charlie und sein neu in dessen Leben trudelnder bisher unbekannter Bruder Spider brechen zu Wein, Weib und Gesang auf, um ihren grad verstorbenen Vater zu betrauern. Großen Applaus gabs für Gerd Köster, der wie ich finde, Gaimans Prosa sehr treffend las.
 Die meisten Fragen der abendlichen Lesung drehten sich um Verfilmungen, geplante und geplatzte. Neil erzählt ja gern von seinen Erfahrungen mit Hollywood, einer ganzen Stadt (nicht nur einem Haus, we im »Asterix erobert Rom«-Film), die Leute verrückt macht. Nichts läuft dort so, wie man denkt, und wenn etwas zustande kommt, dann völlig unverhergesehen. Beispiel: Vor einigen Jahren schon, haben Roger Avery und Neil zusammen ein Drehbuch nach der altenglischen Sage »Beowulf« geschrieben, Avery sollte Regie führen, eine Herzensangelegenheit für ihn. Schnell war alles beisammen für Dreamworks mit Robert Zemeckis als Produzenten, das Budget stand, es konnte losgehen, bis ein Anruf von ganz oben den Film kippte. Jahre später nimmt Zemeckis wieder Kontakt mit Neil und Roger auf, und meint, er selbst würde »Beowulf« gerne als CGI-Film machen, das Drehbuch ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf. Neil erzählt: »Das ist ja schön, sagte ich zu Robert, aber Roger träumt schon seit seiner Jugend davon ›Beowulf‹ zu verfilmen. Nu, meint Robert, wir heben Euch einen Heuwagen mit Geld. Okey, sagte ich, ich werde versuchen Roger zu überzeugen. Roger hörte sich das Angebot an und wir teilten dann Robert mit, daß Roger als Regiesseur für ›Beowulf‹ vorgesehen ist, immerhin ist es sein sehnslichster Wunsch usw. Also gut, sagte Robert, zwei Heuwagen mit Geld. Ja, also, meinte Roger darauf, das ist schon sehr verlockend, tja, wenn außer mir jemand den Film machen sollte, dann wärest Du Robert unser erster Wunschkandidat, aber ich möchte doch selber dringend diesen Stoff verfilmen. Robert: Drei Heuwagen. Roger: Okey.«
Die meisten Fragen der abendlichen Lesung drehten sich um Verfilmungen, geplante und geplatzte. Neil erzählt ja gern von seinen Erfahrungen mit Hollywood, einer ganzen Stadt (nicht nur einem Haus, we im »Asterix erobert Rom«-Film), die Leute verrückt macht. Nichts läuft dort so, wie man denkt, und wenn etwas zustande kommt, dann völlig unverhergesehen. Beispiel: Vor einigen Jahren schon, haben Roger Avery und Neil zusammen ein Drehbuch nach der altenglischen Sage »Beowulf« geschrieben, Avery sollte Regie führen, eine Herzensangelegenheit für ihn. Schnell war alles beisammen für Dreamworks mit Robert Zemeckis als Produzenten, das Budget stand, es konnte losgehen, bis ein Anruf von ganz oben den Film kippte. Jahre später nimmt Zemeckis wieder Kontakt mit Neil und Roger auf, und meint, er selbst würde »Beowulf« gerne als CGI-Film machen, das Drehbuch ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf. Neil erzählt: »Das ist ja schön, sagte ich zu Robert, aber Roger träumt schon seit seiner Jugend davon ›Beowulf‹ zu verfilmen. Nu, meint Robert, wir heben Euch einen Heuwagen mit Geld. Okey, sagte ich, ich werde versuchen Roger zu überzeugen. Roger hörte sich das Angebot an und wir teilten dann Robert mit, daß Roger als Regiesseur für ›Beowulf‹ vorgesehen ist, immerhin ist es sein sehnslichster Wunsch usw. Also gut, sagte Robert, zwei Heuwagen mit Geld. Ja, also, meinte Roger darauf, das ist schon sehr verlockend, tja, wenn außer mir jemand den Film machen sollte, dann wärest Du Robert unser erster Wunschkandidat, aber ich möchte doch selber dringend diesen Stoff verfilmen. Robert: Drei Heuwagen. Roger: Okey.«
Eine Leserin, die »Neverwhere« drei mal angangen mußte, bis sie hineinfand und den Roman dann mit großem Genuß fertiglas, fragte, wann Neil ein Buch aufgibt und weglegt. Tatsächlich hat Neil erst spät gelernt, schwache Bücher abzubrechen. Er hat sich immer vorgestellt, daß ein strenger Engel, der zugleich Bibliothekar ist, eine Liste führt, und einen bösen Vermerk einträgt, wenn Neil ein Buch nicht brav fertigliest. Dann aber, 1991 oder so, war Neil einer der Juroren für den Arthur C. Clarke-Award und mußte deshalb alle in diesem Jahr in England erschienenen neuen SF-Bücher lesen. Da hat er dann gelernt, Bücher wegzulegen, nein, sogar lustvoll in die Ecke zu pfeffern. »Ein Buch das nach dem ersten Kapitel nicht in die Pötte gekommen ist, wird wohl auch nicht mehr viel besser werden.«
Pflichtfrage, da Neil in Leipzig weilt: Ob er schon mal was von Goethe gelesen habe. »Oh ja«, sagt Neil. »Aber nicht etwa, weil ich mir Goethe speziell vorgenommen hätte, sondern weil ich ein inniger Bewunderer des irischen Illustrators Harry Clark bin, und eben rauskriegen wollte, worum es im »Faust« vom Goethe geht, den Clark so wunderschön bebildert hat.«
Meine Frage schließlich bezog sich auf Neils Praxis, seine Erstentwürfe händisch in Blanko-Kladden zu schreiben. Ganz früher hat Neil mit Schreibmaschine gearbeitet, und manchmal Probleme damit gehabt, schöne weiße Papierbögen zu zerstören, indem er sie mit Buchstaben volltippte. Als Neil auf Textverarbeitung umstieg, fand es gar nicht mehr problemtisch auf dem Computer zu schreiben, denn da werden ja nur so Elektronen herumgeschubst. Aber, irgendwann machte es Neil zu schaffen, daß es auf einem Computer keine richtigen Schritte mehr zwischen der ersten und der letzten Fassung mehr gibt, sondern er an einer sich ständig wandelnden x-ten Fassung rumfuhrwerkte. Außerdem fand er es bedrückend, den schönen weißen Bildschirm zu zerstören. So sei er also wieder zum Schreiben mit der Hand zurückgekehrt, was den nicht zu unterschätzenden Vorteil mit sich brachte, daß in einer Kladde keine iChat-Fenster aufgehen, oder Links von Freunden 20 superinteressante und von der Arbeit ablenkende Websites aufpoppen lassen.
Hat Spaß gemacht, mal Fan zu spielen und einem verehrtern Künstler entgegenzureisen. Idolen zu begegnen endet ja schnell mal als Enttäuschung. Neil Gaiman aber bestätigte und stärkte den Zauber, den er aus der Ferne schon seit über 10 Jahren nur mit Worten auf mich wirkt.
Gaiman, Neil: »Anansi Boys«, oder: ›Die spinnen, die Götter‹ (für MAGIRA 2006).
•••
 Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt (mehr über den Leipzig-Besuch von Gaiman in meinem Gedächtnisprotokoll mit Skribbel). Wer Gaiman schon kennt, kann sich als entsprechend Informierter den nächsten Absatz sparen.
Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt (mehr über den Leipzig-Besuch von Gaiman in meinem Gedächtnisprotokoll mit Skribbel). Wer Gaiman schon kennt, kann sich als entsprechend Informierter den nächsten Absatz sparen.
Gaiman gehört zu den britischen Aufsteigern der Neunziger, und hat seine Laufbahn mit Büchern über Duran Duran und Douglas Adams’ »Per Anhalter durch die Galaxis«-Reihe begonnen. Mit Graphic Novels wie »Violent Cases« und »Black Orchid« erlangte er Ansehen als Comic-Autor, was ihm die Gelegenheit verschaffte, die große Geschichte »The Sandman« in 75 (fast immer) monatlichen Heften von 1988 bis 1995 zu erzählen. Die Saga über den Abstieg und die Wiedergeburt des Herrschers der Traumlande machte Gaiman zum Star einer Phantastik-Gemeinde, die es zu schätzen weiß, wenn Religionen und Mythen aller möglichen Epochen und Weltgegenden vermischt werden und mit einer gewitzten Sensibilität für moderne Fantasy- bzw. urbane Horrorgeschichten, gewürzt mit einer kräftigen Prise guter alter Familien-Soap, erzählt werden. »The Sandman« gilt vielen Lesern immer noch als Gaimans bisher bester Brocken. Mit ein bisschen Übertreibung kann man behaupten, dass seitdem Gaiman sozusagen in den Kult-Rang eines zeitgenössischen Ovids aufgestiegen ist, sein Publikum gebannt seinen Variationen über die Metamorphosen von Wesen, Zeitläuften und Welt lauscht. So kennen ihn Terry Pratchett-Leser als Co-Autor apokalyptischer Komik (»Good Omens«), Art-Book-Fans als Wiederbeleber der Tradition des (in diesem Fall von Charles Vess) aufwändigst illustrierten Märchenbuches für Erwachsene (»Stardust«). Gaiman hat im Fernsehen z.B. in der SF-Serie Babylon 5 (»Day of the Dead«) und als Schöpfer einer BBC-London-Fantasia (»Neverwhere«) seine Geschichten erzählt. Als Mit-Entdecker und Übersetzer von »Prinzessin Mononoke« für den englischsprachigen Markt glänzte er als Vermittler. Derzeit steigt Gaiman in die narrativ-industrielle A-Liga auf, nachdem er jahrelang den Titel innehatte, die meisten nichtverfilmten Drehbücher in Hollywood verkauft zu haben: innerhalb der nächsten 18 Monate laufen »Beowulf« (der nächsten starbepackten CGI-Flick von Robert Zemeckis), »Stardust« (mit der Pfeiffer und dem de Niro) und »Coraline« (von Meister Selnik, dem »Nightmare Before Christmas«-Puppentrickser) an. Getrost kann man auch alle Früchte der Zusammenarbeit Gaimans mit seinem bildnerischen Kumpel und »The Sandman«-Covermagier Dave McKean als echte Phantastik-Gemmen werten. Dazu zählen neben den oben erwähnten frühen Graphic Novels auch die ›graphischen Erzählungen‹ für Erwachsene »Signal To Noise«, »Mr. Punch«, die Kinderbücher »The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish« und »Coraline«, sowie jüngst das extravagante Film-/Bildband-Projekt »Mirrormask«.
Laut Autorenbio des Klappentextes hat Neil Gaiman »Anansi Boys« ganz speziell ›für dich‹ geschrieben, was ja schon mal ein nette Geste ist. Respektvoll verneigt sich der Autor dann im Postskriptum seiner Danksagungen vor vier Autorengeistern, und zeichnet damit erste Konturen der Ambitionen und Themen des Romans (kursiv sind die entsprechenden Narrations-Harmonien markiert, die sich in Anansi Boys vernehmen lassen):
- P.G. Wodehouse mit seinen Geschichten vom wohlhabenden aber planlosen Junggesellen Bertie Wooster und dessen fähigem aber trockenen Butler Jeeves[1] ist ein Klassiker der britischen Gesellschaftskomödie, und sein Einfluss liefert Konversations- und Peinlichkeits-Humor;
- ›Tex‹ Avery war ein Genie des höheren Zeichentrick-Blödsinns und hat z.B. Bugs Bunny und Duffy Duck erfunden, ewiges Vorbild für wilden Slapstick mit phantastischen Unmöglichkeiten;
- von Thorne Smith stammt die Vorlage für den Filmklassiker »I Married a Witch« und auch bei Gaiman geht’s um Ehen bzw. städtisch-moderne Romanzen zwischen normalen Sterblichen und magischen Überwesen;
- Zora Neale Hurston veröffentlichte eine Reihe Bücher über afro-karibische Mythologie, und der titelgebende Spinnengott Anansi stammt aus Westafrika.[2]
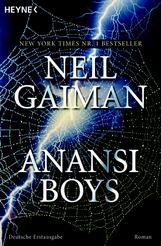 Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.
Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.
Die Geschichte beginnt mit einer Eröffnung über die Macht der Lieder und die Song-haftigkeit der Welt. Schon mal sehr schön, dieses klassische Fantasy-Motiv von der Welt oder dem individuellen Leben als Musik hier neu verhandelt zu finden.[3] Ein willkommenes Gegengewicht in einer Zeit, da die visuellen Medien ja vielbeklagterweise dominieren.
Der Rest des ersten Kapitels dreht sich um Verwandtschaft und Spitznamen. Die Hauptfigur Charlie Nancy ist ein schüchterner ›Jedermann der Moderne‹. Leicht nervös zu machen und deshalb ungeschickt, zurückhaltend und sich schnell mal schämend. Nicht gerade die klassischen Eigenschaften eines tatkräftigen Helden oder eines düsteren Antihelden. Obwohl er schon lange kein Dickerchen mehr ist, blieb der von Papa verliehene Spitz-name ›Fat‹ an Charlie hängen. Mit seiner schalkhaften und fidelen Art und Weise bescherte der Vater Fat Charlies Kindheit und Jugend so manches blamable Fettnäpfchenbad. Nach dem Tod der Mutter zerfällt die Familie und später siedelt Fat Charlie von Amerika nach London. Da sitzt er nun mit seiner Verlobten Rosie – die mit dem Sex erst nach der Trauung loslegen möchte – und plant die Hochzeit. Rosie und ihre verwitwete Mutter sind dabei die entscheidenden Planer, und so will Fat Charlie auf Rosies Vorschlag hin nach langer Zeit wieder Kontakt mit seinem Vater aufnehmen. Doch statt eine Hochzeiteinladung aussprechen zu können, erfährt Charlie telephonisch von seiner alten Nachbarin vom plötzlichen Tod des Vaters. Wie ein Gedankenspiel Gaimans für den Beginn einer »Six Feet Under«-Folge nimmt sich das aus[4]: Papa Anansi purzelt bei einem Karoke-Abend mit Hetzattacke von der Bühne. Fat Charlie fliegt also nach Florida, um seinen Vater unter die Erde zu bringen und lernt dabei von drei ›netten‹ Voodoo-Damen aus der ehemaligen Nachbarschaft, dass Papa Nancy der Spinnengott Anansi war, und dass Fat Charlie einen Bruder namens Spider hat.
—Alles Humbug, denkt sich Fat Charlie, kann aber der Versuchung, seinen unbekannten Bruder kennenzulernen, nicht wiederstehen, und so bittet er – wie es ihm die ›Nornen‹ gesagt haben – eine kleine Spinne, seinem Bruder Bescheid zu geben. Mit Spiders Auftauchen in London beginnt der Roman, seine wilden Slapstick-Unmöglichkeiten gekonnt auszuspielen. Spider hat im Gegensatz zu Fat Charlie die übernatürlichen Fähigkeiten von Papa Anansi geerbt und übernimmt mit ihnen Stück für Stück Fat Charlies Leben. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Grahame Coats, Charlies Boss in einer Promi-Agentur, will seinen gutmütigen Angestellten als Sündenbock missbrauchen. Coats hat nämlich jahrelang Geld seiner Klienten abgezweigt und in ein karibisches Insel-Steuerparadies verschoben, dann im Affekt auch noch die Kundin Meave ermordet und ihre Leiche im Geheimsafe seines Büros zurückgelassen. Das ruft die perfektionistisch-zielstrebige Ermittlerin Daisy von Scotland Yards Betrugsabteilung auf die Erzählbühne. Fat Charlie und die Geschichte pendeln nun zwischen London und Florida, bevor sie nach vielen überraschenden Wendungen in ein ungewöhnliches Gesangsfinale auf der Insel St. Andrews mündet.
Fat Charlie hat heftig zu ringen: mit seinen grollenden beschämten Gefühlen gegenüber dem Hallodri-Vater und dessen ›Erbe‹; mit Spider um die Souveränität über sein Leben; mit Rosie um die Beziehung; mit Daisy um seine juristische Unschuld; aber vor allem auf der großen Metaphernebene mit Grahame Coats selbst. Wie so oft bei Gaiman, garnieren auch diesmal wieder kleine in sich abgerundete Geschichten den großen Bogen des Romanverlaufs. Zum Beispiel die Episode, in der Anansi einmal seine tote Großmutter verhökern wollte, oder die von Anansis Tod im Bohnenfeld. Mit von der Partie sind dabei auch andere Tiergottheiten, und Grahame Coats entpuppt sich als ein Avatar-Gefäß von Tiger, dem ewigen Gegenspieler von Anansi. Es ist ein archetypischer Kampf zwischen Schläger und Trickser, zwischen den rigiden Kriegerüberlebensmythen der Jäger und Sammler und den geselligkeits- und kulturfördernden Leichtsinnskräften von Wein, Weib und Gesang, den, wie Spider mal zu Fat Charlie sagt, einzigen drei Dingen, die den Schmerz der Sterblichkeit und die Wirrheiten des Lebens mildern können.
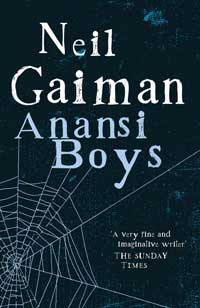 Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.[5] Zudem erfährt der Leser in einem Interview etwas über Neils Lieblingsgötter, seine Meinung zu Spinnen, Karaoke, Spitznamen und peinliche Familientreffen. Glanzstück ist aber der Abdruck einer gestrichenen Szene, die aus Tempogründen entfiel, aber dermaßen feine ›spinnerte‹ Abenteuer von Spider bietet, dass es wahrlich eine Schande gewesen ist, sie dem deutschen Publikum vorzuenthalten. Als letztes gibt es acht Fragen für Lesezirkel, und ich kann nicht anders, als über das Niveau an Textbeschäftigung, dass diese Fragen postulieren, zu staunen.
Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.[5] Zudem erfährt der Leser in einem Interview etwas über Neils Lieblingsgötter, seine Meinung zu Spinnen, Karaoke, Spitznamen und peinliche Familientreffen. Glanzstück ist aber der Abdruck einer gestrichenen Szene, die aus Tempogründen entfiel, aber dermaßen feine ›spinnerte‹ Abenteuer von Spider bietet, dass es wahrlich eine Schande gewesen ist, sie dem deutschen Publikum vorzuenthalten. Als letztes gibt es acht Fragen für Lesezirkel, und ich kann nicht anders, als über das Niveau an Textbeschäftigung, dass diese Fragen postulieren, zu staunen.
Ich freue mich besonders, dass der Übersetzer Karsten Singelmann diesmal den trocken-witzig-poetischen Grundton Gaimans besser getroffen hat, nachdem ihm dies bei »American Gods« und dritten bei »Neverwhere« nicht unbedingt zufriedenstellend gelungen ist[6]. Immerhin gehört zur unverwechselbaren Kunst Gaimans, weitestgehend mühe- und schartenlos zwischen poetischerer Sprache bei den mythisch-magischen Passagen und schnörkel-losen Erzählen bei den Ereignissen der Gegenwartshandlung zu wechseln.
»Anansi Boys« ist Gaimans bisher flottester Roman, gradlinig und abwechslungsreich. Viele Fantasy-Phantastik-Leser, die anspruchsvolle und dennoch ›leicht zugängliche‹ Unterhaltung mögen, wissen Gaimans Romane (und Comics) sowieso zu schätzen. »Anansi Boys« sei deshalb speziell allen, die noch nichts von Neil Gaiman kennen, als guter Einstieg in die Welten dieses inspirierenden Mythenmixers empfohlen.
•••
[1] Nebenbei: Als phantastische (
›Low Fantasy‹) Neuauflage dieser sehr englischen Herr/Diener-Konstel-lation läßt sich der plappernde Wallace und sein Retter aus allen Notlagen-Hund Gromit lesen.
••• ZURÜCK
[2] Fast möcht ich meinen, daß Gaiman mit seinem neuesten Buch auf das Debüt
»King Rat« von China Miéville reagiert, in dem Anansi neben dem König der Ratten und einem Vogelgott gegen den verführerischen Flötenspieler der Hamel-Legende kämpfen. Auf Deutsch finden sich Anansi-Geschichten z.B. in
»Westarfikanische Märchen«, Hrsg. von Kurt Schier und Felix Karlinger (Diederichs, 1975) und in
»Afrikanische Märchen«, Hrsg. von Friedrich Becker (Fischer Taschenbuch, 1969).
••• ZURÜCK
[3] Mythologisch z.B. anzufinden von den antiken Welt- oder Sphärenharmonien über vedische Weltschöpfungslieder bis hin zu vom Weg abbringenden Sirenengesängen. Gaiman selbst greift schon in
»The Sandman« mit einem Handlungsstrang um Orpheus dieses ›Sein als Musik‹-Motiv auf, das sich auch bei Meistersängerkriegen und Rattenfängern findet. Für Fantasy-Leser
›klassisch‹ ist der musiklaische Schöpfungsmythos Mittelerdes bei J. R. R. Tolkien; Alan Dean Forsters
»Bannsänger«-Reihe trägt die magische Musik bereits im Titel; in Tad Williams
»Der Blumenkrieg« soll im Finale ein irdischer Sänger als melodische Bombe scharfgemacht werden; China Miéville variiert die Figur des verführenden Musikers in
»King Rat« mit einer originellen Kulmination aus Flötenspiel und Drum & Base; umfassend und vielschichtig wird das Motiv der zauberhaften Musik und der Rangeleien um ihre Geheimnisse in Helmut Kraussers historisch-phantastischem Roman
»Melodien« aufbereitet.
••• ZURÜCK
[4] Jede Folge dieser seit 2002 laufenden HBO-Serie beginnt mit einem Todesfall, mal tragisch, mal friedlich, mal grotesk, oder wie auch hier bei Gaiman fröhlich-komisch. In dieser Serie über ein familiäres Bestattungsunternehmen werden ansatzlos die Träume, Angst- und Wunschvorstellungen der handelnden Figuren visualisiert.
›Leider‹ sind diese individuellen Welten in die materielle Echtweltwirklichkeit einge-bettet. Dabei nutzt
»Six Feet Under« durchaus phantastische Erzählmittel, überschreitet jedoch nie die Grenze zur
›reinen‹ (High) Fantasy. Dennoch: schön wird hier gezeigt, wie jeder Mensch eigentlich in seiner eigenen Phantasiewelt lebt, und wie die Hinterbliebenen mit den Verstorbenen Zwiesprache galten.
••• ZURÜCK
[5] Harmloser Stoff für kuriosen und harmlosen Lokalpatriotismus: Das Blankobuch der Erstniederschrift hat Gaiman während seines Aufenthalts beim Göttinger Literaturfestival gekauft.
••• ZURÜCK
[6]Ich danke dem BibPhant-Haberer Gero für den Hinweis, daß Karsten Singelmann schon »American Gods« übersetzt hat. Der Mann hat sich seitdem verbessert.
••• ZURÜCK
Fantasy-Boom: »Die Welt« sagt ›Wirklichkeitsflucht‹, ich sag ›Mögklichkeitssinn-Mukkibude‹
(Eintrag No. 354; Woanders, Phantastik, Genre, Gesellschaft, Buchmesse) — Habe im literaturwelt-Blog auf einen Leipziger Buchmesse 2007 Vorfeld-Artikel von der »Die Welt« zum Fantasy-Boom reagiert.

Das ist der Herr Werner. Der darf (für Geld) über Literatur seine Meinung öffentlich verbreiten.
Molosovskys Literatur-Würfel
Eintrag No. 332 — Mir z.B. cartesianische Systeme über mögliche Literatur-Räume zu basteln, macht mir ziemlichen Spaß.
Folgendes hab ich mal angedacht, um generelle inhaltliche, stilistische Eigenarten von Texten darzustellen:

- —Harmonisch (Einklang, narrativ gesehen: Plausibel, angenehm, wohlklingend)
—Disharmonisch (›Missklang‹, narrativ gesehen: Verrückt, unangenehm, unbehaglich klingend);
- —Homophon (vertikale Ausrichtung mit Melodie oben auf, Rest begleitet drunter gefügt; narrativ gesagt ›Spannungsliteratur‹)
—Polyphon (horizontale Ausrichtung mit mehreren selbstständigen Stimmen, narrativ ›Facettenliteratur‹);
- —Objektiv (Orientiert sich ›Weltenbau-mäßig‹ an möglichst allgemeinen, gültigen ›realistischen‹ Konventionen)
—Subjektiv (Spiegelt das Weltverständnis- Empfinden von kleineren Gruppen oder Einzelnen wieder).
Es gibt natürlich noch eine große Menge weiterer Gegensatzpaare, die man eigentlich ganz fein zu solchen Koordinatenknäul zusammenknüpfen könnte. Die Art wie Raum (stationär oder mobil) , Zeit (linear oder nonlinear) und Körperlichkeit (Herr/Lust oder Sklave/Leid) behandelt werden.
•••
Dank an M. im BibPhant-Forum für die Anregung.
Molos Gastauftritt im »Arkadien« von Niebelschütz und »Raben«-Übersicht
Eintrag No. 329 — Anläßlich des BibPhant Buchzitateraten habe ich nach langer Zeit mal wieder im Wolf von Niebelschütz seiner respektlosen Epistel »Auch ich in Arkadien« (Haffmans Verlag, 1987) geblättert und fand auf S. 60 meinen Nickname, noch dazu in einem begeisterungsstiftenden Zusammenhang:
Vom Molo nahten neue Sensationen,
Umspühlt von neuen Massen, und es waren
Wildfremde Leute schrankenlos bereit,
Den nächsten besten hominem sapientem —
So etwa uns — an ihre brust zu ziehen.
Zwei Bezüglichkeiten auf Molo in Helmut Kraussers Tagebüchern, und nun das. Weiß gar nicht mehr wohin mit mir vor lauter Größenwahn!
•••
Und gerade im Netz entdeckt: Martin Juckers feine Übersicht der 62 (+) »Raben«, dem Magazin für jede Art von Literatur, das von 1982 bis 2001 erschien, mit dem ich ausgewachsen bin; das mit-hauptverantwortlich ist für meinen Literatur-Geschmack; das ich so schmerzlich vermisse.
Deutschsprachige Leser frugen, China Miéville hat geantwortet
Eintrag Nr. 328 — Letztes Jahr im Oktober haben die Haberer von Seblons großartiger China Miéville-Bas Lag-Site Interviewfragen gesammelt. Mein großes Idol der zeitgenössischen Phantastik hat sich unserer 33 Fragen mit bewunderswerter Geduld angenommen.

Was gibt es Neues? Es geht…
- …um den springenden Punkt aller Phantastik;
- … um das Kreuz mit der Rezeption homosexueller Protagonisten;
- … um Chinas Begeisterung für Walter Moers »Die 131/2 Leben des Käpt’n Blaubär«;
- … um die derzeitigen Epochenspannungen zwischen sekularen und religiösen Weltbild-Facaden;
- … um den Wohlklang von ›Blitzbaum‹ und ›Luftgeist‹;
- …um die vermeintliche Radikali- & Originalität der Techniken literarischer Postmoderne…
… und vieles andere mehr. — Was mich besonders freut: China ließ sich von uns zu neuen Literaturempfehlungen ermuntern.
Alle, die sich ganz allgemein (es geht immerhin auch um Berthold Brecht!) oder besonders als Phantasten für relevant-engagierte und ideensprühende Literatur interessieren, und die Miévilles Werke noch nicht kennen, können sich also hier im »Großen Bas-Lag-Forum-Interview« einen ersten Eindruck über diesen erstklassigen Autoren verschaffen.
Großen Dank und ›Hut ab‹ für Seblon, daß Du trotz Roboti und Klausurenstress die Zeit und Kraft für all die Orga & Fizzelei aufbringst!
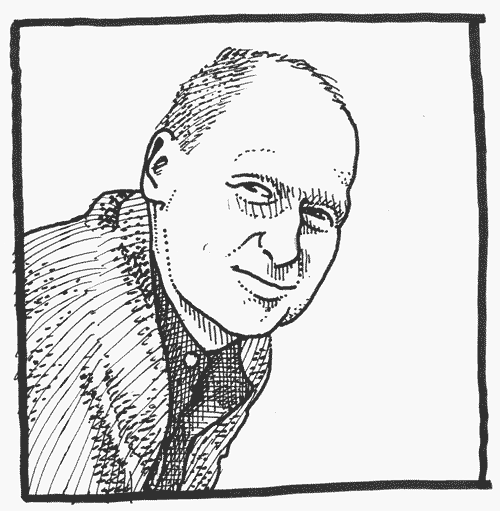 2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.
2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.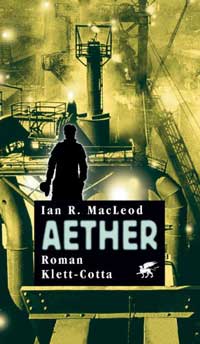 Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.
Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.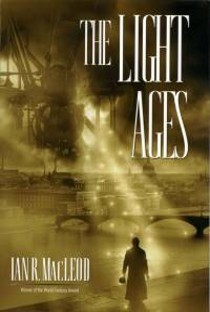 Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.
Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.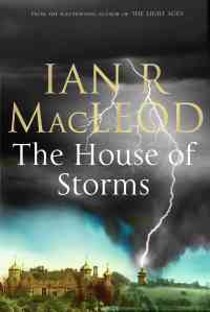 NACHTRAG, Mai 2007:
NACHTRAG, Mai 2007: Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹
Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹ Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.
Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.

 Zwar sind mir keine Stellungnahmen von Borges zu Ecos »Der Name der Rose« bekannt, aber ich stelle mir gerne vor, daß der alte Borges seine stille Freude daran hatte, wie Eco ihn in der Figur des Jorge von Burgos liebevoll ›negativ portraitierte‹.
Zwar sind mir keine Stellungnahmen von Borges zu Ecos »Der Name der Rose« bekannt, aber ich stelle mir gerne vor, daß der alte Borges seine stille Freude daran hatte, wie Eco ihn in der Figur des Jorge von Burgos liebevoll ›negativ portraitierte‹.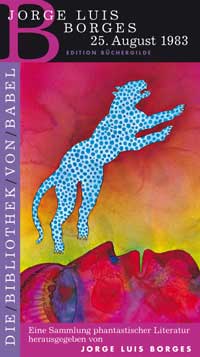

 In Werk von Helmut Kraussers Werk tummeln immer wieder obskure und unheimliche Doppelgänger durch die Geschichten (z.B. in
In Werk von Helmut Kraussers Werk tummeln immer wieder obskure und unheimliche Doppelgänger durch die Geschichten (z.B. in 




 Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt
Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt 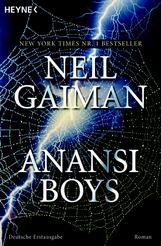 Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.
Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.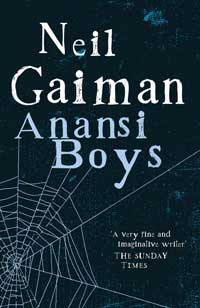 Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.
Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.

