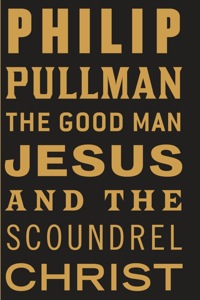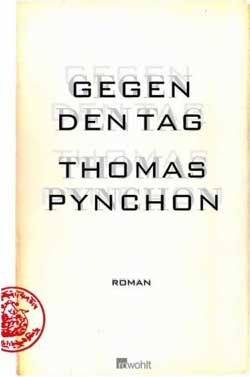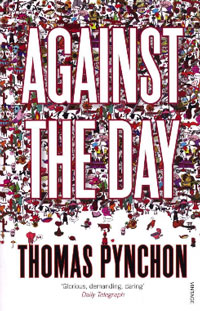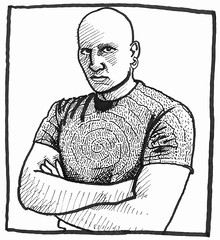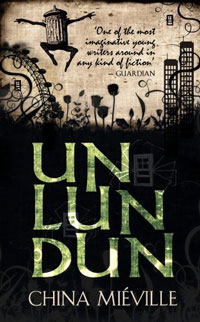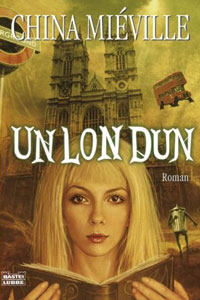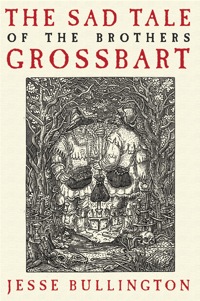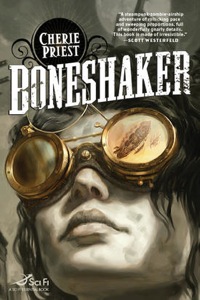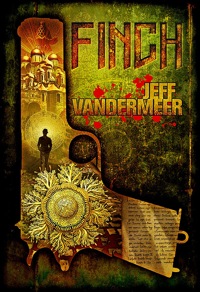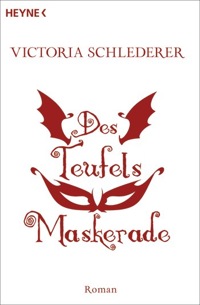Mark Z. Danielewski: »Das Haus – House of Leaves« oder: HausBuch/BuchHaus frisst seine Leser, nee andersrum, oder?
•••
 Eintrag No. 652 — Vor zwei Jahren habe ich von meinem Entzücken über die mannigfaltigen Mimikri- und Formenspielereien berichtet, die Jeff Vandermeer in seinem seltsamen Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« veranstaltet. Als jemand, der sich in zupass kommenden Musen-Stimmung sehr gern auf derartig verknobelte Verkleidungs- und Verschachtelungsgrillen einlässt, befriedigt es mich außerordentlich, mit welch großer Aufmerksamkeit (und oft auch mit welch ansteckenden Elan und/oder erhellendem Geschick) sich in den verschiedensten Medien Mark Z. Danielelwskis (*1966) monströsem »Das Haus« gewidmet wurde. Das ist um so erstaunlicher, da dieses Buch seinen Lesern äußerst fiese hermeneutische Spanische Stiefel umschnallt. Mit fortlaufender Lektüre wird der ›Schmerz‹ den Verwirrung und Undurchdringlichkeit zeitigen immer heftiger, und bescherte zumindest mir wonnigliches Ungemach. Ja, eine Zeit lang habe ich »Das Haus« pausieren lassen, da es mir Alpträume und Anflüge von Beklemmung bereitete (was aber meinerseits nicht zu Abneigung gegenüber dem Buch führte, sondern im Gegenteil, meinen Respekt und meine Wertschätzung für Danielewskis Schreibmacht weiter steigerte).
Eintrag No. 652 — Vor zwei Jahren habe ich von meinem Entzücken über die mannigfaltigen Mimikri- und Formenspielereien berichtet, die Jeff Vandermeer in seinem seltsamen Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« veranstaltet. Als jemand, der sich in zupass kommenden Musen-Stimmung sehr gern auf derartig verknobelte Verkleidungs- und Verschachtelungsgrillen einlässt, befriedigt es mich außerordentlich, mit welch großer Aufmerksamkeit (und oft auch mit welch ansteckenden Elan und/oder erhellendem Geschick) sich in den verschiedensten Medien Mark Z. Danielelwskis (*1966) monströsem »Das Haus« gewidmet wurde. Das ist um so erstaunlicher, da dieses Buch seinen Lesern äußerst fiese hermeneutische Spanische Stiefel umschnallt. Mit fortlaufender Lektüre wird der ›Schmerz‹ den Verwirrung und Undurchdringlichkeit zeitigen immer heftiger, und bescherte zumindest mir wonnigliches Ungemach. Ja, eine Zeit lang habe ich »Das Haus« pausieren lassen, da es mir Alpträume und Anflüge von Beklemmung bereitete (was aber meinerseits nicht zu Abneigung gegenüber dem Buch führte, sondern im Gegenteil, meinen Respekt und meine Wertschätzung für Danielewskis Schreibmacht weiter steigerte).
Nun, seit ich den Brocken einmal erklommen habe, rumort dessen Nachwirkung bis heute in mir weiter: Wie ernst soll ich diesen ausgeklügelten Irrwitz nehmen? Ist »Das Haus« lediglich ein elaborierter, unheimlicher Jux? Warum schaffte es dieses Teil trotzdem, mich so nachhaltig zu beunruhigen? Solche Resummee-Unsicherheiten kann man auf zweierlei Wiese vermeiden: zum einen natürlich schlicht, indem man die Finger von solchen Zumutung lässt und einen großen Bogen um das »Das Haus« macht. Nicht umsonst lautet das erste Empfangs-Motto »Dies ist nicht für Dich«. Wer dennoch frohen Mutes der Meinung ist, dass »Das Haus« etwas für ihn sei, der kann (und sollte) sich auf heftige emotionelle und intellektuelle Wechselfälle einstellen, und vielleicht wird ihm oder ihr dann auch das sehr seltene Schmökerabenteuer zuteil, dass gerade die zunehmende Verunsicherung einen Reiz liefern kann, die mit (in Ermangelung eines besseren Ausdrucks) besinnlich-verstörendem Leseglück vergolten wird.
 Das Buchlabyrinth beginnt mit einer Einleitung aus dem Jahre 1998 von Johnny Turant, einem kalifornischem Tunichgut-Twen der in einem Tattoo-Shop Hilfstätigkeiten verrichtet, kreuzunglücklich in eine ältere Stripperin verknallt ist, und ansonsten mit seinem Kumpel Lude sauf- und auch sonst drogenfreudig durch die Kneipen der Stadt zieht und glücklosen sexuellen Eskapaden nachgeht. Das (für mich) große Hauptthema stimmt bereits der erste Satz an, in dem Johnny schreibt, dass er immer noch Alpträume bekommt. Wovon? — Also: kurz nachdem er von seinem Vermieter rausgeworfen wurde, vermittelt ihm Lude in seinem Mietshaus eine freigewordene Wohnung. Ein exzentrischer alter Mann, ein Katzenopa, ist dort gestorben, und in der nun von Johnny bezogenen Bude dieses Herrn Zampano findet sich eine Kiste mit einem ungeordneten Konvolut unterschiedlichster Manuskriptseiten und Notizen. Johnny macht sich daran, diese Papiere zu sortieren und das Ergebnis bildet den Hauptteil von »Das Haus«, ein Großessay mit dem Titel »The Navidson Record«. Dreiundzwanzig Kapitel umfasst dieses seltsame, über und über mit Fußnoten gespickte Manuskript. Zampano schreibt darin in sehr sachlicher, analytischer und unaffektiver Sprache über den Meisterphotograph Will Navidson, seine Frau Karen Green (ein Ex-Model) und deren beiden Kinder Chad und Daisy[01]. Will hat für seine Photoreportagen über Expeditionen in die Wildnis und in Krisen- und Kriegsgebiete Publizer-Preis-Ruhm einstreichen können, doch nun soll Schluss sein mit gefährlichen Touren. Um die durch Wills oftmalige räumliche Ferne abgekühlte Ehe und die Eltern-Kind-Harmonie zu fördern, ziehen die Navidsons in ein abseits stehendes Haus in der ländlichen Provinz von Virginia. Immer noch ganz Dokumentarjunkie, installiert Will zig Videokameras um in Big Brother-Container-Manier das neue Lebenskapitel einzufangen, um festzuhalten, wie Menschen sich eine neue Umgebung aneignen. Doch ein kosmischer Schrecken von buchstäblich unfassbaren Ausmaßen ist dem Haus, das sie bezogen haben, eigen. Ganz langsam und sachte zieht Danielewski die Unheimlichkeitszwingen fester. Zuerst befindet sich plötzlich in einem Wandschrank eine weitere Tür ins benachbarte Kinderzimmer. Bald darauf stellt sich nach mehrmaligen Vermessen heraus, dass das Haus Innen um einige Inch größer ist als Außen. Bald darauf sind es nicht nur marginale Größenunterschiede, sondern hinter der geheimnisvollen Tür befindet sich auf einmal ein aschgrauer Gang in einen großen Vorraum, von dem aus man eine riesige Halle betritt in deren Mitte eine große Wendeltreppe scheinbar in endlose Tiefen führt und viele weitere Gänge zweigen in ein dunkles Labyrinth aus Korridoren und Zimmern ab. All diese rätselhaften Räume befinden sich im Inneren des Hauses, und sind doch zum verrückt werden vieles umfangreicher als das Haus selbst. Und da sich bei Danielewski dem Leser auch klassische Mythen entgegenräkeln, lauert, wo ein Labyrinth, irgendwo auch ein Minotaurus.
Das Buchlabyrinth beginnt mit einer Einleitung aus dem Jahre 1998 von Johnny Turant, einem kalifornischem Tunichgut-Twen der in einem Tattoo-Shop Hilfstätigkeiten verrichtet, kreuzunglücklich in eine ältere Stripperin verknallt ist, und ansonsten mit seinem Kumpel Lude sauf- und auch sonst drogenfreudig durch die Kneipen der Stadt zieht und glücklosen sexuellen Eskapaden nachgeht. Das (für mich) große Hauptthema stimmt bereits der erste Satz an, in dem Johnny schreibt, dass er immer noch Alpträume bekommt. Wovon? — Also: kurz nachdem er von seinem Vermieter rausgeworfen wurde, vermittelt ihm Lude in seinem Mietshaus eine freigewordene Wohnung. Ein exzentrischer alter Mann, ein Katzenopa, ist dort gestorben, und in der nun von Johnny bezogenen Bude dieses Herrn Zampano findet sich eine Kiste mit einem ungeordneten Konvolut unterschiedlichster Manuskriptseiten und Notizen. Johnny macht sich daran, diese Papiere zu sortieren und das Ergebnis bildet den Hauptteil von »Das Haus«, ein Großessay mit dem Titel »The Navidson Record«. Dreiundzwanzig Kapitel umfasst dieses seltsame, über und über mit Fußnoten gespickte Manuskript. Zampano schreibt darin in sehr sachlicher, analytischer und unaffektiver Sprache über den Meisterphotograph Will Navidson, seine Frau Karen Green (ein Ex-Model) und deren beiden Kinder Chad und Daisy[01]. Will hat für seine Photoreportagen über Expeditionen in die Wildnis und in Krisen- und Kriegsgebiete Publizer-Preis-Ruhm einstreichen können, doch nun soll Schluss sein mit gefährlichen Touren. Um die durch Wills oftmalige räumliche Ferne abgekühlte Ehe und die Eltern-Kind-Harmonie zu fördern, ziehen die Navidsons in ein abseits stehendes Haus in der ländlichen Provinz von Virginia. Immer noch ganz Dokumentarjunkie, installiert Will zig Videokameras um in Big Brother-Container-Manier das neue Lebenskapitel einzufangen, um festzuhalten, wie Menschen sich eine neue Umgebung aneignen. Doch ein kosmischer Schrecken von buchstäblich unfassbaren Ausmaßen ist dem Haus, das sie bezogen haben, eigen. Ganz langsam und sachte zieht Danielewski die Unheimlichkeitszwingen fester. Zuerst befindet sich plötzlich in einem Wandschrank eine weitere Tür ins benachbarte Kinderzimmer. Bald darauf stellt sich nach mehrmaligen Vermessen heraus, dass das Haus Innen um einige Inch größer ist als Außen. Bald darauf sind es nicht nur marginale Größenunterschiede, sondern hinter der geheimnisvollen Tür befindet sich auf einmal ein aschgrauer Gang in einen großen Vorraum, von dem aus man eine riesige Halle betritt in deren Mitte eine große Wendeltreppe scheinbar in endlose Tiefen führt und viele weitere Gänge zweigen in ein dunkles Labyrinth aus Korridoren und Zimmern ab. All diese rätselhaften Räume befinden sich im Inneren des Hauses, und sind doch zum verrückt werden vieles umfangreicher als das Haus selbst. Und da sich bei Danielewski dem Leser auch klassische Mythen entgegenräkeln, lauert, wo ein Labyrinth, irgendwo auch ein Minotaurus.
Seine eigenen Erkundungen in dieses Reich der Dunkelheit filmt Will, und sein Zwillingsbruder Tom sowie der seit einem Unglück auf einen Rollstuhl angewiesene Freund Billy Reston leisten der Familie Beistand, um dem Raum-Mirakel auf den Grund zu gehen. Schließlich heuert man den machohaften Profi-Abenteurer Robert Holloway nebst zwei Assistenten an, um die Geheimnisse der Hausdimension auszukundschaften. All das wird so minutiös sie es vermögen von der Familie und ihren Helfern auf Film und mit Photos gebannt und Will (und zum Teil seine Frau Karen) stellen aus dem gewonnenen Material später einen »Blair Witch Project«-artigen Film mit dem Titel »The Navidson Record« zusammen, der von Zampano ausführlichst beschrieben und kommentiert wird.
Diese Inhaltsskizze ist nun übersichtlicher geraten als »Das Haus« tatsächlich ist, denn das Buch bombardiert seine Leser mit falschen Fährten, einerseits getilgten Informationen und andererseits einer Informations- und Zeichenflut, mit Andeutungen und Widersprüchlichkeiten, dass einem ganz schwummrig wird. Die brachialste Ironie des Buches ist vielleicht, dass der alte Zampano blind gewesen ist. Wie konnte er also derart detailversessen über einen Film schreiben? Viele der von ihm in Fußnoten genannten Bücher, Artikel und Interviews über den Film sind pure Erfindung, und das Parodiespiel welches Danielewski dabei mit den fiktiven Titeln und den Verlagsnamen treibt ist oft ziemlich witzig[02].
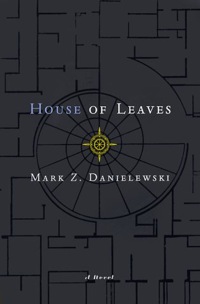 Eine weitere, die Lektüre verkomplizierende Ungebändigkeit von »Das Haus«: Dreimal werden längere Exkursionen in die finsteren Eingeweide des Hauses unternommen, bei denen dann die Buchseiten selbst alle herkömmlichen Formatierungs-Gepflogenheiten hinter sich lassen. Die Unmittelbarkeit und damit einhergehende Beunruhigung (und gottseidank auch manchmal Belustigung und Verblüffung) mit der mir als Leser der Wahn in einer aus zu vielen Zeichen zusammengeballten Dunkelheit auf den Pelz rückte, hat mich in größtes Erstaunen versetzt. Mal kriecht der Text beengt durch schmale Schächte, dann steht er kopfüber, längs oder quer, immer in kunstvoller Analogie zu den im Haus-Labyrinth umherirrenden Figuren[03].
Eine weitere, die Lektüre verkomplizierende Ungebändigkeit von »Das Haus«: Dreimal werden längere Exkursionen in die finsteren Eingeweide des Hauses unternommen, bei denen dann die Buchseiten selbst alle herkömmlichen Formatierungs-Gepflogenheiten hinter sich lassen. Die Unmittelbarkeit und damit einhergehende Beunruhigung (und gottseidank auch manchmal Belustigung und Verblüffung) mit der mir als Leser der Wahn in einer aus zu vielen Zeichen zusammengeballten Dunkelheit auf den Pelz rückte, hat mich in größtes Erstaunen versetzt. Mal kriecht der Text beengt durch schmale Schächte, dann steht er kopfüber, längs oder quer, immer in kunstvoller Analogie zu den im Haus-Labyrinth umherirrenden Figuren[03].
Klingt immer noch eigentlich verhältnismäßig übersichtlich? Nun, ich habe noch nicht von Johnnys Textbeigaben erzählt. Immer wieder, vor allem, wenn ihm Zampano’sche Ungereimtheiten im »Navidson Record« auffallen oder beunruhigen, kommentiert Johnny Tunichtgut ausführlicher und hebt ab, abschweifend von paranoid-halluzinatorischen Krisen seines eigenen Lebens zu erzählen. Der Kontrast zu der distantiert-kühlen aber genau beobachtenden Essaysprache Zampanos könnte kaum größer sein, denn Johnnys urbane Slacker-Prosa ist rauschhaft und subjektiv, entblödet sich leidenschaftlich, plappert mit manisch-depressiver Verve über Drogentrips und Fickspielchen, tischt Flunkereien und Geständnisse über Kindheits- und Jugendtraumatas und über Ausreisserglobetrotterei auf. Und, wie bereits gesagt, am unheimlichsten ist, wie Johnny durch seine Lektüre von und seiner Mühen mit Zampanos Manuspkript schön langsam durchdreht und allen Halt verliehrt, wenn das Grauen des Hauses der Familie Navidson mittels Sprache auch auf sein Leben übergreift.
Am meisten Respekt flößt mir bei »Das Haus« wohl die Könnerschaft Danielewskis ein, mit der er aus eigentlich sehr einfachen Ausgangsprämissen ein gigantisches Spiel über die Unsicherheiten des Menschseins aufführt. Das Buch treibt mit voller Absicht seine Komplexität viel zu weit, als dass irgendjemand ihrer Herr werden könnte. Aber das Fundament bildet schlicht der irritierend einfache Umstand, dass das Verunsicherung verbreitende Unbekannte nicht zuvörderst im andersweltlichem Dunklen lauert, sondern sich schon in den Vermittlungslücken verbirgt, die zwischen einander nahestehenden Menschen klaffen, sowie in den nicht einsehbaren und fremdbleibenden Winkeln unseres eigenen Selbst.
Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.
•••
Mark Z. Danielewski: »House of Leaves«, The Remastered Full-Color Edition; 709 Seiten; Pantheon Books 2007; ISBN: 0-375-70376-4
Deutsche Ausgaben —
Gebunden: »Das Haus«; aus dem Amerikanischen von Christina Schünkle; s/w-Abbildungen, Lesebändchen; 797 Seiten; Klett-Cotta ; ISBN: 978-3-608-93777-0.
—
Taschenbuch: 832 Seiten, BTB 2009; ISBN: 978-3-442-73970-7.
•••
ANMERKUNG:
[01] Als Soundbeispiel hier eine Passage, in der Zampano aus einem fiktiven Essay zitiert; »The Navidson Record« Kapitel IV, Seite 44:
Rätsel: Sie können entweder Freude machen oder auch Qualen bereiten. Die Freude liegt in der Auflösung. Antworten sorgen für strahlende Momente von Verständnis, genau das Richtige für Kinder, denn Kinder leben noch in einer Welt, in der Lösungen allzeit greifbar sind. Die Form des Rätsels birgt in sich das Versprechen, dass sich der Rest der Welt genauso einfach entschlüsseln lasse. Und so beruhigen Rätsel den kindlichen Geist, der angesichts all der vielen Informationen, die ihn bedrängen, und all der vielen Fragen, sich sich daraus ergeben, wie wild rotiert und kreiselt.
Die Welt der Erwachsenen erzeugt dagegen Rätsel von anderer Art. Rätsel, auf die es keine Antwort gibt und die man nicht selten geheimnisvoll oder paradox nennt. Der alte Anklang an die Form des Rätsels aber korrumpiert gleichsam diese Fragen, indem er ein ums andere die grundlegendste Lektion wiederholt: Es muss eine Antwort geben. Daher rührt die Qual.
••• Zurück
[02] Empfehlung für alle die mit derartigen intertextuellen und selbstbezüglichen Textwelten noch minder vertraut sind: Gerhard Wolpert:
»Hypertextantrieb – Ein Reiseführer in postmoderne Erzählwelten« (Kampsuhr Verlag, 1999) legt in 10 einfachen Lektionen dar, wie man in einem Roman Verweise und Zitate (sowohl selbstbezügliche wie solche zu anderen Romanen und Medien) erkennt, in welche Klassen man diese sortieren kann, und wie man Sinn und Lesefreude aus ihnen herausquetscht und konserviert. Nützlich vor allem Dank seiner vielen Tabellen, farbigen Karten und Risszeichnungen. •••
Zurück
[03] Auch wenn Danielewski dem
›Genre‹ (post)moderner Formsperenzchien mit »Das Haus« ein triumphales Werk hinzugefügt hat, wäre es übertrieben, ihn diesbezüglich als Pionier einzustufen. Ich verweise darauf, dass dem Lesepublikum derartige (post)moderne Prosaexperimente bereits mit Laurence Sternes
»Tristram Shandy« (1760-1767) dargeboten werden und als weitere markante Lieferanten solcher Textlabyrinthe können gelten: Arno Schmidt (
»Zettel’s Traum«, 1970) Raymond Federman (
»Alles oder Nichts«, 1971, dt. Die Andere Bibliothek 1986), Julio Cortázar (
»Rayuela – Himmel und Hölle«, 1974, dt. Suhrkamp 1981). •••
Zurück
Thor Kunkel: »Schaumschwester«, oder: Gesegnet seien die lieblichen Dinge
Eintrag No. 622 — Soweit ich das Feld der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur überblicke, ist mir kein ›Fall‹ bekannt, der die Urteilsfähigkeit der heimischen Literaturkritik derart in Frage stellt, wie die Besprechungen der Romane von Thor Kunkel. Sein umfangreiches Debut »Das Schwarzlicht-Terrarium« erntete Lob und Preise. Auch der schmale Folgeband »Ein Brief an Hanny Porter« wurde noch mit viel Wohlwollen aufgenommen. Dann erschien »Endstufe« und aufgrund der Skandalisierung durch einen »Spiegel«-Beitrag von Henrik M. Broder und des in diese Melodie einstimmenden Chors nachfolgender Rezensenten wurde Thor Kunkel für einige Zeit zum unerträglich geschmacklosen Nazi- und Holocaust-Verharmloser gestempelt. — (Eine ganze Reihe Einträge der Molochronik sind unter dem Stichwort ›Thor Kukel‹ dieser Angelegenheit gewidmet. Das sollte auch reichen als Hinweis, dass ich aufgrund meiner persönlichen thematisch-literarischen Interessen nicht mit distanzierter objektiver Haltung Partei für Thor Kunkel ergreife. Aber Literatur ist für mich zu einem Gutteil eine Sache der Leidenschaft.)
Aber zu »Schaumschwester«.
 Kulturkritik an den aus dem Ruder laufenden Entwicklungen der (im verwerflichen Sinne) hedonistisch-konsumistischen Industrie- und Mediengesellschaft, so wie Kunkel sie betreibt, verpackt in pulp-ige Stories, ist nun mal etwas, was den meisten deutschen Feuilliteonisten nicht schmeckt. Da schwellen den Kritkkern schnell Empörungsadern. »Der relativiert ja die Nazis!«, heißt es dann, wenn die Deutungshoheit zu der ›absoluten‹ Einzigartigkeit der Übels des Dritten Reiches verteidigt wird.
Kulturkritik an den aus dem Ruder laufenden Entwicklungen der (im verwerflichen Sinne) hedonistisch-konsumistischen Industrie- und Mediengesellschaft, so wie Kunkel sie betreibt, verpackt in pulp-ige Stories, ist nun mal etwas, was den meisten deutschen Feuilliteonisten nicht schmeckt. Da schwellen den Kritkkern schnell Empörungsadern. »Der relativiert ja die Nazis!«, heißt es dann, wenn die Deutungshoheit zu der ›absoluten‹ Einzigartigkeit der Übels des Dritten Reiches verteidigt wird.
Ein mustergültiges Anschauungsbeispiel für eine zu heftig und zu flott mit dem ›Daumen runter‹-Urteil hantierenden Kritik ist die Rezension von Sandra Kerschbaumer in der F.A.Z. vom 14. Mai: »Mit Puppen kann man nur spielen« (Komplette Rezi nicht umsonst im Internet zu haben). — Die Ausführungen zum Inhalt stimmen zwar grob: In unbestimmter naher Zukunft sollen der ›Cyperpunk‹ Robert Kolther und seine Assistentin Lora Heisse in Nizza im Geheimauftrag der EU die Kundendaten von Paddy Scheinbergs Synthetischer Wohlfahrt AG klauen. Deren Schaumschwestern (= raffinierte technologische Weiterentwicklungen von Sexpuppen) verkaufen sich, und befriedigen ihre Besitzer derart erfolgreich, dass man sich um den Fortbestand der Menschheit sorgt. Mit der Hingabe an die Gymnoiden droht der Menschheit ihr eigener Untergang. — Was Kerschbaumer aber schon nicht mehr im Blick hat, ist, dass Kunkel es mittels der biopolitischen Ansichten der im Buch gegeneinander antretenden Gruppen schafft, das unbequeme Thema ›biopolitische Globalstrategien‹ anzusprechen. Beispielsweise ist den Hegemons der schrumpfenden ersten Welt bang wegen der Gebärfreudigkeit zurückgebliebender, fanatisierter Zweit- und Drittwelt-Populationen. Einige Strategen der Handlung kalkulieren deshalb, dass man den triebstarken Afrikanern, Islamisten und anderen Ressourcen-Konkurrenten halt Schaumschwestern schmackhaft machen und ausreichend andrehen müsste.
Worauf sich Kerschbaumer aber sehr heftig kapriziert, sind Anspielung auf die Nazis.
Sie wertet die …
{…} in der Figurenrede des Romans immer wieder auftauchenden Erwähnungen {Molos Hervorhebung} des Nationalsozialismus als Provokationszwang des Autors.
Kunkel, so Kerschbaumer (in meiner Paraphrase) »dient ein bekanntes Muster dazu, den Nationalsozialismus zu relativieren«:
Der Hass auf die Moderne lässt das ›Dritte Reich‹ lediglich als eine ihrer Ausgeburten erscheinen. Dem singulären Grauen wird seine Singularität genommen, indem es vergleichbar wird {…}
Dabei gibt es genau drei Stellen mit Nazi-Anspielungen im Roman:
- Kapitel 3, Seite 40: Einsatzbesprechung des Spionageauftrages. Figur Ralf Schuhnicht (Interpol-Chef in Brüssel) referiert über die Schaumschwestern, dass sie der post-humanen Wirtschaft zupass kommen.
»Die Nazis hätten wohl von Keimkraftzersetzung gesprochen und das Wort trifft – so krude es ist – den Kern der Sache.«
Und Kriminalpsychologin Ulla Bartmann vom BKA ergänzt:
»Die Geschlechter sind voneinander enttäuscht. Mit diesen Folgen hätte allerdings niemand gerechnet.«
Kunkel präzisiert anhand seiner Figuren aber deutlich, dass es vor allem an ›klassichen‹ Geschlchtesrollenformaten klebende Männer sind, die von den Frauen enttäuscht sind. ›Held‹ Kolther wird ausführlich als Opfer seiner Ex-Frau inszeniert, dem u.a. durch die gemeine Art, wie seine Frau sich von ihm trennte, Lust und Liebe buchstäblich vergangen ist.
- Kapitel 5, Seite 72: Kolther und Lora bei einem ihrer vielen Gespräche über die Schaumschwestern, der Gründe für deren Erfolg, und der Ziele und Zwecke denen sie zuarbeiten. Kolthers und Loras Chef hat als Grund für den Auftrag »die Rettung der Menschheit« genannt. Kolther erklärt Lora während einer Beschattungstour im Naturkundemuseum, dass dies eine Verniedlichung von Sachverhalten sei, denn …
{Kolther} »Je mehr Menschen, desto mehr Arbeitskräfte, desto mehr Konsumenten. Sex, nicht die Börse, ist der wahre Antriebsmotor der Ökonomie. Wenn wir Paddys Firma {= Synthetische Wohlfahrts AG} ausschalten, dann retten wir nicht der Menschheit den Arsch, sondern der Industrie und der Zinswirtschaft und der …«
{Lora} »Aber der Chef …«
{Kolther} »… ist ein Nazi.«
Toll. Wenn eine Romanfigur eine andere als Nazi bezeichnet, ist das schon Teil einer Methode zur Verharmlosung des Dritten Reiches.
- Kapitel 6, Seite 89: Kolther und Lora im Hotelbungalow. Das Frauenbild der Musikclips im Fernsehen wird anhand von Lady Gaga und Shakira kommentiert.
{Lora} »Waren die Frauen früher wirklich so anders? {…} In der fetischistischen Verwertungsgesellschaft des Westens haben Frauen schon immer ihre Kommodifizierung entschiedener als Männer betrieben {…} Wer es schafft als Traumfrau zu gelten, hat ausgesorgt, oder nicht?«
{Kolther} »{H}ast Du diese haptische Wichsvorlage eben Traumfrau genannt? {…} Wenn es das ist, was alle wollen, sowohl Männer als auch Frauen {…} und wenn es niemanden juckt, dass die freie Welt gerade die Körpernormierungsphantasien verwirklicht, die auf dem Reißbrett der Nazis entstanden … warum ziehen wir dann einen wie Scheinberg aus dem Verkehr?«
Puh. Ich habe meine liebe Not, nachzuvollziehen, wie man anhand dieser drei Stellen so einseitig urteilen kann. Und ich muss aufpassen, dass ich bei dem Zitieren hier nicht falsche Spuren lege.
Man kann und darf natürlich der Meinung sein, dass die Kritik des Romans am westlichen Kulturwesen und seinen Geschlechtsidealen übers Ziel hinausschießt, weil vielleicht die Mißstände so arg nicht sind. Man könnte sich aber auch eine Nachhilfe antun, z.B. mit dem Filmessay »Dreamworlds 3« (»Desire, Sex & Power Music Video«) von Sut Jhally und möglicherweise zu dem Schluss kommen, dass einer wie Kunkel den respektwürdigen Versuch unternimmt, die brutal-entmutigende Monstrosität des Themas mit den Mitteln des erzählerischen Zorns und des spekulativen Spottes zu bannen.
Kunkels ›poetologisches Programm‹, also seine Konzepte was Tonfall, Themen, Figuren, Erzählaufbau usw angeht ist in der derzeitigen deutschen Literatur ziemlich einzigartig. Einerseits nutzt er einen satten Kolportagestil (Äktschn, Schock- und Irritation mittels ätzender sprachlicher Drastik, spott- und hassglasierte Kommentierung prominenter Persönlichkeiten und Ereignisse, gemixt mit wild zusammengetragenen kulturgeschichtlichen Fundstücken, schließlich gewürzt mit Kalauerlust), der nicht verhehlt, dass Kunkel oberflächlich gelesen auf Unterhaltung abziehlende Räuberpistolen fabriziert. Aber er wagt es dabei, große Themenkomplexe wie Menschenbild-Konflikte, Zeitgeist-Kritik, Biopolitik, Hegemonie der Pornokratie im kulturellen Mainstream (um nur einige zu nennen) aufzufalten. Dass dabei nichts herauskommen kann, was bequem und konsensfähig ist, läßt sich an drei Fingern abzählen. Man kann Kunkels Romane diesbezüglich schlicht als Geschmacklosigkeit abtun. Andererseits ist es bei den genannten Problemfeldern so, dass Kunkel (aus meiner Sicht) sehr effektiv mittels seiner Schreibe die den angesprochenen Problemkreisen innewohnende Geschmacklosigkeit verdeutlicht.
Um zu klären, dass ich nicht mit dem Blick eines vollends unkritischen und einseitig wertenden Jubelpersers auf »Schaumschwester« blicke, sei eingestanden, dass ich mich der Kritik anschließe, die, was einige Stellen des Romans angeht, zu dem Schluss kommt, dass mindestens eine weitere Lektorats-Session dem Buch gut getan hätte. Vor allem im letzten Drittel des Buches ist der Wechsel von Tempo- und Erzählhaltung, zwischen brillanten Szenen und ›Draufsicht‹-Hetzte zu holterdipolter um den Roman als gänzlich rund bezeichnen zu können.
Dennoch bin ich weit davon entfernt »Schaumschwester« als misslungen oder auch nur mittelmäßig einstufen zu wollen, denn ich habe auch diesmal wieder den ›Kunkel-Sound‹ genossen und finde, dass er den Lesern einen erstaunlich unterhaltsamen Ritt durch eigentlich bitterstes Themengelände bietet. Auch wenn diese Themen und Motive (Bevölkerungsentwicklungen als Manipulationsfeld der internationalen Konkurrenz, Pornokratie, emotionell kaputte Typen, heilsgeschichtliche Aneignung der Evolutionstheorie, Ekel vor der Kultur der Ersten Welt, Misanthropie usw.) als Stoff für einen kurzweiligen, sprachlich frechen Phantastik-Garn für manche Leser völlig indiskutabel sind, ist das in »Schaumschwester« gebotene Gedankenspiel in meinen Augen gelungen und die somit vom Autor gegebenen Anregungen diesen Themen kritisch Aufmerksamkeit zu widmen sehr lobenswert.
Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.
•••••
Thor Kunkel: »Schaumschwester«, Prolog, Epilog, 19 Kapitel und Vorschau/Ausszüge zu weiteren Titeln der Reihe »Neue Welt« auf 288 Seiten; Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2010; ISBN: 978-3-88221-690-5.
Philip Pullman: »The Good Man Jesus & the Scoundrel Christ«, oder: Nur ‘ne Geschichte
Eintrag No. 620 — Ich kann mich noch erinnern, dass ich zu Pullmans »His Dark Materials«-Trio gegriffen habe, weil sie mir als feine Fantasy empfohlen wurde, und wie ich dann zweimal überrascht wurde.
- Erstens, weil ich nicht damit gerechnet hatte, das Pullman ein erfreulich streitbarer Kämpe im Kampf gegen religiösen (eben vor allem christlichen) Schmarrn und Machtanspruch ist, der in seiner Jugendfantasy Philosophie, Kosmophysik, Fantasy-Äktschn keck mit einem Krieg gegen den Himmel verquickt.
- Zweitens überraschte mich dann unangenehm, dass Pullman bei Band drei von »His Dark Materials« mich irgendwie verfehlt hat, denn »The Amber Spyglass« war nicht so rund, süffig und spannend wie die ersten beiden Teile (trotz des – ooops … hoppala – Nebenbeitdruffgehen von GOtt). Ich hab den Band bis heute nicht fertig gelesen.
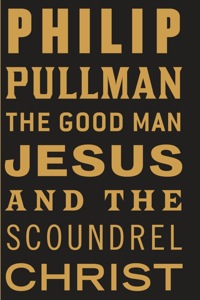 Da kam es mir durchaus zupass, dass Pullman mit »The Good Man Jesus & the Scoundrel Christ« was Neues in einem abgeschlossenen Band vorlegt. Im Rahmen der ›Mythen‹-Reihe, die international von einigen Verlagen herausgebracht wird, darf Pullman seine Fassung der Geschichte von Jesus Christus darbieten. Schon die Cover-Rückseite sagt es deutlich:
Da kam es mir durchaus zupass, dass Pullman mit »The Good Man Jesus & the Scoundrel Christ« was Neues in einem abgeschlossenen Band vorlegt. Im Rahmen der ›Mythen‹-Reihe, die international von einigen Verlagen herausgebracht wird, darf Pullman seine Fassung der Geschichte von Jesus Christus darbieten. Schon die Cover-Rückseite sagt es deutlich:
This is a story.
Das ist eine Erzählung.
…und ich Schelm denk mir freilich, dass genau diese Aussage natürlich auch auf die ›Origialversion‹ zutrifft.
Als Kind bin ich gequält worden mit bravgebügelten Bibel- und Jesusgeschichten. Ich geb zu: in einer Welt, in der es Zorro, Fantomas, den Roten Korsar und Lawrence von Arabien gibt, hat es der Sandalenheld Jesus nicht mehr leicht, die Kinder (genauer: Kleinbubenherzen) für sich zu gewinnen. Da nimmt es wohl nicht wunder, dass mir instinktiv immer schon der wütende Jesus am besten gefallen hat, wenn er Händler aus dem Tempel scheucht. Als junger Teen hatte ich meinen Spaß mit Michael Korths »Der Junior Chef«-Version des NT; habe eine aus der Stadtbücherei geliehene Neue Jerusalemer Bibel kompletto durchgeackert und später, als Twen, auch Luthers Bibel intensiver quergelesen. — Ach ja: Haderers Jesus-Satire habe ich einst für Literaturkritik rezensiert. — Kurz: ich bin totaaal der Dscheeses- und Bibel-Experte (immerhin sind die ersten beiden ›seriösen‹ Berufswünsche (also nach Pirat, Superheld und Robin Hood), an die ich mich erinnern kann, Inquisitor und Papst).
Doch zu Pullman.
Er hat den typischen Bibelgeschichtensound gut getroffen. Nachteil: Entsprechend fad. Vorteil: Flott lesbar. Von den 54 Kapiteln sind eine Handvoll allerdings sehr fein, denn in ihnen bündeln sich (a) eine milde vorgetragende und doch grundlegende Kritik an organisierter/koorperationistischer Religion, sowie (b) Meditationen über das Weben und Wirken von Geschichten und wie man ›die gewöhnlichen Menschen‹ motiviert; mitunter auch darüber, ob eine kontemplative oder aktionistische Haltung geeigneter ist, um Utopien zu verbreiten.
Der Clou von Pullmans Version des Evangeliums ist, dass er aus der Figur des Erlösers ein ungleiches Zwillingsbruderpaar gemacht hat. Da ist einerseits der Impulsmensch Jesus, Drop-Out und Sozialrevoluzzer der gegen die bestehende Menschenordnung anpredigt und Kraft seiner charismatischen Ausstrahlung so manchen Leidenden und Siechen ›wunderheilt‹; zum anderen der mamatreue, introvertierte Bücherwurm Christ, der mit neidischer Liebe die Umtriebe seines Bruders beobachtet und von einem irdischen Himmelreich träumt.
Der antimaterialistische Jesus und der kalkulierende Idealist Christus geben ein feines Antagonistenpärchen ab, ohne sich jemals wirklich in die Haare zu kriegen. Ein Höhepunkt war für mich ihre Diskussion in der Wüste. In der Bibel ist das die berühmte Versuchung des Erlösers durch den Teufel, der mit weltlicher Macht, Lustbefriedigung und haste nich gesehen lockt. Bei Pullman wird daraus ein Gespräch zwischen Zweien, die auf unterschiedliche Art Gottes Willen erfüllen wollen: Jesus als apokalyptischer Seelenhygienigker misstraut Christus Vorstellungen von einer organisierten Form des himmlichen Reiches auf Erden. Der Faden von Jesus Skepsis gegenüber organisierter Religion wird wirkungsvoll weitergesponnen in der Neu-Fassung der berühmt-ergreifenden Szene des Gebetes im Garten von Gethsemane, sicherlich der Höhepunkt des Buches.
Leichte Krimistimmung kommt auf, als Christ von einem geheimnisvollen Namenlosen (einem Engel?, einem Priester?) beauftragt wird, die Reden und von Taten von Jesus zu protokollieren, eben um daraus später den Initialtext der frohen Botschaft für die Massen zu machen. Pullman legt dabei seine Ansicht dar, dass, wenn es je eine wahrhaftige Messiasgeschichte gegeben hat, diese zum Zwecke der Seelenverführung im Sinne der keimenden Kirche aufgepeppt wurde.
Für ausgewachsene Religions- und Ideologiefresser ist dieses Buch sicherlich zu harmlos, aber vielleicht trotzdem amüsant zu lesen. Für aufrecht-kritische Christengläubige bietet sich der neue Pullman vielleicht sogar eine tröstlich-strärkende Lektüre an.
(Eine Deutsche Ausgabe ist bei uns offiziell noch nicht angekündigt. Auf der englischen Website zum Buch wird der Fischer Verlag als Herausgeber der deutschen Ausgabe genannt. Ein Termin steht noch nicht fest.)
Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.
•••••
Thomas Pynchon: »Gegen den Tag«, oder: Leinen los, oh Ihr Gefährten der Fährnisse!
•••
 Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.
Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.
Ganz anders der Riesenroman »Gegen den Tag«, der mich von der ersten bis zur letzten Seite derart heftig mitgenommen und für Pynchon eingenommen hat, dass ich in rascher Folge seine beiden ersten Romane »V.« (1961, dt. 1968) und »Die Versteigerung von No. 49« (1966, dt. 1973) las, und siehe: vor allem zweiterer ist alles andere als sperrig.[02]
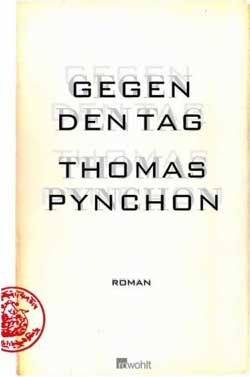 Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.
Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.
Auf welches Hauptthema man »Gegen den Tag« auch verkürzen will, man kann diesem Riesenschinken dabei nicht gerecht werden. Forsch drauf los behauptet, schlage ich vor, dass die große Themenlandschaft von »Gegen den Tag« aufgefaltet wird durch Fragen über die, und Zweifeln an der (Un-)Zielgerichtetheit der Geschichte der modernen Welt und ihrer Individuen. Dazu spannt das Buch einen Zeitbogen von der Großen Weltausstellung in Chicago 1893, bis knapp nach Ende des Ersten Weltkrieges. Eine ungeheure Milieu- und Umgebungs-Vielfalt wird aufgeboten um zu illustrieren, wie sich damals die Weltläufte beschleunigt und sich zerfasernd in jene unheilvollen Strudelbewegungen bezogen wurden, die zu den großen (größtenteils menschengemachten) Katastrophen des 20. Jahrhunderts führten. Den Reigen der Bösewichter führt dabei der vulgärkapitalistische Industriekapitän Scarsdale Vibe an, der seine gewissenlosen Handlanger unter anderem ausschickt, um unbequeme Bergarbeiter-Sozialisten zu meucheln. Von den gegen solche wie Vibe revoluzzenden Verkündern des Evangeliums des Sabotage-Dynamits bringt einer, Moss Gatling, den »Gegen den Tag« und gegen die Kontroll- und Unterwerfungsabsichten gerichteten Impuls des Widerstands mit folgenden Worten auf den Punkt:
Aber wenn ihr einen Punkt in eurem Leben erreicht, wo ihr begreift, wer wen bescheißt – vergib mir, Herr –, wer nimmt und wer nicht, dann seid ihr verpflichtet, euch zu entscheiden, mit wie viel ihr euch einverstanden erklärt. Wenn ihr nicht jeden Atemzug eines jeden Tages, ob im Wachen oder im Schlafen, an die Vernichtung jener wendet, welche die Unschuldigen so leichthin schlachten, wie sie einen Scheck unterschreiben, wie unschuldig wollt ihr euch dann nennen? Dieser Frage müsst ihr euch jeden Tag neu stellen und zwar in dieser Absolutheit.
[04]Egal, wie sehr man sich nun dafür ins Zeug legt, Pynchon zum Großmeister der engagierten, modernen Anspruchsliteratur zu stilisieren, man mindert den Status dieses Autor keineswegs, wenn man ihn ›nur‹ als Lieferanten ausufernder Abenteuerlichkeiten und Blödeleien nimmt (inklusive alberner und zotiger Lieder, die von den Figuren immer wieder angestimmt werden). Die für die E-Literaturmedien schreibenden Rezensenten drücken sich nicht selten davor, auf die ausgesprochen heftigen Phantastikstrahlung von »Gegen den Tag«hinzuweisen, doch hier, in einem Phantasten-Blog, ist dieser Aspekt des Buches natürlich besonders zu betonen.
Den deutlichsten roten Phantastikfaden liefern die an die ›scientific romances‹ von H. G. Wells und die ›voyages fantastique‹ von Jules Verne erinnernden Luftschiffabenteuer der ›Gefährten der Fährnisse‹[05] (deren Vornamen — Chick, Miles, Lindsay, Randolph und Darby — alle von Größen des Jazz entliehen sind; außerdem gehört noch der intelligente Hund Pugnax zur Crew). Da wird die Hohlwelt durchquert, oder sich so weit in astrale Höhen vorgewagt, bis man in Gegen- und Nebenwelten wieder runterkommt. Auch wühlt man sich in einem Land-U-Boot unter der asiatische Wüste hindurch, um in Städten, die schon vor langen Zeiten vom Sand verschluckt wurden anzudocken.
Geisterhafte Erscheinungen treten regelmäßig auf, mal in Gestalt einer jungen Frau (Yashmeen Halfcourt), die so grazil und anmutig ist, dass zuweilen das Licht durch sie hindurchscheint; mal als Vatergeist, der bevorzugterweise bei Eisenbahnfahrten oder im Traum einem seiner Söhne als anspornender Rachemahner erscheint; mal als grausamer österreichischer Offizier, der aufgrund seines Sadismus als Vampir gilt; ein andermal treibt ein gutbetuchter englischer Dandy seine nocturale Empfindsamkeit soweit, dass er vorzieht wie eine Fledermaus im Keller kopfüber schlafend zu verbringen. – Verschiedene nach der Weltherrschaft strebende Mächte strecken ihre Hand nach dem geheimnisvollen Islandspat aus, das die Eigenschaft besitzt, Dinge die man durch ihn sieht zu verdoppeln. Das Motiv der Verdoppelung wird weitergetrieben zur Bifuraktion, was einige Figuren bis hin zur Kunst bringen, zugleich an zwei Orten zu sein, zum Beispiel, wenn jemand bequem im Sessel liest, und sich zugleich in der Arktis befindet. — Auf Konferenzen beschäftigen sich Wissenschaftler seltsamer Disziplinen mit den Möglichkeiten der Zeitreise und den Geheimnissen des Aethers, oder trachten danach, die Turbulenzen und Vibrationen von Tornados in Sprache zu übersetzten, um im entsprechenden Code mit den schicksalsmächtigen Wirbelwinden kommunizieren zu können. — Ein indischer Yoga-Wissenschaftler, beherrscht die Kunst, durch komplizierte Verrenkungen (sprich: dimensionale Krümmungen des Raumes) sein körperliches Aussehen (bis hin zum Geschlecht) zu verändern, so wie unsereins mittels Fernbedienung den Sender wechselt. — Zeitreisende aus der Zukunft, und Flüchtende von den Massakern der kommenden Weltkriege und womöglich auch der ihnen folgenden Stellvertreterkriege des Kalten Krieges und des Krieges gegen den Terror schleichen durch die Welthintertüren. — Ein sprechender, gutmütiger Kugelblitz, begleitet kurz eine Familie. — Ein den Atlantik überquerendes Passagierschiff verwandelt sich gleitend in ein Schlachtschiff. — Mit einem raffinierten Lichtspielapperat kann man nicht nur aus einem beliebigen Photo die Vergangenheit wieder erscheinen lassen, sondern bei entsprechender Manipulation der analysierten Lichtkonserve lassen sich auch alternative Seitenpfade des Möglichkeitsgeflechts ersehen.
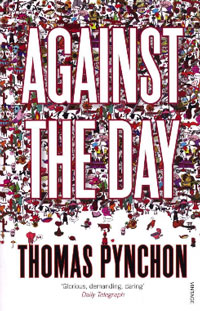 Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen:
Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen:
Noch eine Weile nach dem Ereignis liefen verrückt gewordene Raskolniki in den Wäldern umher, geißelten sich und gelegentliche Gaffer, die zu nahe kamen, und delirierten von Tschernobyl, dem zerstörten Stern namens Wermut aus der Offenbarung. Rentiere entdeckten ihre uralten Flugfähigkeiten wieder, die im Laufe der Jahrhunderte seit dem Eindringen von Menschen in den Norden verloren gegangen waren. Bei manchem regte die Begleitstrahlung die Epidermis insbesondere im Nasenbereich zu einem Leuchten am Rotende des Spektrums an. Stechmücken büßten ihre Vorliebe für Blut ein, eigneten sich stattdessen eine Vorliebe für Wodka an und wurden beobachtet, wie sie sich in großen Schwärmen in einheimischen Kneipen zusammenfanden. Uhren, auch Armbanduhren, gingen rückwärts. {…} Sibirische Wölfe kamen mitten im Gottesdienst in Kirchen, zitierten in fließendem Altslowanisch Stellen aus der Heiligen Schrift und gingen friedlich wieder hinaus. {…} Ganze Dörfer kamen zu dem Schluss, dass sie sich nicht dort befanden, wo sie sein müssten, worauf die Einwohner ohne große Vorausplanung schlicht zusammenpackten, was sie besaßen, zurückließen, was sie nicht tragen konnten, und sich gemeinsam in den Busch aufmachten, wo sie kurz darauf Dörfer errichteten, die niemand sonst sehen konnte. Jedenfalls nicht sehr deutlich.
[06]Ebenso reichlich geboten wird prickelnde Situationskomik (wenn ein kauziger Wild West-Fuzzi sich auf eine sinnliche Eskapade mit einem Schoßhündchen einlässt), haarsträubende Äktschn (wenn ein Abenteurer in einer Lebensmittelfabrik vom schrecklichen Tod durch Mayonnaise bedroht wird), bezaubernde Liebes- und Erotikabenteuer, Einblicke in Elends- und Luxuswelten mit all ihren durch von ideologischen, politischen, spirituellen und transzendenten Verblendungen befeuerten Intrigen. Zwar mag »Gegen den Tag« unverschämt vollgestopft mit Details und ausufernd bei seiner Weltenwanderei sein, aber folgt man den Rat von Pynchon-Veteranen, und schert sich (beim ersten Mal) einfach nicht um Fragen aufwerfende Stolperstellen, sondern liest mit gebotener Sturheit weiter, dann kann man wahrlich etwas erleben.
SERVICE:
Ausführliches Inhaltsverzeichnis zu »Against the Day«
•••••
Thomas Pynchon: »Against the Day«, (2006); 70 Kapitel in 5 Teilen auf 1220 Seiten; Vintage Taschenbuch (Yuko Kondo-Cover Edition) , 2007; ISBN: 978-0-099-51233-2.
Thomas Pynchon: »Gegen den Tag«; Deutsch von Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren; 1596 Seiten. Gebundene Ausgabe: Rowohlt Verlag 2008; ISBN: 978-3-498-05306-2.
Taschenbuch: Rowohlt Verlag, 2010; ISBN: 978-3-499-24609-8:
•••••
ANMERKUNGEN:
[01] Auch wenn dieser Passage in »Trainspotting« von Irving Welsh und seinem Verfilmer Danny Boyle Tribut gezollt wurde, ich fands sie nur grenzenlos unappetitlich. •••
Zurück
[02] Der Griff zu »Die Versteigerung von No. 49«, dem kürzesten Roman von Pynchon, sei als Einsteig für Neugierige angeraten, die bezweifeln die Ausdauer/Konzentration für seine dicken Romane aufbringen zu können. Am erstaunlichsten ist, wie dieser von Verschwörungsunsicherheiten gesättigte Roman trotz, oder gerade wegen seiner Kürze durch Ideenfülle und Quadruppel-Bödigkeit brilliert.
Auch »V.« ist reizvoll facettenreich, wenn auch schon formal schwerer, da sich hier verschiedenste Handlungsfäden und Episoden lange Zeit nur auf äußerst vage Art aufeinander beziehen. Doch auch bei V. macht die kunterbunte, humorige, manchmal sogar deftige Mischung aus Fabublödelei und hochtrabender Spekulation Laune. ••• Zurück
[03] Ein modern-einheimisches Anschauungsexempel bietet das thüringische Panorama Museum nahe Bad Frankenhausen, in dem ein zylindrisches Ölgemälde von Werner Tübke, im Format 14 x 112 Meter, mit über 3000 dargestellten Figuren, die Bauernkriege von 1524 in einer prächtigen Rundschaukunde präsentiert. ••• Zurück
[04] »Gegen den Tag«, Seite 133/134. ••• Zurück
[05] Im Original tragen sie den schmissigen Namen ›Chums of Chance‹, was auch als ›Kumpel des Glücks‹ übersetzbar wäre. ••• Zurück
[06] »Gegen den Tag«, Seite 1157 f. ••• Zurück
Flix: »Faust. Der Tragödie erster Teil« als Comic, oder: Ramazotti! Denn GOtt hat Kreislauf.
Eintrag No. 612 — Goethes »Faust« ist für alle leidenschaftlichen Exklusivfreunde klassischer, ernster Geschichten — die jedoch mit misstrauischem und gramvollem Blick die phantastischen Fabulationen beäugen — ein mitunter peinliches Prunkstück, denn die moralische, allegorische, romantische, tragische und zuweilen tollkühn burleske Mär über die Wette zwischen GOtt und Mephisopheles um eine treue aber zweifelnde Seele ist und bleibt trotz all ihrer wahren, guten und schönen Eigenschaften ein Glanzstück deutscher Phantastik.
 Mit großer Freude habe ich letztes Jahr auf den Webseiten der F.A.Z. die in täglichen Fortsetzungen erstveröffentliche modernisierte Fassung dieser Geschichte durch Meisterfeder Flix genossen. Flix hat mich schwer beeindruckt mit seinem autobiographisch angehauchten Band »held«, indem unter anderem Monster und Ängste auf wunderbare Art mit den veranschaulichenden Kniffen, die dem Erzählen in Comicform zuhanden sind, auftreten.
Mit großer Freude habe ich letztes Jahr auf den Webseiten der F.A.Z. die in täglichen Fortsetzungen erstveröffentliche modernisierte Fassung dieser Geschichte durch Meisterfeder Flix genossen. Flix hat mich schwer beeindruckt mit seinem autobiographisch angehauchten Band »held«, indem unter anderem Monster und Ängste auf wunderbare Art mit den veranschaulichenden Kniffen, die dem Erzählen in Comicform zuhanden sind, auftreten.
»Faust« von Flix holt den hehren, für heutige Gemüter stellenweise schwer verdaubaren Stoff des Olympiers herab von den Säulen marmorner und äääääärrrrrnster Schwere und macht daraus ein Slapstick-Bravourstück, löblicherweise ohne die nachdenklichen Nuancen vollends einzubüßen. Die Götter werkeln in einem Bürokomplex, GOtt-Vater ist wegen seines mauen Kreislaufs ein Ramazotti-Dauerschlürfer; Gutelaune-Profi Mephistopheles ein Denglisch radebrechender Lifestyle-Coach; Softie Faust ein gutmütiger Taxifahrer in Nöten; Wagner ist ein nerviger Rollstuhl-Neger und das Gretchen eine von ihrer konservativen türkischen Familie drangsalierte Biokost-Verkäuferin. — Hilfreichere Orientierung als ich bieten könnte liefert die Inokulierung von Andreas Platthaus anlässlich der F.A.Z.-Fassung: »Quadratnase für Faust«.
Diese schnelle Empfehlung will ich auf den Punk bringen, indem ich meine absolute Lieblingsszene nachzuerzählen versuche:
(Seite 35): {Zusammenhang, in den weiteren Klammern folgt die Kästchen-Nummerierung} Mephisopheles, kurz: Meph, hat Faust betüdelt einen Vertrag mit ›Happy Life‹ zu unterschreiben. Leistung soll sein: Faust glücklich zu machen, was Goethe mit »Augenblick verweile doch, Du bist so schön« umschrieb. Gegenleistung: ›Happy Life‹ soll die exklusiven Nutzungsrechte an Fausts Seele nach dessen Abbleben erhalten. Nun soll es ans Unterschreiben gehen.
{Zwölfer-Gitter mit 3 Kästchen pro Zeile: 1} Fausts Hand führt einen Stift zur Linie für die Unterschrift.
{2} Faust und Meph (mit Kaffee) erschrecken, denn der Papierblock des Pakt-Vertragswerks steht plötzlich in Flammen.
{3} Meph zückt ein zweites Pakt-Werk. »Das passiert manchmal«, meint er fidel, »Zum Glück habe ich noch ein feuerfestes Exemplar dabei.«
{4} Himmel: GOtt, so ein blonder Pferdeschwanz- und Schnauzbarttyp in hellgrauem Anzug mit Krawatte, überm Kopf schwebt das ›Auge im Dreieck›-Symbol, steht am Himmelsgeländer ›snippt‹ mit den Fingern. Hinter ihm fliegt sein kleiner Sekretärs-Engel, feister Baseballkappen-Typ mit Zigarette und Headphone.
{5} Bei Faust und Meph flattern nun auf einmal die Seiten des Paktes herum.
{6} Himmel: Headphone des Sekretärs klingelt. »Käpt’n! Ein interner Anruf.«
{7} Chaos aus durcheinander fliegendem Papier bei Faust und Meph. Zweiterer versucht hektisch die herumschwirrenden Blätter einzufangen. »Ups! Da ist wohl … irgendwo … ein … Fenster … auf.«
{8} Himmel: GOtt snippt und fragt: »Wer ist dran?«. Der Sekretäts-Engel hält immer, wenn jemand anruft, eine Stellvertreterhandpuppe des Anrufers hoch, diesmal einen kleinen Papst. »Kollege Benedikt. Wann Sie Zeit hätten, mit ihm vor seinen Vortrag für die Präsentation am Sonntag durchzugehen.« — »Morgen. Morgen früh«, antwortet GOtt.
{9} Faust beim Versuch zu unterschreiben meint nun: »Hm. Schreibt nicht«, und Meph hält schon einen Füller hoch: »Der vielleicht.«
{10} Himmel: GOtt, hochkonzentriert, snippt und snippt.
{11} Faust unterschreibt mit dem Füller, hat dabei einen Indianerkopfschmuck auf und Meph trägt einen Cowboyhut.
{12} Himmel: GOtt sagt bedröppelt: »Mist« und sein Sekretät kommentiert trocken: »Versnippt.« — Voila!
•••••
Flix: »Faust. Der Tragödie erster Teil« (2009 als Serie in F.A.Z.; 2010 in Buchform); Mit einem Vorwort von Andreas Platthaus; S/W und Grau, 96 Seiten; Gebunden, Carlen Verlag; ISBN: 978-3-551-78977-8.
China Miéville: »Un Lun Dun« oder: Querfeldein in London diesseits und jenseits des Absurdums
•••
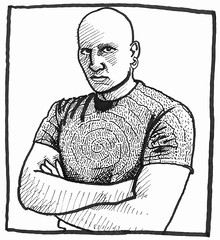 Eintrag No. 610 —Ist man bekennender Fanboy eines Autoren, bekommt man früher oder später Probleme damit, wenn man dessen verschiedene Bücher wertet. Kaum ein Schriftsteller bewegt sich auf einem ständig gleichbleibenden Exzellenzniveau (außer natürlich jenen, die sich im marktgefälligen Mittelmaß behaglich festgeschrieben haben), vor allem dann nicht, wenn besagte Schriftsteller gerne neue Wege einschlagen und zu vermeiden trachten, dass ihre einzelnen Werke sich einander zu ähnlich geraten.
Eintrag No. 610 —Ist man bekennender Fanboy eines Autoren, bekommt man früher oder später Probleme damit, wenn man dessen verschiedene Bücher wertet. Kaum ein Schriftsteller bewegt sich auf einem ständig gleichbleibenden Exzellenzniveau (außer natürlich jenen, die sich im marktgefälligen Mittelmaß behaglich festgeschrieben haben), vor allem dann nicht, wenn besagte Schriftsteller gerne neue Wege einschlagen und zu vermeiden trachten, dass ihre einzelnen Werke sich einander zu ähnlich geraten.
Nein, damit sei keine Apologie angestimmt, die schönreden soll, dass dem englischen ›Weird Fiction‹-Jungmeister China Miéville (*1972) ein Roman missglückt ist, oder dass meine Fan-Erwarungshaltung mehr oder minder eklatant enttäuscht wurde. Aber dennoch muss ich eingestehen, dass mich »Un Lon Don« als Story nicht so wohlig-bratzig überwältigt hat, wie seine drei enormen Bas-Lag-Romane »Perdido Street Station«, »The Scar« und »Iron Council«. Kunststück, denn Bas-Lag wird wohl noch sehr lange einen ganz besonderen Platz nahe meines heiß lodernden Phantastik-Afficionadoherzens innehaben. Die Karten auf den Tisch gelegt kann ich also (leider) sagen: wie schon Miévilles Debüt »König Ratte« oder die ein oder andere Kurzgeschichte der Sammlung »Andere Himmel« durchbricht »Un Lon Don« keine Extraschallmauern der Qualität. Aber immerhin: besagte Ambition, mit jedem Buch etwas wirklich anders anzupacken verhilft auch »Un Lon Don« dazu als lesenswert gelten zu dürfen. Das Neue, das China diesmal wagt, ist, dem äußerst populärem Genre der Abenteuer-Phantastik für Jungleser zuzuarbeiten (oder wie es auf Neudeutsch genannt wird, der ›Jung Adult‹-Sparte), und wenn ich mich umschaue, was ich in den letzten Jahren auf diesem Gebiet mitbekommen habe, dann kann ich »Un Lon Don« als eine durchaus gelungene Bereicherung dieses wildwuchernden Gefildes würdigen.
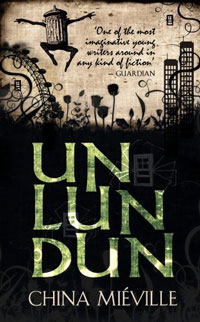 In der Danksagung erwähnt Miéville viele Namen, aber ein paar sind mir besonders aufgefallen und eignen sich, Inhalt und Gebaren des Buches zu skizzieren: Clive Barker, mehr aber noch Michael de Larrabetti und Neil Gaiman haben dem im »Un Lon Don« angestimmten Thema eines phantastischen, seltsamen Anderswelt-London in ihren Werken bereits ausführlich zugearbeitet. Unschwer zu erkennen war für mich die Inspiration, die Neil Gaimans »Neverwhere« auf Chinas neustes Buch hatte, gibt es doch auch dort neben dem ›normalen‹ Allltags-London (London Above) ein befremdliches, undurchschaubar-magisches Neben-London (London Below) in dem sich vor allem aus dem Rahmen des Gewöhnlichen herausgefallene Figuren (und Monster) aus allem möglichen Gefilden der Vergangenheit und Stadtlegende tummeln. — Der Tradition von Michael de Larrabetti (von dem Miéville bereits als Jugendlicher selbst ein großer Fan war, wie ein in »Pandora 2« abgedruckter Text von China belegt) folgt »Un Lon Don« insofern, als dass es auch bei Larrabettis grandiosen Klassiker »Die Borribles« um ungezähmte Jugendliche geht, die gegen die Borniertheit und Gier der Autoritäten und besser gestellten Klassen aufbegehren. — Eine Überraschung war dann, auch den Namen des verehrten Zamonien-Meisters Walter Moers in der Danksagung zu erspähen. Doch eigentlich kein Wunder, denn einige seiner Zamonien-Wälzer wurden in den letzten Jahren ins Englische übersetzt (übrigens: lustig zu lesen), und dass China Miéville begeistert ist von Moers’ rand- und bandloser Frechdachsphantastik passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem, die Art und Weise wie sich bei Moers Erzählung und Illustrationen brillant ergänzen hat es Miéville angetan und wohl unter anderem davon beflügelt hat er sich getraut selber zum Zeichenstift zu greifen und »Un Lon Don« ausführlich zu bebildern. Ein Hoch auf den Bastei Verlag, dass diese Illus auch in der deutschen Ausgabe geboten werden (wohingegen leider das Titelbild von Arndt Drechlser gröblichst enttäuscht).
In der Danksagung erwähnt Miéville viele Namen, aber ein paar sind mir besonders aufgefallen und eignen sich, Inhalt und Gebaren des Buches zu skizzieren: Clive Barker, mehr aber noch Michael de Larrabetti und Neil Gaiman haben dem im »Un Lon Don« angestimmten Thema eines phantastischen, seltsamen Anderswelt-London in ihren Werken bereits ausführlich zugearbeitet. Unschwer zu erkennen war für mich die Inspiration, die Neil Gaimans »Neverwhere« auf Chinas neustes Buch hatte, gibt es doch auch dort neben dem ›normalen‹ Allltags-London (London Above) ein befremdliches, undurchschaubar-magisches Neben-London (London Below) in dem sich vor allem aus dem Rahmen des Gewöhnlichen herausgefallene Figuren (und Monster) aus allem möglichen Gefilden der Vergangenheit und Stadtlegende tummeln. — Der Tradition von Michael de Larrabetti (von dem Miéville bereits als Jugendlicher selbst ein großer Fan war, wie ein in »Pandora 2« abgedruckter Text von China belegt) folgt »Un Lon Don« insofern, als dass es auch bei Larrabettis grandiosen Klassiker »Die Borribles« um ungezähmte Jugendliche geht, die gegen die Borniertheit und Gier der Autoritäten und besser gestellten Klassen aufbegehren. — Eine Überraschung war dann, auch den Namen des verehrten Zamonien-Meisters Walter Moers in der Danksagung zu erspähen. Doch eigentlich kein Wunder, denn einige seiner Zamonien-Wälzer wurden in den letzten Jahren ins Englische übersetzt (übrigens: lustig zu lesen), und dass China Miéville begeistert ist von Moers’ rand- und bandloser Frechdachsphantastik passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem, die Art und Weise wie sich bei Moers Erzählung und Illustrationen brillant ergänzen hat es Miéville angetan und wohl unter anderem davon beflügelt hat er sich getraut selber zum Zeichenstift zu greifen und »Un Lon Don« ausführlich zu bebildern. Ein Hoch auf den Bastei Verlag, dass diese Illus auch in der deutschen Ausgabe geboten werden (wohingegen leider das Titelbild von Arndt Drechlser gröblichst enttäuscht).
Die schöne Zenna und die unauffälligere Debba sind beste Freundinnen und geraten langsam – durch mysteriöse Ereignisse, Unfälle wie auch durch die eigene Neugier – in eine verdrehte Welt jenseits des ›Absurdum‹ (engl. ›The Odd‹), nach Un Lon Dun. Alle Städte unserer Welt haben so ein seltsam-verdrehtes Zwillingsgeschwister, genannt Visavistädte: Lost Angeles, No York, Hongkaum und so weiter. Alles was in den wirklichen Metropolen dem Vergessen anheim gefallen ist, was verloren, aussortiert, abgeschafft, zerstört oder nie umgesetzt wurde, kommt in diesen Visavistädten mehr durcheinander als geordnet zusammen. Ganze Häuser werden in Un Lon Don aus entsprechendem Zeug zusammenimprovisiert, aus ›Graffel‹ (im Englischen: ›Moil‹ für ›mildly obsolete in London‹[01]). So werden zum Beispiel kaputte Hubschrauber zu Windmühlen umfunktioniert, oder ganze Gebäude aus nicht mehr funktionierenden Radios oder Schallplatten errichtet. Ein alter, überwunden geglaubter Schrecken, der Smog, ein zu Bewusstsein und Ambition gekommenes Abgaswolkenmonster, bedroht Un Lon Don und laut der Prophezeiung eines keineswegs unfehlbarem (aber ziemlich eitlem) Orakelbuches ist Zenna die Auserwählte Heldin, die den Smog besiegen wird.
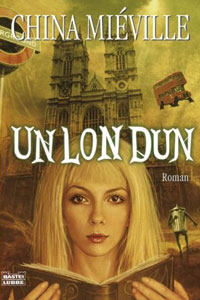 Nun bin ich in der Zwickmühle, nicht offen loben zu können, ohne tolle Kniffe der Handlung zu verraten. So viel sei angedeutet, dass Miéville einigen Fantasy-Konventionen, die sich über die Jahre zur plattesten Routine eingeschliffen haben, gehörig vors Knie tritt und sie erfrischend kritisch ummodelt. Auf den Müll also mit empörendem Auserwähltheits-Schmu, weg mit der sanft-paternalistischen Allwissenheit von Magiern und ihren sprechenden Zauberartefakten, und wie ich finde am brillantesten: hinfort mit der beleidigenden Vorstellung vom Helden-›Sidekick‹ (übersetzt als ›Randfigur‹). Auch habe ich mich köstlich amüsiert, wie im Laufe der Abenteuer das Konzept der Queste genüsslich-brachial demontiert wird. So sehr ich den solcherart vermittelnden Appellen nickend zustimmen kann (Warte nichts auf das Schicksal, sondern gestalte nach nach eigenem Wissen und Gewissen die Welt; Nimm von bestimmungsmächtigen Autoritäten nicht alles unhinterfragt hin; Nicht Sinn suchen, sondern Sinn geben ist wichtig), muss ich doch kritisch einwenden, dass bisweilen dieser Impetus des Aufrütteln-Wollens ein wenig zu sehr … nun ja … mit dem Zeigefinger daherkommt. Aber Miéville ist nicht der einzige, dem solche Ausrutscher passieren, denn derartig ins Auge springende Gutmenschen-Lehren trüben auch bei Philip Pullman oder J. K. Rowling ein wenig den Spaß. Und wenn ich mal vergleiche, wie viele verschwatzte Seiten zum Beispiel der Töpferjunge braucht, um seine Message zu wuppen, dann strahlt »Un Lon Don« bemerkenswert helle auf. Wie auch immer, das beherzigenswerte Anliegen von »Un Lon Don« bringt vielleicht folgende Stelle auf den Punkt, wenn Debba sagt:
Nun bin ich in der Zwickmühle, nicht offen loben zu können, ohne tolle Kniffe der Handlung zu verraten. So viel sei angedeutet, dass Miéville einigen Fantasy-Konventionen, die sich über die Jahre zur plattesten Routine eingeschliffen haben, gehörig vors Knie tritt und sie erfrischend kritisch ummodelt. Auf den Müll also mit empörendem Auserwähltheits-Schmu, weg mit der sanft-paternalistischen Allwissenheit von Magiern und ihren sprechenden Zauberartefakten, und wie ich finde am brillantesten: hinfort mit der beleidigenden Vorstellung vom Helden-›Sidekick‹ (übersetzt als ›Randfigur‹). Auch habe ich mich köstlich amüsiert, wie im Laufe der Abenteuer das Konzept der Queste genüsslich-brachial demontiert wird. So sehr ich den solcherart vermittelnden Appellen nickend zustimmen kann (Warte nichts auf das Schicksal, sondern gestalte nach nach eigenem Wissen und Gewissen die Welt; Nimm von bestimmungsmächtigen Autoritäten nicht alles unhinterfragt hin; Nicht Sinn suchen, sondern Sinn geben ist wichtig), muss ich doch kritisch einwenden, dass bisweilen dieser Impetus des Aufrütteln-Wollens ein wenig zu sehr … nun ja … mit dem Zeigefinger daherkommt. Aber Miéville ist nicht der einzige, dem solche Ausrutscher passieren, denn derartig ins Auge springende Gutmenschen-Lehren trüben auch bei Philip Pullman oder J. K. Rowling ein wenig den Spaß. Und wenn ich mal vergleiche, wie viele verschwatzte Seiten zum Beispiel der Töpferjunge braucht, um seine Message zu wuppen, dann strahlt »Un Lon Don« bemerkenswert helle auf. Wie auch immer, das beherzigenswerte Anliegen von »Un Lon Don« bringt vielleicht folgende Stelle auf den Punkt, wenn Debba sagt:
»Wenn Du wüsstest, dass irgendwo was Schlimmes passieren wird, aber die Menschen dort wüssten es nicht und glaubten sogar, es wäre etwas Gutes, aber du weißt, das ist es nicht und du weißt es nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich weißt du es schon, und du wüsstest nicht, wie du ihnen eine Nachricht schicken kannst und du hörst nie etwas von ihnen, deshalb würdest du nie erfahren, ob es geholfen hat, selbst wenn du ihnen eine Nachricht geschickt hättest …«
[02]Trotz der (für Miéville’sche Verhältnisse) leichten Schwächen, beglückt »Un Lon Dun« mit einem enorm kunterbunten Potpourri schräger Figuren, ungewöhnlicher Orte, pfiffiger Dialoge und berraschender Ideen. Meinen Respekt (und einiges Giggeln) heimst zum Beispiel Chinas Geschick ein, wie er ein banales Milch-Tetrapack mit Leben erfüllt; wie die zu Kreaturen gewordenen Wörter des Königs des Fasellandes (die Schwaflinge) rebellisch herumwuseln; wie ein Berufsabenteurer mit einem Vogelkäfig als Kopf (Rene Magritte läßt grüßen) den Protagonisten dabei hilft, ihren Weg durch ein Haus zu bahnen, in dem sich ein veritabler Dschungel samt Gewässern voller Piranhas befindet; wie aus alten Autos Boote und aus Büchern Klamotten gemacht werden; wie Extremlibristinnen von ihrem gefährlichem Job an den Innenhängen des Bücherturms erzählen; wie Mülltonnen als Elite-Kämpfer umherhüpfen (Englisch: ›Binjas‹). Was den Verlauf angeht, ist »Un Lon Don« bis auf den sich sachte in die Welt jenseits des Absurdum hineinsteigernden Beginn des Buches, eine gehörig atem- und ruhelose Hatz.
Ein Beispiel (von vielen möglichen) für die abwechslungsreiche Monsterschar gefällig? Hier die Beschreibung einer Ausgeburt des Smogs (zudem eine kräftige Stelle um das geschickte Händchen von Übersetzerin Eva Bauche-Eppers zu zeigen):
Die Smoglodyten waren fahl wie Leichenwürmer und farblos. Alle hatten sie entweder riesige schwarze, nur aus Pupille bestehende Augen, damit sie im schmutzig grauen Zwielicht des Smogs sehen konnten, oder gar keine. Alle verfügten über irgendeine Anpassung zum EInatmen der giftigen Melange, wie riesige Nüstern oder mehrere von diesen, um den wenigen vorhandenen Sauerstoff aus den Schwaden zu filtern. Deeba entdeckte ein Wesen, das an eine katzengroße Schnecke gemahnte und sie mit einem Strauß Stielaugen beobachtete. Der Rest des Kopfes war eine organische Gasmaske.
[03]Also, wem (mit Gesellschaftsengagement gewürztes) phantastisches Holterdiepolter taugt, besuche »Un Lon Don« und mache sich dann auf, sich einen eigenen Weg zur anderen Seite des Absurdum zu bahnen, um Perdülin, Krankfurt, Über-die-Wuppertal, Kaputtgardt, Entleibtzig, Verbaselt, Ham-wa-nicht-burg, Fortmund, Kainz und die anderen deutschsprachigen Visavisstädte aufzumischen.
•••••
China Miéville: »Un Lun Dun«; Intro, Epilog, 9 Teile mit 99 Kapiteln auf 591 Seiten; mit ca. 100 S/W-Illustrationen des Autors; 521 Seiten; (UK-Ausgabe) Panmacmillan 2007; ISBN: 978-0-230-01627-9.
Deutsche Ausgabe: »Un Lon Dun«; Aus dem Englischen übertragen von Eva Bauche-Eppers;; Bastei Luebbe Taschenbuch 2008; ISBN: 9-7834-0420-5882.
•••••
ANMERKUNGEN:
[01] In etwa:
›ein bisschen überflüssig in London‹. »Moil« bedeutet im Englischen aber auch, »sich {in einer Mine} abrackern«. Miéville, willkommener Pionier der ökologisch unbedenklichen Recycle-Fantasy! •••
Zurück
[02] Kapitel 36, »Zwischen den Zeilen«, S. 204. •••
Zurück
Jesse Bullington: »The Sad Tale of the Brothers Grossbart«, oder: Hexenzauber, Pestdämonen, Nixengesang & zwei Grabräuber auf der Suche nach ganz viel Gold
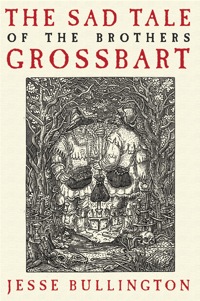 Eintrag No. 603 — Auch wenn ich mittlerweile wegen meines Brotjobs weniger Zeit habe, versuche ich mindestens ein-, zweimal im Monat einige Stunden frei zu machen für Anlese-Sessions im großen örtlichen Buchkaufhaus. Da geraten mir empörend viele Romane in die Finger, die sich offenbar an den so genannten ›Durchschnittsleser‹ wenden. Romane, die ich nach 10 bis 20 Seiten zur Seite lege, weil sie eben, nun ja, zu zahm, zu charakterlos und zu konformistisch sind. Wenn ich mal ich Bock auf solchartig stromlinienförmig-narrative Stangenwahre habe, dann vertraue ich mich lieber Filmen, TV-Stoffen an (und auch Comics; ich sag nur: Schauwerte). Da kann ich es verstehen, wenn Geschichten vor Angepasstheit strotzen, wenn das Produkt nicht zuuuuu schräg und originell sein darf und kann, da hohe Herstellungskosten wieder reingeholt werden sollen und/oder man auf die Befindlichkeiten von Sendern und Werbekunden Rücksicht zu nehmen hat. Bei Literatur hege ich allerdings höhere Ansprüche. Hier erwarte ich, dass sich der eine Macher darum bemüht, eine wirklich eigene, unverwechselbare Stimme und Geschichte zu bieten, und mich nicht langweilt mit Kompromissgedöns.
Eintrag No. 603 — Auch wenn ich mittlerweile wegen meines Brotjobs weniger Zeit habe, versuche ich mindestens ein-, zweimal im Monat einige Stunden frei zu machen für Anlese-Sessions im großen örtlichen Buchkaufhaus. Da geraten mir empörend viele Romane in die Finger, die sich offenbar an den so genannten ›Durchschnittsleser‹ wenden. Romane, die ich nach 10 bis 20 Seiten zur Seite lege, weil sie eben, nun ja, zu zahm, zu charakterlos und zu konformistisch sind. Wenn ich mal ich Bock auf solchartig stromlinienförmig-narrative Stangenwahre habe, dann vertraue ich mich lieber Filmen, TV-Stoffen an (und auch Comics; ich sag nur: Schauwerte). Da kann ich es verstehen, wenn Geschichten vor Angepasstheit strotzen, wenn das Produkt nicht zuuuuu schräg und originell sein darf und kann, da hohe Herstellungskosten wieder reingeholt werden sollen und/oder man auf die Befindlichkeiten von Sendern und Werbekunden Rücksicht zu nehmen hat. Bei Literatur hege ich allerdings höhere Ansprüche. Hier erwarte ich, dass sich der eine Macher darum bemüht, eine wirklich eigene, unverwechselbare Stimme und Geschichte zu bieten, und mich nicht langweilt mit Kompromissgedöns.
In entsprechend lebhaftes Entzücken versetzte mich schon der Beginn des Debüts von Jesse Burlington »The Sad Tale of the Brothers Grossbart«. Bereits der erste Satz (hier in meiner Stegreifübersetzung) faselt nicht um den heißen Brei:
Zu behaupten, die Brüder Grossbart seien grausame und selbstsüchtige Briganten, hieße selbst die garstigsten Wegelagerer zu verunglimpfen, und sie mordlustige Schweine zu nennen wäre gegenüber der dreckigsten Sau noch eine Beleidigung.
Und ich denke nicht, dass ich unbotmäßig viel verrate, wenn ich die 6-einhalb Seiten des ersten Kapitels stichpunktartig zusammenfasse:
Die Zwillinge Manfried und Hegel Grossbart stammen aus einer Grabräuberfamilie. Mama war geistig zurückgeblieben. Papa hat sie mit den Kleinen sitzen gelassen und wurde irgendwo im Norden gelyncht. Ein Onkel hat die beiden erzogen und ihnen das Grabräubern beigebracht. Manfried und Hegel wollen dem Vorbild ihres Großvaters folgen, der es laut Familienlegende bis zu den opulenten Gräbern der Heiden von ›Gyptland‹ geschafft hat. Nun schreibt man das Jahr 1364, und in Bad Endorf wollen sich die Brüder sich für ihre Reise ausstatten, indem sie den Hof des Rübenbauern Heinrich plündern, aus Rache, weil Heinrich einst die rübenstehlenden jungen Grossbarts mit der Schaufel verdroschen hat. Als sie das Haus des Bauern stürmen, greift dessen Frau die Brüder mit einer Axt an. Im Handgemenge bekommt Manfried die Axt zu fassen und erschlägt damit die Frau. Dann haut er beim Stöbern durchs Haus der ebenfalls wehrhaften Tochter die Axt übern Kopf. Heinrich will in die nahe Ortschaft fliehen um Hilfe zu holen, doch die Grossbarts drohen das Haus, in dem sich noch die zwei Babies der Familie befinden, in Brand zu stecken. Heinrich bleibt, doch es nützt nichts: Die Brüder schlitzen dem Sohn vor den Augen seines Vaters die Kehle durch und zünden das Haus an (und die Babies verbrennen mit kläglichen Geschrei), klauen Karre, ein Pferd, Brauchbares aus dem Haus und Rüben und machen sich davon. — Kurz: die ›Helden‹ des Romanes sind richtig finstere Kerle.
Doch nicht nur der Umstand, dass die Hauptfiguren des Romanes brutale, erschreckend rücksichtslose und eigensüchtige Kerle sind ist dazu geeignet sanftere und sich nach kuscheligen Fantasy-Träumen sehnende Leser abzuschrecken. Das 14. Jahrhundert von Jesse Bullington hat so gar nichts mit glatten, sauberen romantischen Mittelalter-Verklärungen gemein (a la »Der erste Ritter« mit Richard Gere), sondern beschwört nach Kräften ein schmutziges, matschiges, grindiges ›finsteres Mittelalter‹ (siehe z. B. »Jabberwocky« von Terry Gilliam). Wenn bei »Brother Grossbarts« gekämpft wird — und es gibt eine Reihe effektvoll und packend inszenierte lange Kampfszenen –, ist das eine blutige und schmerzvolle Sache. Und Bullington ist studierter Historiker und Volkskundler. Gehe ich also mal davon aus, dass er wohlrecherchierte Gründe hat, seinen Lesern ein harsches Mittelalter zusammenzubrauen.
Bullington schöpft aus dem Vollen, was hahnebüchenden Aberglauben und die Grenze zur Häresie übertretenden haarsträubenden (un-)christlichen Glauben betrifft. Das wird ebenfalls früh im Buch anhand einer theologischen Plauderei der Brüder Grossbart im dritten Kapitel offenkundig. Das geht ungefähr so:
Hegel fragt sich, wie es sein kann, dass die Heilige Jungfrau Maria einen gar so verzagten Sohn zur Welt gebracht hat. Immerhin hat sich Jesus am Kreuz nicht ›ehrenvoll‹, sondern wie ein Weichei verhalten. Er hätte einen seiner Peiniger ja wenigstens mal treten können. Manfried erklärt seine theologische Sicht: der HErr wollte Maria schwängern, doch die wollte reine Jungfrau bleiben und ließ den lieben GOtt abblitzen. GOtt schwängerte sie dennoch (und wie Manfried später erklärt, blieb Maria trotzdem weiterhin Jungfrau, denn eine Vergewaltigung zählt ja nicht), und dafür hat sich Maria gerächt, indem sie Jesus zum Waschlappen erzog. Manfried stimmt ein Lob auf die Jungfrau an (Seite 28, Übersetzung von Molo):
»{…} And that’s why She’s holy, brother. Out a all the folk the Lord tested and punished, She’s the only one who got him back, and worse than he got Her. That’s why She intercedes on our behalf, cause She loves thems what stand up to the Lord more than those kneelin to’em.
Und darum ist Sie heilig, Bruder. Von allen Leuten die der Herr geprüft und bestraft hat, ist die Sie die einzige die es im heimgezahlt hat, und zwar schlimmer als er es Ihr besorgt hat. Deshalb setzt Sie sich auch für uns ein, denn Sie liebt diejenigen, die dem Herren die Stirn bieten, mehr als jene, die vor ihm knien.«
Kein Buch also für Leser die ein empfindliches christliches Gemüth haben.
Was gibt’s noch? Ach ja, Monster vom Feinsten! Und die Magie dieses Mittelalters ist stark vom überlieferten Volksglauben geprägt und entsprechend eklig (Eiter, Speichel, Samen und andere übelriechendere Körperflüssigkeiten quellen stellenweise reichlich). — Beeindruckend der Auftritt eines der Hölle entflohenen Pestdämons, der in den Körper eines jungen Reisen geschlüpft ist, wenn er nackt, vor Fieber im kältesten Alpenwinter dampfend auf einem Eber dahergeritten kommt. — Wunderbar die Darstellung der Hexe Nicolette und ihrer wahrhaftig grauenvollen Brut. Nicolette ist ein ganzes Kapitel Vorgeschichte gewidmet, Dank dem diese Widersacherin mehr ist als nur ›böse‹ (na ja, eigentlich kein Kunststück, wenn die Protagonisten selbst von derart zweifelhafter Moral sind, dass sie in den allermeisten Geschichten die besten Übeltäter abgäben). Aber dass Nicolette und ihr Dämonengatte im einsamen Wald die kargen Winter überstanden, indem sie Kinder zeugten die sie dann verspeisten ist schon starker Tobak. Wird aber noch gesteigert, wenn Nicolette zwei frische kleine Monsterbälger mit den über Jahren gesammelten Kinderzähnen versorgt, so dass dieser Brut dann am ganzen Körper gierig schnappende Mäuler wachsen. — Ach ja: eine geheimnisvolle (weil stumme) Nixenschönheit sorgt für (dezente) erotische Wirren, vor allem bei dem sensibleren Manfried.
Neben Wäldern, winterlichen Bergstraßen, menschenverlassenen Klöstern gibt’s zur Abwechslung im weiteren Romanverlauf Abenteuer im frühlingsdurchlüfteten Norditalien und für einige Kapitel sind die Grossbarts im Stadtpalast eines ziemlich rumpeligen Piraten-Kaufmanns in Vendig zu Gast. Schließlich überquert man das Mittelmeer und erreicht Alexandria mit dem christlichen Kreuzzug-Überfallheers unter der Leitung von König Peter I. von Zypern.
Einige Leser haben bemängelt, dass die Episodenfolge des Roman einen etwas ruckelnden Verlauf bildet. Ich fand das keineswegs störend, sondern ließ mich berauschen von der bisweilen munter-knartzigen Sprache und genoss es, mich in ein magisches Mittelalter entführen zu lassen, in dem reichlich ungewöhnliche, sperrigere Figuren auftreten und das mich nicht nervt mit den üblichen langweiligen glatten Typen (der naive Gutmein-Held, die Unschulds-Trulle, der hämische Fiesling, der weise Kuttenopa ect pp ff).
Anfang Dezember 2009 hat Jesse Bullington froh verkündet, dass Bastei Luebbe die Rechte für eine deutsche Ausgabe des Romanes erworben hat. Ich hoffe inbrünstig, dass man für die hiesige Ausgabe der Umschlaggestaltung der englischsprachigen Originalausgaben treu bleibt und das Vexierbild von Istvan Orosz verwendet. Wenn nicht, möge die Heilige Jungfrau mit ihren gerechten Zorn Luebbe strafen!
Ich bin schon gespannt auf Bullingtons zweiten Roman »The Enterprise of Death«, der im November 2010 auf Englisch erscheinen soll und im selben Weltenbau wie die Grossbarts angesiedelt ist, allerdings diesmal zur Barock-Zeit der Spanischen Inquisition, und es soll weniger darum gehen, Gräber zu öffnen und Leut’ in selbige hineinzuprügeln, sondern darum, die Toten aus Gräbern wieder auferstehen zu lassen.
•••
LINK-SERVICE:
Ende November, Anfang Dezember 2009 hat Jesse eine Werktagswoche als Gastautor für das »Amazon«-Bücherblog »Omnivoracious« beigetragen:
•••••
Cherie Priest: »Boneshaker«, oder: Alternativwelt-Seattle 1880 mit Luftschiffen & Zombies
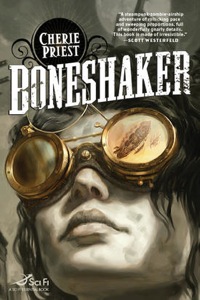 Eintrag No. 601 — Okey, ich geb’s ja zu, dass ich derzeit eine Steampunk-Phase durchmache. Aber ich habe schon länger eine Schwäche für in Alternativ- oder Zweitschöpfungs-Welten angesiedelte Phantastik, welche entsprechend als Inspiration auf das 19. Jahrhundert (plus/minus einiger Generationen früher oder später) zurückgreift. Mir sind Wells und Verne als Väter von Fantasy-Bastards allemal lieber als die üblichen ollen verdächtigen Mittelalter- und Archaik-Schönträumer a la Tolkien. (Eigentlich müsste man mal anfangen ›Tolkien‹ statt Tolkien zu schreiben, besser noch ›McTolkien‹, denn sein Name wird in Phantastik-Argumentationen eh nur als Platzhalter verwendet … auch von mir freilich).
Eintrag No. 601 — Okey, ich geb’s ja zu, dass ich derzeit eine Steampunk-Phase durchmache. Aber ich habe schon länger eine Schwäche für in Alternativ- oder Zweitschöpfungs-Welten angesiedelte Phantastik, welche entsprechend als Inspiration auf das 19. Jahrhundert (plus/minus einiger Generationen früher oder später) zurückgreift. Mir sind Wells und Verne als Väter von Fantasy-Bastards allemal lieber als die üblichen ollen verdächtigen Mittelalter- und Archaik-Schönträumer a la Tolkien. (Eigentlich müsste man mal anfangen ›Tolkien‹ statt Tolkien zu schreiben, besser noch ›McTolkien‹, denn sein Name wird in Phantastik-Argumentationen eh nur als Platzhalter verwendet … auch von mir freilich).
Auf »Boneshaker« von Cherie Priest wurde ich durch Empfehlungen des deutschen Steampunk-Blogs »Clockworker«, Hinweisen von Scott Westerfield und Jeff Vandermeer aufmerksam. Das Buch ist noch nicht auf Deutsch erschienen, die Übersetzungen liefere ich aus dem Stegreif. (Schon mal zum Seufzen, dass die beste Entsprechung für das knappe englische ›Boneshaker‹ das umständlich klingendere aber dennoch schöne ›Mark- und Beinerschütterer‹ ist.)
Zum Glück für den Roman hat mich beim Anlesen im Laden bereits der eröffnende 6-seitige Auszug des in Arbeit befindlichen fiktiven Sachbuchs »Unwahrscheinliche Ereignisse aus der Geschichte des Westens« eines gewissen Hale Quarter aus dem Jahre 1880 überzeugt. In »Kapitel 7: Der seltsame Zustand des ummauerten Seattles« wird prall das Setting vorgestellt: Goldrausch an der Westküste: Entdeckung einer großen Goldader unter Permafrosteis. Seattle ist noch nicht Teil der Vereinigte Staaten. Eine russische Interessensgruppe lobt einen fetten Rubelbetrag für eine Machine aus, die das Gold schürfen kann. Ein Erfinder names Leviticus Blue baut ein Riesenbohrerfahrzeug, verursacht damit 1863 bei einem Testlauf ein ansehnliches Desaster, mit dem das Geschäftsviertel von Seattle lahmgelegt wird. Aus den in den Untergrund gebohrten Tunneln wabert ein schweres Pestgas (engl. ›Blight‹) an die Oberfläche, das massenweise die Leute krepierten läßt und sie zu willenlosen frischfleischgierigen Untoten, vulgo, Zombies macht. Die Überlebenden bauen geschwind eine 61 Meter hohe Mauer um das verseuchte Gebiet und fünfzehn Jahre später setzt die eigentliche Handlung ein.
Fast hätte ich dann bei den ersten vier Kapiteln das Handtuch geschmissen, denn Priest meidet raffende Dramaturgie und läßt sich nicht hudeln, um die Heldin Briar Wilkes und ihren Sohn Zeke vorzustellen. Da wird Arbeitsklamottenausziehen, Essenmachen, jeder Wechsel von einem Zimmer ins andere, fast jede Wendung eines Dialoges mit entsprechender Mimikreaktion und Mimikdeutung beschrieben. — Briar schuftet in einer Wasserfilterungsfabrik im Siedlungsgürtel um das verseuchte Seattle. Als Witwe des verschollenen wahnsinnigen Wissenschaftlers Blue hat sie mit dem Groll der Leute zu ringen. Allerdings war ihr Vater ein legendärer Sherriff, der bei der Blight-Katastrophe sein Leben ließ um Gefängnisinsassen vor dem Tod zu retten. Immerhin sind also einige Leut der zwielichtigen Gesellschaftsschicht ihr wohlgesonnen. Ihr fünfzehnjähriger Sohn Zekes macht die Pubertätsphase durch, nicht auf Authoritäten und Anweisungen hören zu wollen, und bricht gegen den Rat seiner Mutter auf, mehr über seinen Vater zu erfahren, mit dem Ziel in dem ummauerten Seattle Beweise zu finden, um Leveticus Blues schlechten Ruf zu tilgen.
Der Roman steigt dann richtig in die Eisen, kaum dass die Handlung sich ins von Zombiehorden (die hier ›rotters‹, also ›Verwesende‹ genannt werden) geplagten (Ex-)Seattle verlagert. Im Prinzip eine Variation des »Die Klapperschlange«-Motivs. Gesperrtes, mordsgefährliches Gebiet mit lauter hartgesottenen Durchgeknallten; wichtiges Quest-Ziel ist dort zu finden und dann heißt es wieder heil rauszukommen. — Da erscheint mir auch die Ausführlichkeit von Priests Prosa sinnvoll, wenn das Fluchttunnel- und Rettungsleitern-, AntiZombiebarrieren-, Luftschleusen- und Belüftungssystem der Überlebenszonen geschildert wird (übrigens sehr reizvoll wie sehr diese der tödlichen Blight-Gasumwelt abgetrotzten ÜberLebebsräume einer Raumstation gleichen. Buchstäblich die gleiche spannende Athmosphäre wie in Weltraum-Sagas, wo oftmals die Gefahr der lebensunmöglichen Weite des Alls beschworen wird.)
Zeke findet mit einem Tag Vorsprung durch die ehemaligen Kanalisiationstunnel unter der Mauer hindurch seinen Weg in die Stadt. Briar folgt ihrem Sohn, doch muss sie wegen eines die Tunnel zerstörenden Erdbebens mit Hilfe von Luftschiffschmugglern einen Weg über die Mauer finden. — Kein Zweifel: Neben den Zombies ist die waschechte Steampunk-Athmo der Luftschiffe eine der Hauptattraktionen dieses Phantastikweltenbaus. Und so darf der geneigte Genreleser sich auf kernige Männer, exotische Crewmitglieder mit entsprechenden Piratengebahren, Luftkämpfe und Absturztumult freuen. Zu den Besonderheiten des Blights gehört, dass sich aus diesem Unglücksgas eine opiumartige Droge herstellen läßt (die zum Beispiel bei den Soldaten des länger als in unserer Echtwelt andauernden amerikanischen Bürgerkrieges immer größerer Beliebtheit erfreut). Die Luftpiraten machen ein gutes Geschäft als Zwischenhändler dieses Stoffes, und lassen sich deshalb auf den eigentlichen Herrscher des ehemaligen Seattles ein, den geheimisvollen und gefährlichen Dr. Minnericht.
Cherie Priest weiß wirklich überwiegend mit einer gut arrangierten Reihe hervorragend inszenierter Kapitel zu unterhalten. Leider nervte sie mich aber manchmal mit einer Dramaturgie, in der durch den Wechsel der beiden Hauptfiguren, Briar und Zekes, Informationen doppelt und dreifach ausgebreitet werden, und Zufallsbegegenungen und -Ereignisse mir etwas zu oft aus der Klemme halfen oder diese erst bereiteten. Aber als schnell wegzublätternde Zwischendurch- und Unterwegslektüre fand ich »Boneshaker« unterm Strich durchaus gut.
»Boneshaker« ist der erste Roman aus einer Reihe für sich stehender Erzählungen aus der Alternivwelt des »Uhrwerk-Jahrhundert«. Zwar habe ich das Gefühl, dass ich ich, ähnlich wie bei Gordon Dahlquist, schon durch ein Buch gesättigt bin, aber wenn mich die kommenden Romane von Preist beim Anlesen ködern können (Dahlquists Fortsetzung konnte das nicht), greif ich gerne wieder zu.
P. S.: Vor kurzen in die Sparte ›Kunst‹ meiner Linkliste aufgenommen wurde die Website von »Boneshaker«-Coverkünstler Jon Foster.
••••
Jeff Vandermeer: »Finch«, oder: Kriminal-, Rebellen- & Spionage-Wirren in einer von Pilzwesen unterjochten Metropole
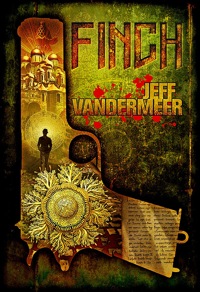 Eintrag No. 599 — Jeff Vandermeer hat es wieder getan! Wie schon bei seinen früheren, in der ›Secondary Creation‹-Welt der Stadt Amber angesiedelten, Büchern »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (engl. 2002 / dt. 2004) und »Shriek: Ein Nachwort« (2006) staune ich über »Finch«, bin durch die Lektüre verstört, hocherfreut und baff zugleich, und stelle respekterfüllt fest, dass sowohl mein Hirn wie mein Herz immer noch am trippen sind. Worum geht es? Hier meine Übersetzung der entsprechenden Passagen aus dem Presse-PDF zum Roman:
Eintrag No. 599 — Jeff Vandermeer hat es wieder getan! Wie schon bei seinen früheren, in der ›Secondary Creation‹-Welt der Stadt Amber angesiedelten, Büchern »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (engl. 2002 / dt. 2004) und »Shriek: Ein Nachwort« (2006) staune ich über »Finch«, bin durch die Lektüre verstört, hocherfreut und baff zugleich, und stelle respekterfüllt fest, dass sowohl mein Hirn wie mein Herz immer noch am trippen sind. Worum geht es? Hier meine Übersetzung der entsprechenden Passagen aus dem Presse-PDF zum Roman:
Was ist Amber?
Es war einmal, an den Ufern des Moth-Flusses, dass eine mächtige Stadt wie keine andere innerhalb oder außerhalb der Geschichte entstand. Gegründet auf dem Blut der ursprünglichen Bewohner, der verstohlenen und nichtmenschlichen Grauhüte, und auf Jahrhunderte durch die Nachwehen dieses Kampfes geformt, war Amber lange ein Zentrum des Handels und der Künste — und der Herrschaft. Nun jedoch, hundert Jahre nach den Ereignissen die in den früheren Büchern geschildert wurden, bricht Amber zusammen unter der Herrschaft der Grauhüte, die sich erhoben und die Stadt unter ihre Kontrolle gebracht und das Kriegsrecht ausgerufen haben. Mit süchtig machenden Pilzdrogen, Internierungslagern und willkürlichem Terror kontrollieren sie Amber während sie an zwei Türmen arbeiten die das Schicksal der Stadt für immer verändern könnten. Die Überbleibsel der Rebellenstreitkräfte sind demoralisiert und verstreut. Partials, menschliche Verräter die durch die Grauhüte verändert wurden, patrouillieren die Straßen und drangsalieren ihre Bewohner.
Welchen Bezug hat »Finch« zu den anderen beiden Amber-Romanen?
Obwohl jeder Amber-Roman für sich selbst steht, bilden die drei Bücher zusammen den »Amber-Zyklus«, eine enorme 1700-Seiten lange Erzählung. Viele Figuren und Themen kommen in allen drei Büchern vor, und »Finch« liefert Antworten auf Fragen zu den Grauhüten und die Natur der Stadt selbst betreffend, die zum ersten Mal in »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« gestellt wurden.
Wie ist Jeff Vandermeer auf die Idee zu Amber gekommen?
»Eines Nachts erwachte ich von einem lebhaften Traum und da war die Stadt in meinem Kopf. Sofort eilte ich zum Computer und schrieb die ersten Seiten der ersten in Amber angesiedelten Geschichte. Seltsamerweise benötigten diese ersten zwei-, dreihundert Worte kaum eine Überarbeitung. Von da an entwickelte sich bald die gesamte phantastische Stadt in meiner Vorstellung. Ich schrieb Erzählungen in diesem Setting, die schließlich zu Teilen von ›Die Stadt der Heiligen & Verrückten‹ wurden, und um 1998 herum hatte ich die groben Konturen des Amber-Zyklus ersonnen. Es dauerte zehn Jahre um die drei Romane zu beenden. Es war mir nie klar, dass ein Augenblick der Inspiration dazu führen könnte einen Vollzeitschriftsteller aus mir zu machen, oder dass er so bestimmend für mein Leben werden würde. Zudem haben mich die Reaktionen von Kritikern, Lesern und Fans Demut gelehrt.«
Betörendes Titelbild: John Coulthart hat ein mich begeisterndes Cover geschaffen. Der Umriss der Pistole macht klar, dass hier mal ›Secodary World‹-Phantastik geboten wird, die näher zu unserer Gegenwart angesiedelt ist als üblicherweise gewohnt. Die goldene Kreuzung aus Koralle, Seestern und Pilz ist ein technisches Gerät der Grauhüte. Im Griff der Pistole sieht man teilweise eine handschriftliche Chronik, ein Hinweis, dass Geheimnisse der Vergangenheit eine Rolle spielen. Im Lauf der Knarre erhebt sich ein Büschel prächtiger Türme, die jedoch überragt werden von einem großen Pilzturm der Grauhüte. Ein Detektiv im Anzug mit Kravatte und Hut (yeah!) kommt aus Schatten auf uns zu (wer meinen Klamottenstil kennt {siehe Kopfschmuck oben} kann sich denken, wie sehr mich das bereits anturnt). Wie es sich für ›Fungal Noir‹ gehört, ist das Cover farblich überwiegend von hübschen Schimmelpilzstrukturen überzogen.
Cooler Aufbau: Die Gegenwarts-Handlung erstreckt sich über eine Woche. Und die 42 Kapitel sind entsprechend auf Montag bis Sonntag verteilt. Montag bis Samstag werden eingeleitet von einem Verhör, dass sich im späteren Lauf der Handlung ereignet. Superspannend, da nicht vorweggenommen wird, wer da den armen Finch in die Mangel nimmt, und weshalb genau. Die auktoriale Erzähler›kamera‹ ist nüchtern immer nah bei Ermittler Finch, hie und da unterbrochen von dessen kursiv gesetzten Gedanken. Gewürzt wird das durch einige ›Handouts‹, sprich, Zeichnungen, Ausschnitten von gefundenen Notizen, Büchern und durch Ermittlungs-Protokolle.
Kecker Genre-Bastard: Krimi, weil es um die Aufklärung eines Doppelmordes an einem Menschen und einem Grauhut geht. Die Opfer werden in einer Wohnung gefunden, scheinen aber seltsamerweise durch einem Sturz aus größerer Höhe gestorben zu sein. Vom toten Grauhut liegt zudem nur der Oberkörper herum. — Spionage- & Polit-Thriller, weil Detektiv Finch bei seinem Versuch die Morde aufzuklären in einen vielstrangigen Konflikte-Knäuel verschiedener Interessensgruppen hineingezogen wird. — Fantasy bzw. Science Fiction, denn es wird Dank der nichtmenschlichen Art der Grauhüte und ihrer Kultur brilliant mit dem Thema Magie/höhere Technik gespielt, entsprechende Gadgets und Monster geboten. — Magischer Realismus und Weird Fiction da die Grenzen zwischen Wahrheit und Schein, Alltag und Transzendentem im Romanverlauf immer mehr verschwimmen und durch steigenden kosmischen Horror die einzelnen klar zu benennenden Phantastik-Genregrenzen solange miteinander kurzgeschlossen werden bis die Funken Sporen blühen. — Kriegs- und Überlebensgeschichte weil die Gegenwartshandlung in einer von Konflikten, Okkupation und Zerstörung gezeichneten Stadt(ruine) spielt, die normale Zivilisation zusammengebrochen ist und man von Tag zu Tag ums Miteinander- und Überleben ringt.
Weitere glänzende Erzählkunst-Facette: Ähnlich wie bei China Miévilles Romanen bin ich beeindruckt, wie Meister Vandermeer Stil und Atmosphäre seiner Bücher sehr gekonnt dem jeweiligen Inhalt anpasst. — »Die Stadt der Heiligen & Verrücken« bot als labyrinthischer Collage-Roman das Vergnügen, dass man sich in einem absichtlich vor barocker Unübersichtlichkeit strotztenden Rummelplatz der Ideen und Perspektiv- und Tonwechsel verliehren konnte. — »Shriek: Ein Nachwort« lud ein, sich auf einen durch die Erzähler Janice und Duncan Shriek geprägten autobiographischen Dialog einzulassen, war entsprechend persönlicher und individueller, näher an diesen Figuren dran. — »Finch« ist nun von der Gradlinigkeit eines ›typischen‹ Krimis geprägt und weiß mit seinem überwiegend knappen, herben Satzbau für sich einzunehmen, aus der die halluzinogeneren wilden Phantastik-Kunststücke um so effektiver hervorwuchern. Wie ein englischer Rezentent richtig bemerkte, gönnt sich »Finch« von allen dreien Amber-Büchern am wenigsten Humor, was aber passt und kein Verlust ist.
Krasser & zugleich berührender Schluß: {VORSICHT!!! Möglicherweise milde SPOILER} Das Ende von »Finch« erinnert mich (im Guten und Besten) wiederum an China Miéville und den Schluß von dessen zweitem ›Bas-Lag‹-Roman »The Scar«, teilweise auch an die Apokalyptik von Alfred Kubins »Die Andere Seite«. — Die Kriminalhandlung wird aufgelöst. Der größere Konflikt zwischen den Grauhüten, den Menschen und noch anderen Fraktionen allerdings nicht (wirklich). Wie es sich für einen ordentlich Phantastik-Roman gehört, kommt es zwar zu einer vorläufigen Überwindung der akutesten Widrigkeiten, aber der größere Handlungsrahmen um das Schicksal der Stadt Ambra mündet dennoch in einer atemberaubenden Entwicklung, durch die ein großes Fenster zu überwältigend vielen Möglichkeiten geöffnet wird. Kurz: richtig große ›Sense of Wonder‹-Portion.
Fazit: Jeff Vandermeer hat wieder mal gezeigt, das ›Fantasy‹ und ›Phantastik‹ als Genres keineswegs reaktionär oder altbacken oder simpel zu sein haben und lediglich dazu taugen Tagtraumvorlagen für kleine Fluchten vom langweiligen und nervigen Alltagstrott zu ermöglichen. Es besteht für mich kein Zweifel, dass er zu jener kleinen Schaar gegenwärtiger Autoren gehört, bei denen man der Phantastik beim Wachsen zuschauen kann. — Ich hoffe natürlich, dass auch diesmal wieder das Team von Klett-Cotta diese Gemme auf Deutsch verlegen wird.
LINK-SERVICE:
Es ist mir ein Rätsel, wie Vandermeer so viel gebacken bekommt, wie er in seinem Blog und anderswo verbreitet. Gut für mich neugierigen Leser, der ich ich gerne einen Blick hinter die Kulissen des Schreibens werfe. In zwei Blog-Einträgen zeigt Jeff uns, wie der Roman »Finch« entstanden ist. Hier: »Finch: What a Novel and Novelist Look Like…« (wieder Mal ernüchternd, dass Autoren die großartige Bücher schreiben, nicht unbedingt eine lesbare, schöne Handschrift haben müssen); und hier: »Finch from Inception to Interior Layout«, mit Einblicken über Probeleser- & Lektoren-Anmerkungen.
Zum zweiten Mal hat Vandermeer einer seiner Lieblingsband dazu verführen können, einen ›Soundtrack‹ zu seinem Roman einzuspielen. Bei »Shriek« war es die Gruppe The Church (nicht soooo mein Ding), und nun für »Finch« hat Murder By Death einen mir sehr gefallenden Score geschaffen. Hier geht es zu einem Interview, das Jeff mit der Band für das Amazon-Blog ›Omnivoracious‹ geführt hat: »Murder by Death on Books, Touring, and The Soundtrack for Finch«
Und schließlich noch die ersten 52 Seiten von »Finch«.
•••••
Victoria Schlederer: »Des Teufels Maskerade«, oder: Freilich bereiten gefühlsduseslige Vampire, Zauberwesen und Revoluzzer nur Scherereien
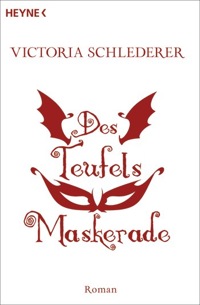 Eintrag No. 596 — Heyne/Randomhouse hat einen Wettbewerb veranstaltet, bei dem ein Debüt-Werk zum ›magischen Beststeller‹ gekürt werden sollte. Da wurde in den Genre-Phantastikgefilden geunkt und sich davor geforchten, was für ein Schmarrn letztlich dabei rauskommen würde.
Eintrag No. 596 — Heyne/Randomhouse hat einen Wettbewerb veranstaltet, bei dem ein Debüt-Werk zum ›magischen Beststeller‹ gekürt werden sollte. Da wurde in den Genre-Phantastikgefilden geunkt und sich davor geforchten, was für ein Schmarrn letztlich dabei rauskommen würde.
Nicht noch ein Buch mit im Boden steckenden Schwert oder schicksalsumflorten Kuttentypen auf dem Umschlag!
Nicht noch ein klischeetriefender Fantasy-Rassenbackförmchen-Schmuh!
Ermarmen!!!
Aber nein: Die Juryrichter hatten erfreulicherweise Erbarmen, ein glückliches Händchen und pickten aus den geschätzten drei Millionen eingereichten Manuskripten eines als Sieger heraus, das sich angenehm von den platten Modeströmungen der Genre-Phantastik abhebt.
Am meisten hat mich an »Des Teufels Maskerade« erstaunt, wie dieser Roman sich auf seine Figuren, deren Gefühlslagen und Konversationen konzentriert und Erwartungen zuwiderläuft, man bekäme einen atemlosen und äktschenreichen Abenteuergarn geboten. Halsbrecherische Ereignisse sind rar in diesem Roman, und wo sie sich dennoch ereignen, werden sie erfrischend unkonventionell knapp und fast schon lapidar abgehandelt.
Im Zentrum des Lesevergnügens stehen die Mitglieder einer kleinen Detektei, welche sich auf okkulte Fisimatenten spezialisiert hat, und die ungewöhnlichen Vorkommnisse in die sie im Sommer 1909 zu Prag und Wien verstrickt ist.
Da ist der Chef der Truppe, der etwas verlebte ehemalige Hauptmann, nun ein Automobilnarr, Dejan Sirco; sein pedantischer Kompagnion Lysander Sutcliffe, ein durch magische Eskapaden im Körper eines Otters befindliche ehemalige Geist eines englischen Adeligen des 16. Jahrhunderts; sowie der beflissene Ex-Straßenjunge und jetztige ungestüme Filius der Detektei Mirko Zdar. Zum Quartett wird die Gruppe mit der resoluten und auf Benimm pochenden Bordellbetreiberin Esther, für mich die stärkste Figur des Romans und allein schon die Lektüre wert, so wie Victoria Schlederer vor allem diese Esther, und auch andere Figuren, glänzend in für Piefkes (= nichtalpenländische Deutsche) verständlich aufbereiteten K.&K.-Duktus parlieren läßt, was z.B. so klingt (S. 48):
»{…} Den sollten’S sehen, ganz voll Narben, an Stellen, wo man sich denkt, na, das tut doch weh …«
Leichte Abstriche muss ich machen, da der Handlungsverlauf bisweilen paradoxerweise auf mich zugleich beliebig und forciert wirkte, einige Szenen allzu plötzlich als Fremdkörperepisoden aus dem Gefüge herausragen und öfter als verzeihlich der Zufall oder neue Figuren die Handlung vorantreiben.
Trotzdem: als ›leichte (jedoch nicht ›platte‹) Lektüre‹ für Zwischendurch und Unterwegs für mich ein empfehlenswerter Roman und ein Debüt, dem ich gerne meinen neidvollen Respektes angedeihen lasse. Ich hoffe, Frau Schlederer wird in Zukunft weiteren feinen Garn für das Lektüregewebe historischer Alternativwelt-Phantastik spinnen, das ich durch Autoren/Autorinnen wie Gorden Dahlquist, Ju Honisch, Susanna Clarke, Ian R. MacLeod und Mark Frost zu schätzen gelernt habe.
•••••
 Eintrag No. 652 — Vor zwei Jahren habe ich von meinem Entzücken über die mannigfaltigen Mimikri- und Formenspielereien berichtet, die Jeff Vandermeer in seinem seltsamen Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« veranstaltet. Als jemand, der sich in zupass kommenden Musen-Stimmung sehr gern auf derartig verknobelte Verkleidungs- und Verschachtelungsgrillen einlässt, befriedigt es mich außerordentlich, mit welch großer Aufmerksamkeit (und oft auch mit welch ansteckenden Elan und/oder erhellendem Geschick) sich in den verschiedensten Medien Mark Z. Danielelwskis (*1966) monströsem »Das Haus« gewidmet wurde. Das ist um so erstaunlicher, da dieses Buch seinen Lesern äußerst fiese hermeneutische Spanische Stiefel umschnallt. Mit fortlaufender Lektüre wird der ›Schmerz‹ den Verwirrung und Undurchdringlichkeit zeitigen immer heftiger, und bescherte zumindest mir wonnigliches Ungemach. Ja, eine Zeit lang habe ich »Das Haus« pausieren lassen, da es mir Alpträume und Anflüge von Beklemmung bereitete (was aber meinerseits nicht zu Abneigung gegenüber dem Buch führte, sondern im Gegenteil, meinen Respekt und meine Wertschätzung für Danielewskis Schreibmacht weiter steigerte).
Eintrag No. 652 — Vor zwei Jahren habe ich von meinem Entzücken über die mannigfaltigen Mimikri- und Formenspielereien berichtet, die Jeff Vandermeer in seinem seltsamen Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« veranstaltet. Als jemand, der sich in zupass kommenden Musen-Stimmung sehr gern auf derartig verknobelte Verkleidungs- und Verschachtelungsgrillen einlässt, befriedigt es mich außerordentlich, mit welch großer Aufmerksamkeit (und oft auch mit welch ansteckenden Elan und/oder erhellendem Geschick) sich in den verschiedensten Medien Mark Z. Danielelwskis (*1966) monströsem »Das Haus« gewidmet wurde. Das ist um so erstaunlicher, da dieses Buch seinen Lesern äußerst fiese hermeneutische Spanische Stiefel umschnallt. Mit fortlaufender Lektüre wird der ›Schmerz‹ den Verwirrung und Undurchdringlichkeit zeitigen immer heftiger, und bescherte zumindest mir wonnigliches Ungemach. Ja, eine Zeit lang habe ich »Das Haus« pausieren lassen, da es mir Alpträume und Anflüge von Beklemmung bereitete (was aber meinerseits nicht zu Abneigung gegenüber dem Buch führte, sondern im Gegenteil, meinen Respekt und meine Wertschätzung für Danielewskis Schreibmacht weiter steigerte). Das Buchlabyrinth beginnt mit einer Einleitung aus dem Jahre 1998 von Johnny Turant, einem kalifornischem Tunichgut-Twen der in einem Tattoo-Shop Hilfstätigkeiten verrichtet, kreuzunglücklich in eine ältere Stripperin verknallt ist, und ansonsten mit seinem Kumpel Lude sauf- und auch sonst drogenfreudig durch die Kneipen der Stadt zieht und glücklosen sexuellen Eskapaden nachgeht. Das (für mich) große Hauptthema stimmt bereits der erste Satz an, in dem Johnny schreibt, dass er immer noch Alpträume bekommt. Wovon? — Also: kurz nachdem er von seinem Vermieter rausgeworfen wurde, vermittelt ihm Lude in seinem Mietshaus eine freigewordene Wohnung. Ein exzentrischer alter Mann, ein Katzenopa, ist dort gestorben, und in der nun von Johnny bezogenen Bude dieses Herrn Zampano findet sich eine Kiste mit einem ungeordneten Konvolut unterschiedlichster Manuskriptseiten und Notizen. Johnny macht sich daran, diese Papiere zu sortieren und das Ergebnis bildet den Hauptteil von »Das Haus«, ein Großessay mit dem Titel »The Navidson Record«. Dreiundzwanzig Kapitel umfasst dieses seltsame, über und über mit Fußnoten gespickte Manuskript. Zampano schreibt darin in sehr sachlicher, analytischer und unaffektiver Sprache über den Meisterphotograph Will Navidson, seine Frau Karen Green (ein Ex-Model) und deren beiden Kinder Chad und Daisy[01]. Will hat für seine Photoreportagen über Expeditionen in die Wildnis und in Krisen- und Kriegsgebiete Publizer-Preis-Ruhm einstreichen können, doch nun soll Schluss sein mit gefährlichen Touren. Um die durch Wills oftmalige räumliche Ferne abgekühlte Ehe und die Eltern-Kind-Harmonie zu fördern, ziehen die Navidsons in ein abseits stehendes Haus in der ländlichen Provinz von Virginia. Immer noch ganz Dokumentarjunkie, installiert Will zig Videokameras um in Big Brother-Container-Manier das neue Lebenskapitel einzufangen, um festzuhalten, wie Menschen sich eine neue Umgebung aneignen. Doch ein kosmischer Schrecken von buchstäblich unfassbaren Ausmaßen ist dem Haus, das sie bezogen haben, eigen. Ganz langsam und sachte zieht Danielewski die Unheimlichkeitszwingen fester. Zuerst befindet sich plötzlich in einem Wandschrank eine weitere Tür ins benachbarte Kinderzimmer. Bald darauf stellt sich nach mehrmaligen Vermessen heraus, dass das Haus Innen um einige Inch größer ist als Außen. Bald darauf sind es nicht nur marginale Größenunterschiede, sondern hinter der geheimnisvollen Tür befindet sich auf einmal ein aschgrauer Gang in einen großen Vorraum, von dem aus man eine riesige Halle betritt in deren Mitte eine große Wendeltreppe scheinbar in endlose Tiefen führt und viele weitere Gänge zweigen in ein dunkles Labyrinth aus Korridoren und Zimmern ab. All diese rätselhaften Räume befinden sich im Inneren des Hauses, und sind doch zum verrückt werden vieles umfangreicher als das Haus selbst. Und da sich bei Danielewski dem Leser auch klassische Mythen entgegenräkeln, lauert, wo ein Labyrinth, irgendwo auch ein Minotaurus.
Das Buchlabyrinth beginnt mit einer Einleitung aus dem Jahre 1998 von Johnny Turant, einem kalifornischem Tunichgut-Twen der in einem Tattoo-Shop Hilfstätigkeiten verrichtet, kreuzunglücklich in eine ältere Stripperin verknallt ist, und ansonsten mit seinem Kumpel Lude sauf- und auch sonst drogenfreudig durch die Kneipen der Stadt zieht und glücklosen sexuellen Eskapaden nachgeht. Das (für mich) große Hauptthema stimmt bereits der erste Satz an, in dem Johnny schreibt, dass er immer noch Alpträume bekommt. Wovon? — Also: kurz nachdem er von seinem Vermieter rausgeworfen wurde, vermittelt ihm Lude in seinem Mietshaus eine freigewordene Wohnung. Ein exzentrischer alter Mann, ein Katzenopa, ist dort gestorben, und in der nun von Johnny bezogenen Bude dieses Herrn Zampano findet sich eine Kiste mit einem ungeordneten Konvolut unterschiedlichster Manuskriptseiten und Notizen. Johnny macht sich daran, diese Papiere zu sortieren und das Ergebnis bildet den Hauptteil von »Das Haus«, ein Großessay mit dem Titel »The Navidson Record«. Dreiundzwanzig Kapitel umfasst dieses seltsame, über und über mit Fußnoten gespickte Manuskript. Zampano schreibt darin in sehr sachlicher, analytischer und unaffektiver Sprache über den Meisterphotograph Will Navidson, seine Frau Karen Green (ein Ex-Model) und deren beiden Kinder Chad und Daisy[01]. Will hat für seine Photoreportagen über Expeditionen in die Wildnis und in Krisen- und Kriegsgebiete Publizer-Preis-Ruhm einstreichen können, doch nun soll Schluss sein mit gefährlichen Touren. Um die durch Wills oftmalige räumliche Ferne abgekühlte Ehe und die Eltern-Kind-Harmonie zu fördern, ziehen die Navidsons in ein abseits stehendes Haus in der ländlichen Provinz von Virginia. Immer noch ganz Dokumentarjunkie, installiert Will zig Videokameras um in Big Brother-Container-Manier das neue Lebenskapitel einzufangen, um festzuhalten, wie Menschen sich eine neue Umgebung aneignen. Doch ein kosmischer Schrecken von buchstäblich unfassbaren Ausmaßen ist dem Haus, das sie bezogen haben, eigen. Ganz langsam und sachte zieht Danielewski die Unheimlichkeitszwingen fester. Zuerst befindet sich plötzlich in einem Wandschrank eine weitere Tür ins benachbarte Kinderzimmer. Bald darauf stellt sich nach mehrmaligen Vermessen heraus, dass das Haus Innen um einige Inch größer ist als Außen. Bald darauf sind es nicht nur marginale Größenunterschiede, sondern hinter der geheimnisvollen Tür befindet sich auf einmal ein aschgrauer Gang in einen großen Vorraum, von dem aus man eine riesige Halle betritt in deren Mitte eine große Wendeltreppe scheinbar in endlose Tiefen führt und viele weitere Gänge zweigen in ein dunkles Labyrinth aus Korridoren und Zimmern ab. All diese rätselhaften Räume befinden sich im Inneren des Hauses, und sind doch zum verrückt werden vieles umfangreicher als das Haus selbst. Und da sich bei Danielewski dem Leser auch klassische Mythen entgegenräkeln, lauert, wo ein Labyrinth, irgendwo auch ein Minotaurus.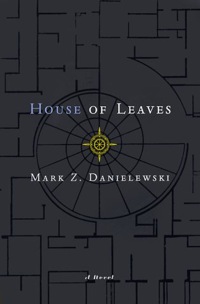 Eine weitere, die Lektüre verkomplizierende Ungebändigkeit von »Das Haus«: Dreimal werden längere Exkursionen in die finsteren Eingeweide des Hauses unternommen, bei denen dann die Buchseiten selbst alle herkömmlichen Formatierungs-Gepflogenheiten hinter sich lassen. Die Unmittelbarkeit und damit einhergehende Beunruhigung (und gottseidank auch manchmal Belustigung und Verblüffung) mit der mir als Leser der Wahn in einer aus zu vielen Zeichen zusammengeballten Dunkelheit auf den Pelz rückte, hat mich in größtes Erstaunen versetzt. Mal kriecht der Text beengt durch schmale Schächte, dann steht er kopfüber, längs oder quer, immer in kunstvoller Analogie zu den im Haus-Labyrinth umherirrenden Figuren[03].
Eine weitere, die Lektüre verkomplizierende Ungebändigkeit von »Das Haus«: Dreimal werden längere Exkursionen in die finsteren Eingeweide des Hauses unternommen, bei denen dann die Buchseiten selbst alle herkömmlichen Formatierungs-Gepflogenheiten hinter sich lassen. Die Unmittelbarkeit und damit einhergehende Beunruhigung (und gottseidank auch manchmal Belustigung und Verblüffung) mit der mir als Leser der Wahn in einer aus zu vielen Zeichen zusammengeballten Dunkelheit auf den Pelz rückte, hat mich in größtes Erstaunen versetzt. Mal kriecht der Text beengt durch schmale Schächte, dann steht er kopfüber, längs oder quer, immer in kunstvoller Analogie zu den im Haus-Labyrinth umherirrenden Figuren[03].