Baltasar Gracian: »Das Kritikon« oder: Ein Monsterschmöcker aus der spanischen Barocke
Eintrag No. 260
Zuerst erschienen in »
MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert. —
EDIT: Um Autorenportrait ergänzt und Formatierung verbessert am 31. Mai 2008.
•••
 — Tausendeinundvierzig Seiten, sechsundzwanzig s/w-Abbildungen, viele hilfreiche Fußnoten, ein ausführliches und anregendes Nachwort inklusive einem Vergleich verschiedener bisheriger Übersetzungen, sowie eine sechszehnseitige ›sprechende‹ (also synopsierende) Inhaltsangabe. »Das Kritikon«: ein Monsterschmöker aus dem spanischen Barock (1651-1657). Klingt nicht nach einem mal so nebenbei und schnell wegzulesendem Buch, sondern nach einem das genug Reichhaltigkeit, Tiefe, Details und Gewitztheit bietet, um den Leser über eine längere Zeitdauer zu begleiten. Nichts weniger als eine überbordende Vorstellung eines Großen Weltentheaters, ein universalsatirisches Panorama breitet der Jesuit Baltasar Gracian (1601-1658) hier aus. Der Autor ist in Deutschland hauptsächlich für sein von Arthur Schopenhauer übersetztes »Handorakel oder Die Kunst der Weltklugheit« bekannt.
— Tausendeinundvierzig Seiten, sechsundzwanzig s/w-Abbildungen, viele hilfreiche Fußnoten, ein ausführliches und anregendes Nachwort inklusive einem Vergleich verschiedener bisheriger Übersetzungen, sowie eine sechszehnseitige ›sprechende‹ (also synopsierende) Inhaltsangabe. »Das Kritikon«: ein Monsterschmöker aus dem spanischen Barock (1651-1657). Klingt nicht nach einem mal so nebenbei und schnell wegzulesendem Buch, sondern nach einem das genug Reichhaltigkeit, Tiefe, Details und Gewitztheit bietet, um den Leser über eine längere Zeitdauer zu begleiten. Nichts weniger als eine überbordende Vorstellung eines Großen Weltentheaters, ein universalsatirisches Panorama breitet der Jesuit Baltasar Gracian (1601-1658) hier aus. Der Autor ist in Deutschland hauptsächlich für sein von Arthur Schopenhauer übersetztes »Handorakel oder Die Kunst der Weltklugheit« bekannt.
Die rote Faden der Handlung des »Kritikons« ist schnell zusammengefaßt: Auf eine Insel gespült, trifft Critilo (ein Mann aus den Ostindischen Kolonien) auf Andrenio, einem Findelkind der Wildnis, ein Vorläufer von Defoes Freitag oder Kiplings Mowgli. Andrenio macht sich als lernbegieriger Schüler und treuer Begleiter Critilos mit diesem auf die Suche nach dessen verschollener Geliebter Felisinda. Die Reise von Critilo und Andrenio führt im geographischem Sinn durch die europäischen Kernländer, im übertragenem Sinn durch verschiedene symbolhafte Distrikte. Zu Beginn beispielsweise begegnen sie einer vielköpfigen Kinderschar, die von einer großen Frau zu einem Gebirgszug geleitet wird. Die Frau gibt den Infanten (= ›die noch nicht sprechen können‹) in all deren Wünschen nach und verhätschelt sie und führt sie dennoch wissentlich den aus den Bergen stürzenden Ungeheuern und Bestien zu. Ein spöttisches Bild auf die Erziehungsbemühungen von Elterngenerationen.
Unterhaltung und hohe Kunst waren im Barock noch nicht auf heutige Weise getrennt, und so ist »Das Kritikon« vom Anspruch her ein sehr ernsthaftes, zugleich aber im Auftreten ein sehr burleskes Buch. Bei der Gestaltung des Romans folgte der Jesuitengelehrte Gracian unter anderem diesen drei Überlegungen:
- Der christlichen Vorstellung des Lebens als Pilgerreise zum Seelenheil; der Mensch als Fremdling in der trügerischen Welt. Ein wichtiges Thema auch der Fantasy, man denke nur an Frodos Reise nach Mordor. Durch die Landschaften des Frühlings der Kindheit, des Sommers der Jugend, des Herbstes des Mannesalters und des Winters des Alters geht die Reise des vollständigen Menschen, der durch das Wechselspiel der Figuren Critilo (der geistvolle, erfahrenere Mann) UND Andrenio (der naive Naturjüngling) dargestellt wird. Auf dieser Reise werden die beiden oftmals von kundigen Führern (z.B. dem Chentaur Chiron oder dem Wandler Proteus) geleitet.
- Der Gegensatz von Täuschung (Wahnbefangenheit) und Enttäuschung (Wahnzerstörung), umfassend visualisiert in (alp)traumhaften Bildwelten, halluzinogenen Landschaften und Allegorie-Montagen des innigen Hieronymus-Bosch-Verehrers Gracian. Der verdrehten, verkehrten Welt — als die Gracian seine tubulente Zeit (sprich: die sich in der ersten Euphorie der terrestischen Globalisierung aufmachende Moderne) erlebte —, will er mit ihren eigenen Mitteln zu Leibe rücken. So wohldurchdacht der große ›belehrende‹ oder ›seelenförderliche‹ Bogen des Buches ist, so wirbeln im Detail verschrobene Sichtbarmachungen, rätselhafte Verschlüsselungen, ausgefallene Gedankenspiele, Übertreibungen und frappierende Pointen drucheinander, die mit Sprachwitz und Tollheit aus vielerlei unterschiedlichsten Inspirationsquellen zusammengetragen wurden.
- Die Vermittlung von Lebensweisheit und Ein-Sicht, die die Grundlagen für die Entwicklung zur ganzen Person bilden. Gracian stimmt hier als einer der ersten das Thema vom kalt analysierenden, antiutopistisch gestimmten Helden an, der ganz dem ungeschriebenen elften Gebot ›Du sollst dich nicht täuschen‹ (bzw: ›täuschen lassen‹) zu folgen trachtet.
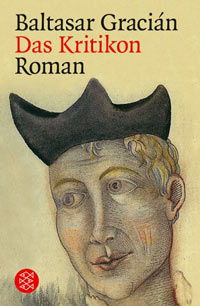 Oberstes Stilkriterium für einen guten Text war damals die Fähigkeit eines Autors zur scharfsinnigen Rede, und obwohl die Sinnes- und Erscheinungswelt für Gracian trügerisch und größtenteils von Übel ist, stellt er klar fest, daß ein schönes Geplauder in angenehmer Atmosphäre ein löbliches Vergnügen ist. Subversion ›schon‹ in dieser alten Zeit, wenn Gracian also weiß, daß ohne den Köder des gut Unterhaltenden man gar nicht erst anzufangen braucht, den Menschen Lebensweisheit und Kultiviertheit vermitteln zu wollen.
Oberstes Stilkriterium für einen guten Text war damals die Fähigkeit eines Autors zur scharfsinnigen Rede, und obwohl die Sinnes- und Erscheinungswelt für Gracian trügerisch und größtenteils von Übel ist, stellt er klar fest, daß ein schönes Geplauder in angenehmer Atmosphäre ein löbliches Vergnügen ist. Subversion ›schon‹ in dieser alten Zeit, wenn Gracian also weiß, daß ohne den Köder des gut Unterhaltenden man gar nicht erst anzufangen braucht, den Menschen Lebensweisheit und Kultiviertheit vermitteln zu wollen.
Man läßt sich hier also auf einen ziemlich skurrilen Text aus alter Zeit ein. Das größte Hindernis dürfte dem heutigen Leser dabei Gracians tiefe Verachtung der Frauen sein. Muß man nicht so ernst nehmen und an sich rannlassen, der Mann war immerhin Jesuit. Hochgläubige Monotheisten aller Coleur pflegen ja mitunter pekuliare Ansichtung & Praktiken Geschlechtliches und Körperliches betreffend. Dank der hervorragenden Übersetzung und den erhellenden Fußnoten von Hartmut Köhler findet man sich mit etwas Geduld bald in dem ausufernden und abschweifenden — Voltaire urteilte abschätzig ›harlekinhaften‹ — Text zurecht, und dann hat man auf lange Zeit gute Lektüre, denn …
… wer gerät nicht außer sich, wenn er ein so einmaliges Konzert vernimmt, einen Zusammenklang aus so viel Entgegengesetztem. (Seite 43)
•••
Das Kritikon (El Kritikon; erstmal erschienen 1651 bis 1657) aus dem Spanischen übersetzt und kommentiert von Hartmut Köhler, mit einem Nachwort von Hans-Rüdiger Schwab; Zeittafel, Personen- und Sachregister; 26 Abbildungen; 1041 Seiten.
Gebunden im Schuber & mit Lesebändchen, Ammann-Verlag, Zürich 2002; ISBN: 3-250-10437-x
Taschenbuch bei Fischer, Frankfurt 2004; ISBN: 978-3-596-15902-4
Jürgen Lodemann: »Siegfried und Krimhild« oder: Aus der Mitte Europas
Eintrag No. 259
Zuerst erschienen in »
MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert. —
EDIT: Um Autorenportrait ergänzt und Formatierung verbessert am 31. Mai 2008.
•••
Die älteste Geschichte aus der Mitte Europas
im 5. Jahrhundert notiert, teils lateinisch, teils in der Volkssprache,
ins irische Keltisch übertragen
von Kilian Hilarus von Kilmacduagh
im 19. Jahrhundert von John Schazman ins Englische,
ins Deutsche übersetzt, mit den wahrscheinlichen Quellen
verglichen und mit Erläuterungen versehen
von Jürgen Lodemann
So lautet der komplette Nebentitel dieser großartigen Neufassung der Geschichte des Nibelungenlieds. Kilian und Schazman sind dabei ebenso fiktiv, wie die durch sie auf Lodemann gekommene Urfassung der Nibelungen.
 Zwanzig Jahre Recherchen und Schreibarbeit hat Jürgen Lodemann (1936) in den Roman »Siegfried und Krimhild« investiert. Er ist sonst eher bekannt als Gründer der SWF-Bestenliste, einer meinungsgeben Plattform im deutschen Literaturbetrieb.
Zwanzig Jahre Recherchen und Schreibarbeit hat Jürgen Lodemann (1936) in den Roman »Siegfried und Krimhild« investiert. Er ist sonst eher bekannt als Gründer der SWF-Bestenliste, einer meinungsgeben Plattform im deutschen Literaturbetrieb.
Da freu ich mich freilich, wenn ein solch repektabler Autor noch dazu mit den nötigen Schreibmuskeln gesegnet geduldig der Forderung Goethes nachkommt, aus den Nibelungen ein spannendes Volksbuch zu machen. Früh schon erkannten damals begeisterte Leser, daß man diese »älteste Geschichte aus der Mitte Europas« in einer Liga mit den großen Stoffen der Antike anzusiedeln kann.
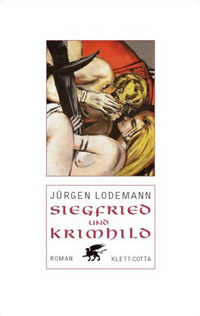 Jedoch: Krasse Verdrehung wie der Mär von der Nibelungentreue der Nazis oder völlige Entleerung wie bei der Wormser Festspiel-Wurschtigkeit läßt bis heute für viele eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Epos anrüchig und suspekt erscheinen. Obwohl ihm das von einigen Kritikern attestiert wird, stellt Lodemanns Buch aber keine simple Gegenüberstellung von widersprechenden Weltauffassungen dar.
Jedoch: Krasse Verdrehung wie der Mär von der Nibelungentreue der Nazis oder völlige Entleerung wie bei der Wormser Festspiel-Wurschtigkeit läßt bis heute für viele eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Epos anrüchig und suspekt erscheinen. Obwohl ihm das von einigen Kritikern attestiert wird, stellt Lodemanns Buch aber keine simple Gegenüberstellung von widersprechenden Weltauffassungen dar.
Das seit Umberto Ecos »Der Name der Rose« bewährte (postmoderne) Verfahren der Vermengung von Fakten mit fiktiven Quellen nutzt Lodemann, um seine politischen und dramatischen Spekulation enger am Ideal historischer Authenzität entlang zu gestalten.
Die Szenenfolge der Geschichte stehen ja fest: Siegfrieds Heldentaten im Dienste des Wormser Hofes; seine Liebe zu Krimhild und die Beihilfe, die er ihrem Bruders Gunther bei der Brautwerbung um Brünhilde leistet; die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Bräuten Krimhild und Brünhild; der Verrat an Siegfried und seine Ermordung durch den Wormser Heermeister Hagen; der Wahnsinn der trauernden Krimhild und ihre Heirat mit Etzel; Krimhilds Rache an den Mördern Siegfrieds und das Blutbadfinale im Saalbrand. So klar die Taten beschrieben sind, so unklar bleiben größtenteils bis heute die Beweggründe der Figuren, die Hintergründe der Geschehnisse. Eine (eindeutige) Urfassung aus der Zeit der Ereignisse wird zwar von der seriösen Forschung inzwischen als sehr wahrscheinlich angenommen, aber (noch) ist sie nicht gefunden worden. So schildern die drei bedeutendsten der uns bekannten Quellen aus der Zeit um 1200 bereits zeitgeschichtlich gefärbte Versionen der Geschichte, z.B. lassen sie Siegfried mal als naiven Gutmenschen, mal als heidnischen Tölpel erscheinen.
Die Deutung der Ereignisse, die Lodemann anbietet, ist so unerhört und abwegig nicht. Auf der einen Seite stehen die lateinisch-christlichen Herren, auf der anderen die Heiden von jenseits der Reste des römischen Reiches. Das Machtstreben der heiligen Mutter Kirche und die Nulltoleranz gegenüber naturreligiösen Freidenkern bietet eine Schnur, auf der Lodemann die einzelnen Stationen des Nibelungenliedes überzeugend aufzufädeln weiß. Die politische These und Tendenz des Buches manifestiert sich vielleicht am klarsten in der einzigen großen Hinzudichtung von Lodemann, Bischof Ringwolf, dem eigentlichen Machthaber zu Worms.
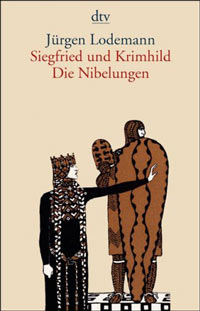 Der zweifarbige Schriftsatz (wie eine Simultanübersetzerstimme folgen in Rot die Übersetzungen etwa lateinischer Begriffe, sowie geographische, geschichtliche, mythologische und ethymologische Erläuterungen) ist gewöhnungsbedürftig, macht das Buch aber nebenbei zu einer unterhaltsamen gegenwartsbezogenen Gesellschaftskritik. Zumindest ich kann nicht sagen, daß Lodemann sich ein endgültiges, einseitiges Urteil gönnt sich , vielmehr hütet er sich aus den geschilderten Gegensätzen einen manichäischen Konflikt zu machen und läßt das Heldentaten-Buch, die Megatragödie melancholisch und ehrfürchtig ausklingen.
Der zweifarbige Schriftsatz (wie eine Simultanübersetzerstimme folgen in Rot die Übersetzungen etwa lateinischer Begriffe, sowie geographische, geschichtliche, mythologische und ethymologische Erläuterungen) ist gewöhnungsbedürftig, macht das Buch aber nebenbei zu einer unterhaltsamen gegenwartsbezogenen Gesellschaftskritik. Zumindest ich kann nicht sagen, daß Lodemann sich ein endgültiges, einseitiges Urteil gönnt sich , vielmehr hütet er sich aus den geschilderten Gegensätzen einen manichäischen Konflikt zu machen und läßt das Heldentaten-Buch, die Megatragödie melancholisch und ehrfürchtig ausklingen.
Diese Nibelungen sind mehr als eine willkürliche Vermengung von wilden Helden- und blutrünstigen Rachegeschichten. Bemerkenswert ist zudem, mit welch großer Sprachfreude und atemberaubender Vorstellungskraft »Siegfried und Krimhild« geschrieben ist. Hier wird spannend und kenntnisreich sichtbar gemacht — und nichts anderes bedeutet das Wort ›phantastisch‹.
•••
Siegfried und Krimhild: Zweifarbige Typographie; 886 Seiten.
Gebunden mit Lesebändchen; Klett-Cotta, Stuttgart 2002; ISBN: 978-3-608-93548-6
Taschenbuch bei DTV, München 2005; ISBN: 978-3-423-13359-3
»Her mit dem Schwert, ich muß die Welt retten!«, oder: Diana Wynne Jones und ihr »Tough Guide to Fantasyland«
Eintrag No. 230 — Diana Wynne Jones wird in England seit vielen Jahren als Fantasy-Autorin geschätzt. Mit der diesertage in unseren Kinos laufenden Verfilmung von »Das wandelnde Schloß« durch die japanischen Ghibli-Animationsstudios von Meister Miyazaki wird Diana Wynne Jones nun wohl auch bei uns mehr zu einem geläufigen Geheimtip unter Jugendbuch- und Fantasy-Kennern (wer immer das sein mag). Sie hat selbst noch Vorlesungen von J. R. R. Tolkien und C. S. Lewis besucht, und gibt dennoch (oder gerade deshalb) mit »The Tough Guide to Fantasyland« (etwa: »Der herbe Reiseführer nach Fantasyland«) ein humorgeballtes Kontra auf all die zu liebgewonnenen Versatzstücke des Fantasy-Genres.
Lob und Jubel von mir nachträglich für den Bastei-Verlag, der das Buch 2000 unter dem Titel »Einmal zaubern, Touristenklasse« verlegte.
 Wir erinnern uns: In den Fünfizigerjahren des letzten Jahrhunderts erschienen die drei Bände der »Herr der Ringe«-Trilogie von Tolkien. Erwartet hatte man eine Fortsetzung des erfolgreichen Kinderbuches »Der Kleine Hobbit« und bekommen hatte man eine überbordende Super-Queste nach einem Ausweg, um der sich alles unterwerfenden Macht der Moderne zu entkommen. Nicht viel geschah, bis die Hippies in den Sechzigern den zum Großmärchen aufgeblasenen Kriegs-Epos des Kampfes zwischen Gut und Böse für sich entdeckten. Der Meister von Mittelerde selbst war entsetzt über seine neue Leserschaft, die er als ›langhaarige Irre‹ bezeichnete.
Wir erinnern uns: In den Fünfizigerjahren des letzten Jahrhunderts erschienen die drei Bände der »Herr der Ringe«-Trilogie von Tolkien. Erwartet hatte man eine Fortsetzung des erfolgreichen Kinderbuches »Der Kleine Hobbit« und bekommen hatte man eine überbordende Super-Queste nach einem Ausweg, um der sich alles unterwerfenden Macht der Moderne zu entkommen. Nicht viel geschah, bis die Hippies in den Sechzigern den zum Großmärchen aufgeblasenen Kriegs-Epos des Kampfes zwischen Gut und Böse für sich entdeckten. Der Meister von Mittelerde selbst war entsetzt über seine neue Leserschaft, die er als ›langhaarige Irre‹ bezeichnete.
Wer jemals den Disco-Song »Where there is a whip, there is a will« aus der Zeichentrickfassung des »Herren der Ringe« gehört hat, wird Tolkien verstehen können. Hier in Deutschland ist dieses Lied aus der TV-Fortsetzung von Ralph Bashkis Kino-Fassung kaum bekannt.
Wie man's auch nimmt, hat Tolkiens Mittelerde einen enormen Einfluß auf die populäre Kultur. Dieser exzentrische Linguist hat das Erfinden einer eigenen Welt mit einer Ernsthaftigkeit durchgezogen, die es bis dahin nicht gab. Frühere Phantasie-Welten sind im Vergleich zu Tolkien ehr oberflächlich und unverästelt. Niemals zuvor hat ein Autor in diesem Umfang zuerst Kosmologien, Landkarten, Genealogien, Geschichts-Chroniken, Legenden, Lieder, Verse und verschiedene Sprachen erstellt, um erst dann seine Geschichte in dieser Welt zu erzählen. Vor Tolkien blieb entsprechend veranlagten Lesern nur, die Felder der echten Geschichte, der Religionen, Großideologien und der Esoterik zu besuchen, wenn sie sich einer umfassenden literarischen ›Wirklichkeit‹ zwecks Selbstergänzung hingeben wollten.
Bis heute wird diese mächtige Sinnmachmaschinen-Qualität der ›Fantasy‹ von den Hardcore-Verfechtern der sogenannten ›richtigen und ernsthaften‹ Literatur scheel beäugt. Kein Wunder: Haben doch mit dem Fortschreiten des von Tolkien selbst so verachteten Moloch Moderne — der alles in kleine Konsumier-Portionen für Club-Urlaube abpackt — mehr oder weniger geschickte Pauschal-Reiseveranstalter Routen ins Tolkien'sche Terrain etabliert, auf denen die Touristen immer-tröstliche Helden- und Märchengeschichten genießen können.
<a href=""www.amazon.de"">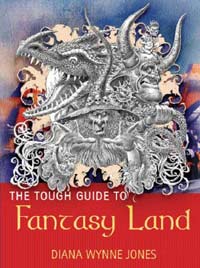 Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.
Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.
So ist keine ›Tour‹ vollständig ohne eine ›Karte‹. Touristen gelangen oft mittels eines ›Portals‹ an ihren ›Ausgangsort‹, zum Beispiel der kleinen Stadt Gna'ash.
Tja, mancher Leser wird bereits von derartig exotischen Ortsnamen wie Gna'ash verwirrt. Von solchen Irritationen rührt viel des schlechten Rufes der Fantasy und Phantastik. Wie gut, daß bereits zu solch grundlegenden Dingen wie ›Apostophen‹ und ›Namen‹ der »Tough Guide« den Fantasy-Unkundigen Verständnishilfe reicht. So gibt es drei Theorien zur Aussprache eines Ortsnamens wie Gna'ash.
1. Man ignoriert den Apostroph und einfach nur das Wort aus. (Dann Gna'ash = Gnash.)
2. Man läßt eine Pause oder Lücke an der Stelle des Apostrophen. (Dann Gna'ash = Gna-ash.)
3. Man macht eine Art Gluckslaut für den Apostrophen. (Dann Gna'ash = Gnaglunkash.) Personen mit unsicher sitzenden Mandeln sollten mit einer der ersten beiden Theorien vorlieb nehmen.
Hat man in Gna'ash das örtliche ›Wirtshaus‹ gefunden, sucht man dort seine Tour-›Gefährten‹ zusammen, ißt seinen ›Eintopf‹, mietet eine ›Kammer‹ für die Nacht und nimmt (wers braucht) an einer ›Kneipenschlägerei‹ teil. Am nächsten Tag kauft man auf dem ›Marktplatz‹ seine ›Kleidung‹ — zu der unbedingt ein ›Kapuzenumhang‹ gehört —, sein ›Schwert‹, ›Pferd‹ und den ganzen anderen Krempel für eine ›Queste‹. Bevor man aufbricht, sollte man noch den ansäßigen ›Magier‹ wegen des Schwertes konsultieren. Immerhin ist der längste Einträg des »Tough Guide« diesen Erz-Gadgets der Fantasy gewidmet.
Nun gehts auf zur großformatigen von ›Mystischen Meistern‹ moderierten Schnitzeljagd durch alle Gebiete die auf der ›Karte‹ zu finden sind. Gewürzt wird diese Schatzsuche nach einem ›Quest-Gegenstand‹ durch schwieriges Terrain und den ›Finsteren Herrscher‹. Hat man nach verschiedenen ›Zwischenfällen‹, ›Konfrontationen‹ und ›Kämpfen‹ das ›Quest-Objekt‹ gefunden, geht man daran, den ›Finsteren Herrscher‹ zu besiegen und/oder packt die ›Weltrettung‹ an. Wie auch immer: im dritten (oder auch fünften) Teil der Trilogie kommt es zum ›Abschluß‹ der Geschichte, siehe ›Geburtsrecht‹, siehe ›Verschollener Thronfolger‹.
Diana Wynne Jones kratzt mit ihren Einträgen zu ›Wirtschaft‹ (Ökonomie, siehe auch ›Stickereiarbeiten‹), ›Umwelt‹ (Ökologie, siehe auch ›Läuse‹) und ›Import/Export‹ an der oberflächlichen Daumenlutscher-Komplexität vieler Fantasy. Die zusammenkonstruierten Handlungen nimmt sie auseinander, indem sie darlegt, daß in ›Fantasyland‹ eben ›Legenden‹, ›Prophezeiungen‹ und ›Träume‹ als Informationsquelle für die ›Helden‹ weitaus zuverläßiger sind als ›Geschichtsschreibung‹. Sprach- und Stilkritik übt sie, wenn sie uns das ›Management‹ der Tour, sowie deren ›Formelle Bezeichnungen der Reiseveranstalter‹ (Official Management Terms) vorstellt. Eine Pest sucht eine Gegegend eben heim und hat Städte im Griff.
Kenner und Liebhaber von Genre-Fantasy können sich über die vielen geistreichen Beobachtungen und trockenen Kommentare abhärten oder aufregen, lachen oder grollen. Allen, die sich selbst in der Kunst der Fantasy-Schriftstellerei und Weltenerfinderei versuchen, empfehle ich den »Tough Guide« zur inniglichen Beherzigung. Jones legt umfangreich die verbreitesten Handgriffe (Fehler) für öd-gewöhnlichste Fantasy-Topffrisuren dar. Der »Tough Guide« ist eine praktische Bürste, mit der man seine eigenen Fantasy-Entwürfe gegen den Strich bürsten kann.
Ein Zuckerl des Buches sind die das Alphabet unterteilenden ›Gnomenworte‹ (nebst einem Barbarenlied). Die gebundene Auflage des Jahres 2004 des englischen Gollancz-Verlages (ISBN 0-575-07592-9) wird neben einer ›Karte‹ von Dave Senior durch acht feine Bleistiftzeichnungen (und Umschlagszier) von Douglas Carrel geschmückt.
Wenn du deine eigene Tocher an Banditen verkaufst, und dafür selbst mit deiner Tocher freigelassen wirst, das ist dann Politik.
Ka'a Orto'o, Gnomenworte, XXXI ii
•••
Dieser Artikel ist zugleich mein erster Beitrag für das Phantastik-Portal FictionFantasy.
»Kniet nieder vor Maria Magdalenas Gebeinen«, oder:Dan Brown: »The Da Vinci Code«
EDIT: Neu formatiert und 1x überarbeitet.
 Eintrag No. 222 — Prolog: Im Louvre mordet nächtlings ein bleicher Schreckensmönch den Kurator. Der Mörder flüchtet, das Opfer stirbt mit zwanzigminütiger Verzögerung und hat noch die Fassung, sich selbst zum Anfangsrätsel einer Schnitzeljagd zu drapieren. Das Abenteuer eines amerikanischen Historikers Landon und einer (jüngeren) fränzösischen Polizeikryptologin Sophie — deren Großvater das Mordopfer war — kann beginnen. Die Hatz wird ca. 24 Stunden dauern, und nach 105 knappen Kapiteln (oder 487 Seiten†) im Epilog mit einem Kniefall enden.
Eintrag No. 222 — Prolog: Im Louvre mordet nächtlings ein bleicher Schreckensmönch den Kurator. Der Mörder flüchtet, das Opfer stirbt mit zwanzigminütiger Verzögerung und hat noch die Fassung, sich selbst zum Anfangsrätsel einer Schnitzeljagd zu drapieren. Das Abenteuer eines amerikanischen Historikers Landon und einer (jüngeren) fränzösischen Polizeikryptologin Sophie — deren Großvater das Mordopfer war — kann beginnen. Die Hatz wird ca. 24 Stunden dauern, und nach 105 knappen Kapiteln (oder 487 Seiten†) im Epilog mit einem Kniefall enden.
Nach all dem Gewese über »The Da Vinci Code« bin ich als den gehypten Narrationen gegenüber skeptisch Veranlagter baff, wie vergnüglich sich der Roman in knapp zwei Tagen wegschlürfen ließ. Keine tiefsinnige Lektüre, aber eine kurzweilige.
Der ganze Spannungs-Aufbau folgt der Tradition der Schatzssuche mit Rätselspielen. Stark erinnert hat mich das Gegrübel über Verse die einen mit ›thee‹ anreden an Justus, Peter & Bob (»Die drei ???«, »The Three Investigators« im britischen Original) — in z.B. »Geheimnisvolle Erbschaft« oder »Schreiender Wecker«. Einige der Rätselantworten habe ich vor den Schatzsuchern erraten (z.B. das Isaac Newton-Rätsel); genervt hat mich lediglich, wieviel Gedöhns um das Erkennen von simpler Spiegelschrift gemacht wird. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn Leser rätseln sollen und auf die Folter gespannt werden. Aber ich finde es lächerlich, wenn ein Autor dem Leser ermöglicht, besserwisserisch über den Figuren zu stehen.
Die Polizei folgt der falschen Spur, denn der ermittelnde Kommissar hält Langdon für den Kurator-Mörder und ist eine Bedrohung für die Helden, die wiederum wissen, daß ihre Schatzssuche ein Rennen gegen den wahren Mörder des Kurators ist. Konventionell aber gut gemacht, wie das Zusammenspiel von Schatzsuche und Flucht Spannung erzeugt. Allein bis der Historiker und die Kryptologin der Hochsicherheits-Mausefalle des Louvre entkommen, verstreichen 146 Seiten. Dann gehts aber auch schon zu den Gnomen von Gringots, ähh, Zürich, die einen Schatz freigeben: freilich nur ein weiterer codierter Puzzlestein.
Das Fruchtfleisch des Romanes und der Intrigen bilden nun christliche Wahrheits-Streitigkeiten und Geheimverschwörungen (es gibt auch ›öffentliche Verschwörungen‹, wie H. G. Wells-Kenner wissen): Das Christentum wurde von machtfixierten Männern — noch dazu römischen Heiden wie Kaiser Konstantin — verhunzt. Alles Allzu-Menschelnde wurde aus der Bio von Jesus getilgt. Nix da, von wegen, daß Jesus der Rabbi mit Maria Magdalena verheiratet war, und schon gar nicht hatte er Kinder (Sarah) mit ihr, also eine menschliche Familie, die nach der Kreuzigung in Südfrankreich untertauchten konnte. Die Messias-Familie als ›Heiliges Blut‹, vulgo: DER GRAL, gehütet von seinen Untergrund-Gralsritten. Soviel geschichtlicher Hintergrund ist für den armen Langdon aus den USA freilich zuviel, da ist es trefflich, daß nahe Paris Sir Teabing lebt, ein reicher, exzentrischer britischer Historiker und Experte in Sachen Gralslegende, bei dem Langdon und Sophie Unterstützung finden. Nun können die beiden akademischen Geheimnis-Nerds die verwirrte Sophie zutexten mit Infos. Das Mädel wird auch sowas von geplagt von visionsartigen Erinnerungen an ihre letzte Begegnung mit ihrem Großvater {SPOILER markieren: •••Kultsex auf subterranen Altar•••}.
Das alles bleibt für mich größtenteils unspannend, denn populäre ›Sachbücher‹ zum Thema (z.B. »Der Tempel und die Loge«, wuhaa) kenne ich seit Teenagerzeiten, wie auch die von Dan Brown erwähnte Gral-Tarot-Connection. Um mir zu denken, daß mit der katholischen Kirche (oder dem Christentum) was nicht stimmt, brauche ich weder einen Krimi, noch den ganzen Eso-Schmonzes aus dem Verschwörungstheorienbegiet. (So kann die hiesige Literatur sich rühmen, einen seriöseren Historien-Bespiegler und Fabulatur wie Karlheinz Deschner zu haben, der mit seiner »Kriminalgeschichte des Christentums« weitaus profunder den kirchlichen Nimbus entzaubert.) Die Früh-Katholen wollten, daß Jesus mehr Gott als Mensch ist und entsprechend Superhelden-mäßig empfangen (durchs Ohr) wurde sowie von uns ging (Himmelfahrt). Die Gralsjünger aber wissen, daß es eine Jesus-Familie gab, mit Jesus-Familien-Stammbaum und Nachkommen, die bis heute als gut gehütete Exilanten im Verborgenen leben. Soll von mir aus beides stimmen — meine Privatspinnerei zu Jesus geht gaaaanz anders: mir bereitet es Vergnügen, einiges von »Ben Hur« mit der Bibel (inklusive den Apokryphen) zu vermengen.
FIKTION:
Jesus war womöglich der Sohn eines mächtigen Römers und einer adeligen Jüdin (oder umgekehrt: Vater mächtiger Jude und Mutter adelige Römerin), der es als Revoluzzer-Prediger schafft, die Menschengesetzte der New World-Order-Imperialen und der starr-konservativen Lokal-Theokraten zu einem tragischen Knoten um den eigenen Hals zu schlingen. Christus hatte eindeutig einen zu heftigen Todeswunsch als Brennkern seiner holistischen Weltliebe.
FIKTIONENDE
 Aber ich komme vom Thema ab. Moment — hmm, wundert mich, daß die Katharer nicht erwähnt werden. Sei's drumm — immerhin: Templer (Freitag der 13.), Troubadure und die Merowinger finden sich alle ein in »The Da Vinci Code«.
Aber ich komme vom Thema ab. Moment — hmm, wundert mich, daß die Katharer nicht erwähnt werden. Sei's drumm — immerhin: Templer (Freitag der 13.), Troubadure und die Merowinger finden sich alle ein in »The Da Vinci Code«.
Die stärkste Figur ist für mich Sir Teabing, und ich freue mich schon auf Ian McKellen in der Rolle, wenn er (hoffentlich) meint: (»My friends, I am far more influencial in the civilized world than here in France« — S. 309).
Die Abschnitte mit dem mordenden Albino-Mönch (komplett mit dornengespickten Kasteiungsgürtel; also ein Intimbereichs-St. Sebastian) mag im Roman manchen unheimlich und packend am Ende sogar »Das Parfüm«-artig tragisch anmuten — ich fands zu routiniert. Wer charakterlich gut entwickelte Fanatiker lesen mag, dem empfehle ich z.B. die ›H.E.I.N.Z.‹-Islam-Jungs in »Zähne zeigen« von Zadie Smith. — An sowas arbeiten wir noch, gell Mr. Brown.
Nett zu lesen ist der Roman auch noch als Touristik nach Paris und London, inklusive Bildbetrachtung von Leonardo-Gemälden, sowie Kirchen-und Louvre-Besichtigung. Die korrekte Genre-Bezeichnung lautet ungefähr: Krimi-Fantasy. (Nicht zu verwechseln mit einem Fantasy-Krimi wie den Lord Darcy-Geschichten von Randell Garrett.)
Dan Browns »The Da Vinci Code« ist ¿neben/vor? »Das Fouccaultsche Pendel« von Umberto Eco der wohl erfolgreichste Verschwörungs-Roman der letzten 20 Jahre. Darüberhinaus kann man beide Bücher kaum fair vergleichen, denn das Pendel ist für geduldigere Gemüther geschrieben, als der schnellgeschnittene Code. Das Pendel ist was für ›literarischere‹ Leser, wer zum Code neigt, bevorzugt schlicht ›'ne flotte Story‹. Wenn es Charakterklassen für Leser gäbe, würd ich sagen, daß Browns modernes Indiana Jones-Szenario für Erstlevel-PCs taugt, wohingegen Eco was fürs Experten-Set ist.
† Die Seitenangaben beziehen sich auf die amerikanische Taschenbuchausgabe.
Hans Peter Duerr: Der Mythos vom Zivilisationsprozess – Freude und Inhalt
Eintrag No. 199 — Zu Beginn der Neunziger habe ich »Traumzeit« und »Sedna oder Die Liebe zum Leben«, die ersten beiden Bücher des Ethnologen Hans Peter Duerr gelesen. Im Februar 1994 habe den ersten Band des fünfbändigen Werkes »Der Mythos vom Zivilisationsprozess« {MDZ} gekauft (und gelesen) und bis diese Woche hat es gedauert, bis ich alle Teile in der für mich erschwinglichen Taschenbuchausgabe zusammen hatte.
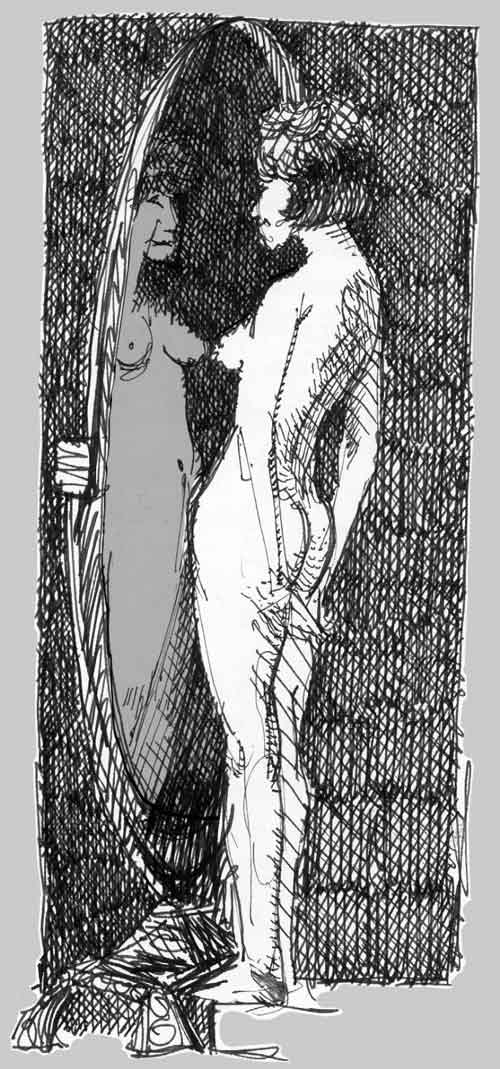 In meinem Molochronik-Beitrag Die Hüfte habe ich versucht, einen kleinen Einblick in meine Leseerlebnisse zu MDZ zu geben. Der Wissenschaftskreisen (und wohl auch allgemein weit) verbreitete Glauben an einen Entwicklungs- oder Reifungsprozesses der menschlichen Zivilisation wird von Duerr in Frage gestellt, und wie ich finde, auch überzeugend als Glaube, Mythos oder Idee eingestuft. Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei der Soziologe mit Freude am Geschichtedeuten Norbert Elias. Waren in früheren Zeiten (z.B. Antike, Mittelalter) die Menschen schamloser, gewalttätiger und unverdorbener, und haben sich erst mit der Neuzeit und der Moderne zu reiferen und affektbeherrschteren Wesen entwickelt? Sind Menschen sogenannter primitiver oder wilder Kulturen im Vergleich zu Menschen der neuzeitlichen Ersten Welt ebenso unterentwickelt, kindlicher und ungezügelter? Duerr legt deutlich dar, daß dem nicht so ist.
In meinem Molochronik-Beitrag Die Hüfte habe ich versucht, einen kleinen Einblick in meine Leseerlebnisse zu MDZ zu geben. Der Wissenschaftskreisen (und wohl auch allgemein weit) verbreitete Glauben an einen Entwicklungs- oder Reifungsprozesses der menschlichen Zivilisation wird von Duerr in Frage gestellt, und wie ich finde, auch überzeugend als Glaube, Mythos oder Idee eingestuft. Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei der Soziologe mit Freude am Geschichtedeuten Norbert Elias. Waren in früheren Zeiten (z.B. Antike, Mittelalter) die Menschen schamloser, gewalttätiger und unverdorbener, und haben sich erst mit der Neuzeit und der Moderne zu reiferen und affektbeherrschteren Wesen entwickelt? Sind Menschen sogenannter primitiver oder wilder Kulturen im Vergleich zu Menschen der neuzeitlichen Ersten Welt ebenso unterentwickelt, kindlicher und ungezügelter? Duerr legt deutlich dar, daß dem nicht so ist.
Nicht nur ist diese hochkpmplexe Materie von Duerr spannend aufbereitet worden, der Ethnologe platziert sich (für mich) mit dieser 3568 Seiten starken Arbeit unter die besten Stilisten und Schriftsteller, derer die deutsche Literatur sich sicher sein kann. Zugegeben ist es gewöhnungsbedürftig, ständig zwischen dem Haupttext und den reichlichen und z.T. langen Anmerkungen im hinteren Teil der Bücher und hin- und herzublättern. Mein Tip: Immer zuerst NUR den Haupttext lesen, dann kann man den das Kapitel durch gespannten Gedankenbogen gut folgen, und dies zuförderst zu tun empfehle ich sehr. Die Anmerkungen bieten manchmal lediglich Quellenangaben, oft aber noch weitere Beispiele zum Angemerkten, oder Diskurs-Beiträge, und ich habe es sehr genossen, sie bei einem Zweitspaziergang durch die Texte kapitelweise abzunicken, -schnauben und -kichern.
Überhaupt Diskurs: Da es in diesen Büchern immer schon viel um Sex, Gewalt und die cthonisch-monströsen Aspekte des Menschenlebens geht, haben sie entsprechend viel Kritik und Widerspruch auf sich gezogen. Bewundernswert ist die Ausführlichkeit mit der Duerr an ausfälligere Aufschreier mit besten Manieren Replik-Watschen austeilt, oder freundlich und pragmatisch den Stutzigen ihre Kathegorie-Knoten aufdröselt.
Hier noch ein Service, denn zumindest in meiner Taschenbuchausgabe des Suhrkamp Verlages findet sich kein Gesamtinhaltverzeichnis.
Bitteschön!
•••
Der Mythos vom Zivilisationsprozess
Band Eins: Nacktheit und Scham
(Gebunden 1988 / Taschenbuch 1994; 515 Seiten; 222 Abbildungen)
 Vorwort …7
Einleitung …9
§ 1 Der nachte Held im alten Griechenland …13
§ 2 Der nackte Ritter oder »Ich mousz doch sêre bitten« …24
§ 3 Die mittelalterlichen Badestuben …38
§ 4 Die mittelalterlichen Wildbäder …59
§ 5 Das Bad bei den Römern, frühen Christen, Juden und Muslimen …74
§ 6 Das Baden in der Neuzeit …92
§ 7 Nacktheit in Japan, Rußland und Skandinavien …116
§ 8 Der indiskrete Blick …135
§ 9 Der nudistische Blick …150
§ 10 Privatsphäre und Phantomwände …165
§ 11 Die Scham im Bett …177
§ 12 Die Sexualität der kleinen Kinder …197
§ 13 Der heimliche Ort und der Kackstuhl …211
§ 14 Urinieren, Defäkieren und Furzen in der eigenen und in der fremden Kultur …227
§ 15 Die Entblößung vor Dienern, Sklaven und Ehrlosen …242
§ 16 Der Henker und die Hexe …252
§ 17 Die Entblößung als Strafe …267
§ 18 Das Mittelalter und die Entblößung des Leibes …283
§ 19 Die Nacktheit der mittelalterlichen Schauspieler und Huren …292
§ 20 Das irdische Paradies …308
§ 21 Der Nachweis der Impotenz und die öffentliche Kopulation …324
Anmerkungen …337
Bibliographie … 463
Register …507
Vorwort …7
Einleitung …9
§ 1 Der nachte Held im alten Griechenland …13
§ 2 Der nackte Ritter oder »Ich mousz doch sêre bitten« …24
§ 3 Die mittelalterlichen Badestuben …38
§ 4 Die mittelalterlichen Wildbäder …59
§ 5 Das Bad bei den Römern, frühen Christen, Juden und Muslimen …74
§ 6 Das Baden in der Neuzeit …92
§ 7 Nacktheit in Japan, Rußland und Skandinavien …116
§ 8 Der indiskrete Blick …135
§ 9 Der nudistische Blick …150
§ 10 Privatsphäre und Phantomwände …165
§ 11 Die Scham im Bett …177
§ 12 Die Sexualität der kleinen Kinder …197
§ 13 Der heimliche Ort und der Kackstuhl …211
§ 14 Urinieren, Defäkieren und Furzen in der eigenen und in der fremden Kultur …227
§ 15 Die Entblößung vor Dienern, Sklaven und Ehrlosen …242
§ 16 Der Henker und die Hexe …252
§ 17 Die Entblößung als Strafe …267
§ 18 Das Mittelalter und die Entblößung des Leibes …283
§ 19 Die Nacktheit der mittelalterlichen Schauspieler und Huren …292
§ 20 Das irdische Paradies …308
§ 21 Der Nachweis der Impotenz und die öffentliche Kopulation …324
Anmerkungen …337
Bibliographie … 463
Register …507
•••
Band Zwei: Intimität
(Gebunden 1990 / Taschenbuch 1994, 625 Seiten; 217 Abbildungen)
 Vorwort …7
Einleitung: Antwort auf die bisherige Kritik »Theoretische Einwände« …11
§ 1 Die Polemik gegen ›Man-midwifery‹ und gegen das Medizinstudium der Frauen …25
§ 2 Die Gebäranstalten und der Gebrauch des Spekulums …35
§ 3 Die gynäkologische Untersuchung im 18. und im 19. Jahrhundert …44
§ 4 Der Arzt und die Scham der Frau im Barock …53
§ 5 Der Arzt und der weibliche Genitalbereich im Mittelalter …67
§ 6 Das Beschauen des weiblichen Körpers …80
§ 7 Geburtshilfe und ›innere‹ Untersuchung in der Antike, bei den Arabern und bei fremden Völkern …95
§ 8 Heimlichkeiten der Geburt und der Schwangerschaft …111
§ 9 Gynäkologie und ›Affektstandard‹ im 20. Jahrhundert …124
§ 10 Die Genitalscham der Frauen in fremden Gesellschaften …136
§ 11 Anstandsregeln für sitzende Frauen …149
§ 12 Das Schließen der Schamlippen …170
§ 13 ›La Nouvelle Cythére‹ oder Die Schamlosigkeit der Frauen von Tahiti …179
§ 14 Die häßliche Vuvla …200
§ 15 Die schöne Vulva …222
§ 16 ›Theorie‹ der Körperscham …256
Anhang: Antwort auf die bisherige Kritik »Empirische« Einwände
I. Noch einmal: Die Ikonographie spaätmittelalterlicher Unzucht …270
II. Prostitution im Mittelalter … 289
III. Nobert Elias im Freudengässlein …316
IV. Die Nacktheit der griechischen Athleten …331
V. Körperkult und Scham bei den Nuba …339
VI. ›Triebverzicht‹ bei den Eskimo …351
Anmerkungen …363
Bibliographie …553
Register …615
Vorwort …7
Einleitung: Antwort auf die bisherige Kritik »Theoretische Einwände« …11
§ 1 Die Polemik gegen ›Man-midwifery‹ und gegen das Medizinstudium der Frauen …25
§ 2 Die Gebäranstalten und der Gebrauch des Spekulums …35
§ 3 Die gynäkologische Untersuchung im 18. und im 19. Jahrhundert …44
§ 4 Der Arzt und die Scham der Frau im Barock …53
§ 5 Der Arzt und der weibliche Genitalbereich im Mittelalter …67
§ 6 Das Beschauen des weiblichen Körpers …80
§ 7 Geburtshilfe und ›innere‹ Untersuchung in der Antike, bei den Arabern und bei fremden Völkern …95
§ 8 Heimlichkeiten der Geburt und der Schwangerschaft …111
§ 9 Gynäkologie und ›Affektstandard‹ im 20. Jahrhundert …124
§ 10 Die Genitalscham der Frauen in fremden Gesellschaften …136
§ 11 Anstandsregeln für sitzende Frauen …149
§ 12 Das Schließen der Schamlippen …170
§ 13 ›La Nouvelle Cythére‹ oder Die Schamlosigkeit der Frauen von Tahiti …179
§ 14 Die häßliche Vuvla …200
§ 15 Die schöne Vulva …222
§ 16 ›Theorie‹ der Körperscham …256
Anhang: Antwort auf die bisherige Kritik »Empirische« Einwände
I. Noch einmal: Die Ikonographie spaätmittelalterlicher Unzucht …270
II. Prostitution im Mittelalter … 289
III. Nobert Elias im Freudengässlein …316
IV. Die Nacktheit der griechischen Athleten …331
V. Körperkult und Scham bei den Nuba …339
VI. ›Triebverzicht‹ bei den Eskimo …351
Anmerkungen …363
Bibliographie …553
Register …615
•••
Band Drei: Obszönität und Gewalt
(Gebunden 1993 / Taschenbuch 1995; 741 Seiten; 216 Abbildungen)
 Einleitung …9
§ 1 »Mit den Waffen einer Frau« …33
§ 2 Die aggressive Entblößung der Brüste …47
§ 3 Die Frau auf der Barrikade …54
§ 4 Die versöhnende Entblößung der Brüste …72
§ 5 Die Vulva als Schreckmittel …82
§ 6 Das Lachen der Götter …91
§ 7 Die Entblößung der Vulva als Beleidigung …105
§ 8 Die Macht der Frauen …120
§ 9 Die Frau als Vergewaltigerin …134
§ 10 »Leck mich am Arsch!« …148
§ 11 Der bedrohliche Phallus …158
§ 12 Penisfutterale und das Problem der öffentlichen Erektion …172
§ 13 Der Hosenlatz und die Schamkapsel …193
§ 14 Die Wurzeln der Männlichkeit …211
§ 15 Rammbock und Festungstor …220
§ 16 Das »Ficken« von Feinden und Rivalen …242
§ 17 Die homosexuelle Vergewaltigung …259
§ 18 Die Kastration des Mannes als Unterwerfung …274
§ 19 Die sexuelle Verstümmelung der Frau als Entehrung …284
§ 20 Die Entblößung als Demütigung …296
§ 21 Im Vorhof der Hölle …309
§ 22 Die sexuelle Belästigung von Frauen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit …319
§ 23 Das ›Betatschen‹ und ›Begrapschen‹ von Frauen in späterer Zeit und heute …333
§ 24 Der Griff des Mannes an die Brüste der Frau …343
§ 25 Der Griff der Frau an den Penis oder »Huy fotz, friss den Mann!« …354
§ 26 Die Vergewaltigung von Frauen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit …363
§ 27 »Schreiender Mund und nasse füd« …373
§ 28 Die Täter und ihre Strafe …382
§ 29 Kriegsvergewaltigung und die »Truppe der Samennehmerinnen« …391
§ 30 Notzucht und Zivilisationsprozess …408
§ 31 »Nix Jüdin, du Frau!« …413
§ 32 Die Vergewaltigung als Entwürdigung …428
§ 33 Die Lust des Täters und die Lust des Opfers …438
§ 34 Der Widerspenstigen Zähmung …452
Anmerkungen …461
Bibliographie …659
Register …731
Einleitung …9
§ 1 »Mit den Waffen einer Frau« …33
§ 2 Die aggressive Entblößung der Brüste …47
§ 3 Die Frau auf der Barrikade …54
§ 4 Die versöhnende Entblößung der Brüste …72
§ 5 Die Vulva als Schreckmittel …82
§ 6 Das Lachen der Götter …91
§ 7 Die Entblößung der Vulva als Beleidigung …105
§ 8 Die Macht der Frauen …120
§ 9 Die Frau als Vergewaltigerin …134
§ 10 »Leck mich am Arsch!« …148
§ 11 Der bedrohliche Phallus …158
§ 12 Penisfutterale und das Problem der öffentlichen Erektion …172
§ 13 Der Hosenlatz und die Schamkapsel …193
§ 14 Die Wurzeln der Männlichkeit …211
§ 15 Rammbock und Festungstor …220
§ 16 Das »Ficken« von Feinden und Rivalen …242
§ 17 Die homosexuelle Vergewaltigung …259
§ 18 Die Kastration des Mannes als Unterwerfung …274
§ 19 Die sexuelle Verstümmelung der Frau als Entehrung …284
§ 20 Die Entblößung als Demütigung …296
§ 21 Im Vorhof der Hölle …309
§ 22 Die sexuelle Belästigung von Frauen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit …319
§ 23 Das ›Betatschen‹ und ›Begrapschen‹ von Frauen in späterer Zeit und heute …333
§ 24 Der Griff des Mannes an die Brüste der Frau …343
§ 25 Der Griff der Frau an den Penis oder »Huy fotz, friss den Mann!« …354
§ 26 Die Vergewaltigung von Frauen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit …363
§ 27 »Schreiender Mund und nasse füd« …373
§ 28 Die Täter und ihre Strafe …382
§ 29 Kriegsvergewaltigung und die »Truppe der Samennehmerinnen« …391
§ 30 Notzucht und Zivilisationsprozess …408
§ 31 »Nix Jüdin, du Frau!« …413
§ 32 Die Vergewaltigung als Entwürdigung …428
§ 33 Die Lust des Täters und die Lust des Opfers …438
§ 34 Der Widerspenstigen Zähmung …452
Anmerkungen …461
Bibliographie …659
Register …731
•••
Band Vier: Der erotische Leib
(Gebunden 1997 / Taschenbuch 1999; 669 Seiten; 211 Abbildungen)
 Vorwort …9
Einleitung: Paradigm Lost: Theoretische Bemerkungen zur Zivilisationstheorie …11
§ 1 Die Viktorianer und das Dekollté …27
§ 2 Liberté, egalité, frivolité …35
§ 3 Die »ärgerlich und schändlich entblößten« Brüste im 17. Jahrhundert …46
§ 4 Die jungfräuliche Königin … 53
§ 5 Die »nit bedeckten Milchsäck« im Späten Mittelalter …64
§ 6 Gab es im Mittelalter eine ›Oben ohne›-Mode? …74
§ 7 »Das tüttel aus dem pousen sprang« 86
§ 8 Die Brustscham im Mittelalter …94
§ 9 »… möchte mit den Brüsten spielen« …106
§ 10 ›Funktionale‹ Brustentblößung: Schandstrafen und Stillen des Säuglings …118
§ 11 Die Muttergottes und sündige stillende Frauen …131
§ 12 Die Angst vor dem ›Verlust der Figur‹ und die gotische S-Linie …145
§ 13 Falsche Brüste …156
§ 14 Das Ideal der flachen Brust und der »Bubibusen« …165
§ 15 »Mammary Madness«, American Style …176
§ 16 Der ›Monikini‹ und seine Folgen …196
§ 17 Die freien und die unfreien Brüste …213
§ 18 Das Auf und Ab des Büstenhalters …231
§ 19 Der BH außerhalb Europas und das Ideal der Hängebrüste …248
§ 20 Die ›Enterotisierung‹ der Mutterbrust …261
§ 21 Die Töchter des Regen- und die des Handelsgottes …277
§ 22 Der »hüpfende Doppelhügel« in Ostasien …289
§ 23 ›Oben ohne‹ in Südostasien und Indonesien …301
§ 24 Der nasse sári auf der Haut der indischen Frauen …310
§ 25 Odalisken mit freien Brüsten …319
§ 26 Sind Brüste auch dort erotisch, wo sie unbedeckt getragen werden? …328
§ 27 Warum sind weibliche Brüste überhaupt erotisch? …343
Anhang: Antwort auf die zwischenzeitlich erschienene Kritik …354
Anmerkungen …389
Bibliographie …583
Register …653
Vorwort …9
Einleitung: Paradigm Lost: Theoretische Bemerkungen zur Zivilisationstheorie …11
§ 1 Die Viktorianer und das Dekollté …27
§ 2 Liberté, egalité, frivolité …35
§ 3 Die »ärgerlich und schändlich entblößten« Brüste im 17. Jahrhundert …46
§ 4 Die jungfräuliche Königin … 53
§ 5 Die »nit bedeckten Milchsäck« im Späten Mittelalter …64
§ 6 Gab es im Mittelalter eine ›Oben ohne›-Mode? …74
§ 7 »Das tüttel aus dem pousen sprang« 86
§ 8 Die Brustscham im Mittelalter …94
§ 9 »… möchte mit den Brüsten spielen« …106
§ 10 ›Funktionale‹ Brustentblößung: Schandstrafen und Stillen des Säuglings …118
§ 11 Die Muttergottes und sündige stillende Frauen …131
§ 12 Die Angst vor dem ›Verlust der Figur‹ und die gotische S-Linie …145
§ 13 Falsche Brüste …156
§ 14 Das Ideal der flachen Brust und der »Bubibusen« …165
§ 15 »Mammary Madness«, American Style …176
§ 16 Der ›Monikini‹ und seine Folgen …196
§ 17 Die freien und die unfreien Brüste …213
§ 18 Das Auf und Ab des Büstenhalters …231
§ 19 Der BH außerhalb Europas und das Ideal der Hängebrüste …248
§ 20 Die ›Enterotisierung‹ der Mutterbrust …261
§ 21 Die Töchter des Regen- und die des Handelsgottes …277
§ 22 Der »hüpfende Doppelhügel« in Ostasien …289
§ 23 ›Oben ohne‹ in Südostasien und Indonesien …301
§ 24 Der nasse sári auf der Haut der indischen Frauen …310
§ 25 Odalisken mit freien Brüsten …319
§ 26 Sind Brüste auch dort erotisch, wo sie unbedeckt getragen werden? …328
§ 27 Warum sind weibliche Brüste überhaupt erotisch? …343
Anhang: Antwort auf die zwischenzeitlich erschienene Kritik …354
Anmerkungen …389
Bibliographie …583
Register …653
•••
Band Fünf: Die Tatsachen des Lebens
(Gebunden 2002 / Taschenbuch 2005; 1018 Seiten; 158 Abbildungen)
 Einleitung …7
§ 1 Der Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit …117
§ 2 Mythen vom wilden Sex der Wilden …132
§ 3 Der weibliche Orgasmus unter widrigen Umständen …147
§ 4 Die passive Frau …162
§ 5 Die aktive Frau …177
§ 6 Wer ist der sexuell »Aktive«? …206
§ 7 Die weibliche Lust im 19. Jahrhundert …225
§ 8 »Stoß zu, Freundchen, heut ist Zahltag« …253
§ 9 »Der kützel der wollust«: Lustquell und Ärgernis …271
§ 10 »Rape me, nigger, rape me!« Rassistische Sexualphantasien …305
§ 11 »Geil wie ein Judd am Schabbes« …340
§ 12 Lüsterne Bauern und unzivilisierte Arbeiter …361
§ 13 Die Aufklärung der Kinder und der sexuelle »Diskurs« …381
§ 14 Das Nachtfreien, die Hochzeitsnacht und die Ahnungslosigkeit der Braut …406
Anhang: Antwort auf die zwischenzeitlich erschienene Kritik …441
Nachwort …525
Anmerkungen …529
Bibliographie …873
Register …1003
Einleitung …7
§ 1 Der Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit …117
§ 2 Mythen vom wilden Sex der Wilden …132
§ 3 Der weibliche Orgasmus unter widrigen Umständen …147
§ 4 Die passive Frau …162
§ 5 Die aktive Frau …177
§ 6 Wer ist der sexuell »Aktive«? …206
§ 7 Die weibliche Lust im 19. Jahrhundert …225
§ 8 »Stoß zu, Freundchen, heut ist Zahltag« …253
§ 9 »Der kützel der wollust«: Lustquell und Ärgernis …271
§ 10 »Rape me, nigger, rape me!« Rassistische Sexualphantasien …305
§ 11 »Geil wie ein Judd am Schabbes« …340
§ 12 Lüsterne Bauern und unzivilisierte Arbeiter …361
§ 13 Die Aufklärung der Kinder und der sexuelle »Diskurs« …381
§ 14 Das Nachtfreien, die Hochzeitsnacht und die Ahnungslosigkeit der Braut …406
Anhang: Antwort auf die zwischenzeitlich erschienene Kritik …441
Nachwort …525
Anmerkungen …529
Bibliographie …873
Register …1003
Helmut Krausser: »Die Wilden Hunde von Pompeii«
 Eintrag No. 144 – Eine weitere Fünf-Sterne-Wertung von mir bei Amazon. Meckern geht mir zwar leichter von der Hand, aber ich achte darauf, mehr Ermunterndes denn Lästerndes zu verbreiten. Hier nun eine Extendet Version meiner Rezi.
Eintrag No. 144 – Eine weitere Fünf-Sterne-Wertung von mir bei Amazon. Meckern geht mir zwar leichter von der Hand, aber ich achte darauf, mehr Ermunterndes denn Lästerndes zu verbreiten. Hier nun eine Extendet Version meiner Rezi.
•••
Hurrah, diesmal zaubert Helmut Krausser in Romanlänge auf der Phantastik-Bühne. Okey, Krausser verstand es schon immer zwischen scheinbar getrennten Welten zu wandern: Trash und Hochkultur, (Post)-Moderne und Altertum, engagierter Realismus und herzhafte Poesie, Zartes und Derbes.
»Ich will vor allem, daß sich jedes meiner Bücher von allen vorherigen völlig unterscheidet. 'Ein typischer Krausser' – ein Diktum, das ich hasse«,
… schrieb Helmut Krausser 1992 in seinem Mai-Tagebuch. Ich kann nicht anders und muß das Paradox mal klappern lassen: »Die Wilden Hunde von Pompeii« sind freilich ein typischer Krausser, eben weil es als neue bunte Facette seines Schreibens glänzt, und nicht etwa ein Routinewerk eines Auf Nummer Sicher-Autors ist.
 Die »Wilden Hunde« ist sein bisher verspieltester und abenteuerlichster Roman, vielleicht auch sein hellster und freundlichster, den Zwölf- bis Hundertundzwölfjährige mit Vergnügen lesen können. Mit aufregend-schrägen Ideen und Bildern, grotesker und phantastischer Sprache kann Krausser jounglieren, wie sonst nur wenige lebende Hiesige ... vor allem bei seinen Gegenwartsromanen (»Thanatos«, »Der Große Bagarozy«, »Schmerznovelle« und zuletzt »UC - Ultrachronos«) war das für die Anhänger des zahmen Realismus oder der schlichten Unterhaltung manches male zu viel des Wilden und Gekrümmten.
Die »Wilden Hunde« ist sein bisher verspieltester und abenteuerlichster Roman, vielleicht auch sein hellster und freundlichster, den Zwölf- bis Hundertundzwölfjährige mit Vergnügen lesen können. Mit aufregend-schrägen Ideen und Bildern, grotesker und phantastischer Sprache kann Krausser jounglieren, wie sonst nur wenige lebende Hiesige ... vor allem bei seinen Gegenwartsromanen (»Thanatos«, »Der Große Bagarozy«, »Schmerznovelle« und zuletzt »UC - Ultrachronos«) war das für die Anhänger des zahmen Realismus oder der schlichten Unterhaltung manches male zu viel des Wilden und Gekrümmten.
Nun aber ist der Held ein neugieriger Hund namens Kaffeekanne und der Roman eben eine phantastische Abenteuer- und Liebesgeschichte. Alle auf Realismus Zwangsfixierten können sich also diesmal entweder gleich brausen gehen, oder es bleibt, ihnen die Daumen zu drücken, daß sie sich an den Eigenheiten von Phantastik nicht wehtun.
Soviel Freude am Zusammenflechten von kurzweiligen Ideen, flotten Dialogen, Laut-Loslach-Klamauk, verbunden mit gewitzten Verbeugungen vor Mythologie und Kunst verbinde ich sonst ehr mit anglo-amerikanischen Autoren wie Terry Pratchett (»The Bromeliad«), Matt Ruff (»Fool on the Hill«) oder Neal Gaiman (»American Gods«) ... und wer an Mainstream-Phantastik wie J.K. Rowlings Harry Potter zu schätzen weiß, wie im Lauf der Bände aus dem Hintergrund der Erwachsenenwelt eine sehr ernste Geschichte über Intoleranz, Reinblütigkeit und fatalem Elitarismus hervortritt, sei »Wilde Hunde« als eine spannende, bunte Lektüre ans Herz gelegt.
••• Für das Skibbel von einem pompeiischen Zebrastreifen orientierte ich mich an einer Photographie in GeoEpoche »Das Römische Imperium«. Den entsprechenden Artikel über Pompeii kann ich als gelgene Ergänzung zu den »Wilden Hunden« empfehlen. •••
BLOGS! – Text und Form im Internet
Eintrag No. 143 – Meine Amazon-Wertung und Rezi zu dem Buch »Blogs! – Text und Form im Internet«.
Fünf Sterne für Kai Pahl und Don Alphonso und den Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf.
•••
Ein dickes tolles Buch haben Alphonso und Pahl da zusammengestellt. Grob bietet es zweierlei: Information und Anthologie und das nicht zu knapp, sondern mit einer durchgehenden vierfarbigen Fülle, so daß ich nach meiner ersten Lese-Session mit dem Augenweiden-Ideengewimmel-Buch angenehm satt war.
Die Blogosphäre – also die sehr heterogene Gemeinschaft der Blog-Autoren und Autorinnen – trägt ja bisweilen heftige Profilierungsstreitigkeiten aus ... »Blogs! - Text und Form im Internet« bietet da einen erfrischenden Überblick auf dem nicht-digitablen Träger Papier, quasi auf einem Analogbildschrim. Zum Fenster raus sind da die interaktiven Elemente und informations- und interaktionsbetonte Blogs machen in so einer Sammlung wenig Sinn. Das mag man als Manko ankreiden, aber die Herausgeber machen ja fairerweise auch kein Geheimnis daraus, daß die Auswahl der 18 deutschsprachigen Blogs eben eine subjektive Zusammenstellung der Herren Pahl und Alphonso ist. Genießen lassen sich also vielmehr: Texte, Gedanken, Ideen, Bilder, gestaltet getreu dem Netzauftritt der einzelnen Blogs. Jedes Blog wird abgeschlossen mit den Antworten der Autoren und Autorinnen auf die Fragen: was der erste Anreiz zum bloggen war; warum man heute bloggt; was die eigenen Texte darstellen; wie sie zur Anonymität oder Offenheit des bloggens stehen; was ihnen die eigenen Leser bedeuten; warum man Kommentare zuläßt; was Blogs im Gegensatz zu anderen Medien bieten.
Obwohl die 18 vorgestellten Blogs sehr unterschiedlich sind, macht das Buch neugierig auf mehr ... neugierig auf mehr Texte und Einträge des ein oder anderen Blogs der Auswahl ... neugierig auf die Möglichkeiten von Blog-Literatur überhaupt ... (oder sollte man von Blog-Kunst, Blog-Pop oder eben der Blogosphäre sprechen?).
Der Infoteil bietet hilfreiche Handreichungen für jeden, der selbst versuchen möchte ein Blog zu machen ... aber auch Stoff für Auseinandersetzung, zum Beispeil mit den 12 Thesen von Don Alphonso »...warum Blogs den Journalismus aufmischen werden«.
Also, wer es als Leser von Anthologien auf Füllhornqualität abgesehen hat, wird diesen dicken, bunten, wirren, sensiblen, arroganten, lakonischen und vor allem facettenreichen Ziegel mögen.
Reinzend wäre es, wenn dieses Buch als Pionier eine (oder verschiedene) jährliche Blogs!-Anthologie(n) anregt. Wie auch immer: die junge Literaturform gibt mit »Blogs!« eine würdige und gloriose Vorstellung auf der hiesigen Printbühne.
Tad Williams: »Der Blumenkrieg« – oder: Seine Hemden sind bunter als seine Phantastik
Eintrag No. 140
HINWEIS: Folgend die Fassung, wie sie sich in »Magira 2005 – Jahrbuch zur Fantasy« findet. Dank des Lektorats der Herausgeber Michael Scheuch und Hermann Ritter zur Abwechslung sozusagen ein Molochronik de luxe-Beitrag.
•••
Kraft und Entwicklung eines Genres pulsieren in der Spannung, die zwischen dem stabilen Zenit der Vertrautheit, Wiedererkennbarkeit und Routine mit bestimmten Zeichen und Inhalten einerseits, und dem fluktuierenden Nadir der innovativen Originalität, Neuartigkeit und Regelübertretung beim Umgang mit der genre-eigenen Zeichen- und Inhaltsgrammatik andererseits herrscht. Je nach Verlauf der individuellen Lektürebiographie im Genre-Raum erfreut man sich angenehmer Überraschungen und unvorhergesehener Genüsse, aber erleidet auch Enttäuschungen und entwickelt Abneigungen.
Das Fantasy-Genre existiert wohl einer konzentriertenm Hoffnung auf eine ganz besondere Leseerfahrung wegen, die über das gewöhnliche Verlangen nach einer spannenden Geschichte oder anrührenden Romanze hinausgeht: In eine gänzlich andere Welt einzutauchen und mithilfe der eigenen Vorstellungskraft mitzugestalten, oder wenigstens Reflektionen unserer Welt in seltsamen Zerrspiegeln aus Historie und Magie betrachten zu können.
Erste Begegnungen
 Früh schon begegnete ich als Teen Tad Williams »Traumfänger und Goldpfote« (Tailcatcher's Song), den ich auf Deutsch gelesen habe. Für mich damals eine erfreuliche Abwechslung von meinen ausführlichen Wanderungen im Land der harten Männerhelden, wo ich mich mit Hawkmoon, Conan, dem Grauen Mausling und ähnlichen Burschen herumgetrieben habe. Diesen Katzen-Fantasy-Roman empfehle ich heute noch gerne. Eine gute Dekade später robbte ich mich als Twen vier Jahre lang durch »Der Drachenbeinthron« (Memory, Sorrow, and Thorn). Es war schrecklich. Was für eine sich zum Leser kuscheln wollende elephantitische Herzschmerzwalkerei! Was für ein offensichtliches Recycling des Bildbestands und der zivilisatorischen Attribute bekannter historischer Kulturen. Unter anderem fand ich nur spärlich verkleidete Wikinger, Indianer, Japaner, Afrikaner, komplett mit Merlin, Vatikan und Cameron-Aliens-Monstern. Selten schaffte ich mehr als 200 Seiten am Stück, und »Der Drachenbeinthron« umfaßt dreitausendsechshundertsechszehn Seiten‡. Von dem noch voluminöseren SF-Epos »Otherland« habe ich die ersten beiden der vier Bücher lediglich überflogen, und sodann schnell und endgültig beiseite gelegt.
Früh schon begegnete ich als Teen Tad Williams »Traumfänger und Goldpfote« (Tailcatcher's Song), den ich auf Deutsch gelesen habe. Für mich damals eine erfreuliche Abwechslung von meinen ausführlichen Wanderungen im Land der harten Männerhelden, wo ich mich mit Hawkmoon, Conan, dem Grauen Mausling und ähnlichen Burschen herumgetrieben habe. Diesen Katzen-Fantasy-Roman empfehle ich heute noch gerne. Eine gute Dekade später robbte ich mich als Twen vier Jahre lang durch »Der Drachenbeinthron« (Memory, Sorrow, and Thorn). Es war schrecklich. Was für eine sich zum Leser kuscheln wollende elephantitische Herzschmerzwalkerei! Was für ein offensichtliches Recycling des Bildbestands und der zivilisatorischen Attribute bekannter historischer Kulturen. Unter anderem fand ich nur spärlich verkleidete Wikinger, Indianer, Japaner, Afrikaner, komplett mit Merlin, Vatikan und Cameron-Aliens-Monstern. Selten schaffte ich mehr als 200 Seiten am Stück, und »Der Drachenbeinthron« umfaßt dreitausendsechshundertsechszehn Seiten‡. Von dem noch voluminöseren SF-Epos »Otherland« habe ich die ersten beiden der vier Bücher lediglich überflogen, und sodann schnell und endgültig beiseite gelegt.
‡ Genauer: 960 + 880 + 880 + 896 Seiten gemäß der deutschen Ausgabe bei Fischer-Taschenbuch.
Und doch…
Kurz gesagt, die Phantastik-Prosa von Tad Williams ist mir mittlerweile herzlich unsympathisch. — Jedoch! Irgendwelche obskuren masochistischen Impulse haben mich jetzt doch wieder bei »The War of the Flowers« zugreifen lassen. Vielleicht, weil Williams diesmal so gnädig war, NUR einen in sich abgeschlossenen 800-Seiten-Roman vorzulegen. Zudem hatte ich die sexy Gelegenheit, die englische Taschenbuchausgabe für 4,– € aus dem Ramsch mitnehmen zu können und keine drei Lappen für die (zugegeben) wunderschöne Klett-Cotta-Ausgabe hinlegen zu müssen.
Bevor ich aber loslege, ein Skalpell anzusetzen und mein Gift auf »Der Blumenkrieg« triefen zu lassen, möchte ich versuchen, ein paar begrüßenswerte Merkmale und Eigenschaften des Romans anzuführen, die jenseits von feineren Geschmacksfragen für die meisten Leser wohl erkennbar sind. Die achthundert Seiten dicke Geschichte liest sich flott weg, schnell war ich in einer Arbeitswoche nebenbei damit durch. Stil und Rhythmus werden dabei seltenst zu simpel. Die Dialoge sind elegant und lebendig. Williams weiß, wie man die Leser bei Fuß hält.
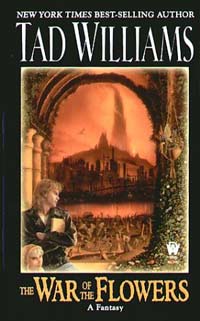 Das Buch liefert darüber hinaus auch einige wirklich mitteilenswerte und beherzigenswerte Gedanken und Ideen, nämlich: Daß Rassismus, Angst vor Fremden oder Klassenarroganz böse sind; daß Reden und Handeln sich nicht (allzu sehr) widersprechen sollten; daß die US-Amerikaner (und die Erste Welt) ruhig mal geduldiger die Aufmerksamkeit über den Tellerrand ihres simplen Schwarz/Weiß-Weltbildes richten können; daß auch für Hegemonialmächte gilt: »Niemals rechtfertigt der Zweck alle zur Wahl stehenden Mittel«. Viel Kritikerliteratur wird für empfindsam-intellektuelles Geklapper gelobt und bietet doch nicht halb so viel Fruchtfleisch wie dem Tad sein ›Genre-Trash‹.
Das Buch liefert darüber hinaus auch einige wirklich mitteilenswerte und beherzigenswerte Gedanken und Ideen, nämlich: Daß Rassismus, Angst vor Fremden oder Klassenarroganz böse sind; daß Reden und Handeln sich nicht (allzu sehr) widersprechen sollten; daß die US-Amerikaner (und die Erste Welt) ruhig mal geduldiger die Aufmerksamkeit über den Tellerrand ihres simplen Schwarz/Weiß-Weltbildes richten können; daß auch für Hegemonialmächte gilt: »Niemals rechtfertigt der Zweck alle zur Wahl stehenden Mittel«. Viel Kritikerliteratur wird für empfindsam-intellektuelles Geklapper gelobt und bietet doch nicht halb so viel Fruchtfleisch wie dem Tad sein ›Genre-Trash‹.
Nun aber zu meinen wohligen Mißfällen. Wohlig deshalb, weil ich es durchaus genossen habe, so reichhaltig und exemplarisch Unarten der Genre-Fantasy in einem Roman versammelt zu finden. Zudem schöpfte ich ein perverses Lesevergnügen daraus, mich über die Vorhersehbareit und Leser-Händchenhalterei des Buches aufzuregen, denn die entscheidenden Enthüllungen der Geheimnisse des Plots hab ich alle lange nahen sehen. Dabei gelang es dem Buch aber nicht, mich anzufixen, diesen absehbaren Wendungen gespannt entgegenzufibbern.
Wie schon in »Der Drachenbeinthron« wälzt sich die Geschichte größtenteils zäh in kleinen Schritten und so mancher Redundanz dahin. Die meisten Zeilen gehen für Launenbeschreibung und den Gedankensalat des Protagonisten drauf. Hauptfigur Theo fühlt sich mal so, mal anders mies, ist auf diese oder jene Art verwirrt. Figuren, Requisiten und Handlung versuchen gar nicht erst, die Originalität von Kautschkartoffel-Bespaßung wie »Xena« und »Stargate« zu übertreffen. Immerhin: um US-amerikanische Schulhofleseratten — die sogenannte Playstation-Generation dieses Globus — zu begeistern, scheint mir das Vorgehen geeignet. Kopffernseh-Prosa, brav, nie wirklich frech oder einzigartig, sondern immer gewöhnlich, immer auf bereits aus den Massenmedien Vertrautes bauend. Subtil oder phantasievoll ist hier wenig. Die Exotik ist keine in unbekannte Reiche verführende, sondern eine Parade von Bekanntem zum Abnicken. Man darf ruhig mit einem geschlossenen Auge oder im Halbschlaf lesen, denn Onkel Tad raunt spätestens alle zwanzig bis fünfzig Seiten über die echt wichtigen Infos oder läßt sie von seinen Figuren rekapitulieren.
Ungeschickt ist schon, wie die ganze Präposition als Fremdkörper das Eröffnungssechstel verstellt. Zu Beginn der Geschichte befinden wir uns im zeitgenössischen San Francisco: Theo Vilmos hält sich für einen Loser. Er hat einen mickrigen Job bei einem Blumenlieferant und macht allzu exemplarisch die berüchtigte Sinn- und Gemütskrise der Frühdreissiger durch. Singen mag sein Talent sein, er hat aber nichts daraus gemacht. Die nur halb so alten Freunde seiner Boy-Band nerven ihn und sind von ihm genervt. Nach einer wiedermal fruchtlosen Studiosession spät heimkommend, gibts den ersten Schock für Theo: seine Freundin liegt nach einer Fehlgeburt im Bad.
Theos Welt bröckelt jetzt erstmal eine Weile. Krankenhausbesuch und Trauer um das verlorene Kind. Der nächste Schlag: die Freundin will allein neu beginnen und Theo soll sich eine eigene Bleibe suchen. Außerdem wird er seinen Job los und die Boys von der Band wollen ihn auch nicht mehr. Er boomerangt also zu Muttern, einer ernsten und schweigsamen Frau, die seit dem Tod von Theos Vater alleinlebt. Das leicht unangenehme, weil beklommene Zusammenwohnen der beiden bleibt aber auch nicht lange ohne Unglück. Mama hat Krebs und Theo wird zum Sterbebegleiter der Mutter, dann zum Manager ihres Erbes. Mit ein bischen Guthaben vom Hausverkauf auf der Kante, zieht sich Theo zum Sich-selbst-finden in eine Waldhütte im Umland zurück, vielleicht um Songs zu schreiben oder endlich mal »Moby Dick« zu lesen. Doch er schmökert in den Aufzeichnungen seines Großonkels Eamonn Dowd, die Teil des mütterlichen Nachlasses sind. Dowd war der Außenseiter der Familie, der nicht nur die weite Welt bereist und manch schöne Frau geliebt hat, sondern auch von dem wundersamen Land Elfien und der dortigen (einzigen) Metropole Neu-Erehwon‡ erzählt.
‡ Warum eigentlich nicht Neu-Owdnegrin? Zumindest für mich klänge das nicht zu (unangenehm) osteuropäisch. {Vielleicht ist das nur eine Anspielung auf EREWHON von Samuel Butler? – Die Magira Herausgeber.} Ja schon, aber warum wurde bei dem schon nicht mal Owdnegrin als Übertragung versucht?
 In der Provinz treibt sich Theo in einem nahen Kaff herum, stöbert im Archiv nach Infos über den Großonkel und verguckt sich in die Bibliothekarin. Ein Komissar aus Frisco schaut aus Routine bei Theo vorbei, weil Folgebesitzer von Mutters Haus bestialisch zerschnetzelt aufgefunden wurden. Kurz darauf greift denn nun auch ein dämonisches Wesen Theo in seiner Waldhütte an. Doch die kleine Elfe Apfelgriebs — ein fliegendes Klischee mit irischem Akzent und roten Haaren, wie Julia Roberts in »Hook« in deftiger, upgedatet um einige Shakespeare-Zeilen — taucht auf, um Theo zu retten. Schuppdiwupp, flüchten beide durch ein kleines Portal nach Elfien.
In der Provinz treibt sich Theo in einem nahen Kaff herum, stöbert im Archiv nach Infos über den Großonkel und verguckt sich in die Bibliothekarin. Ein Komissar aus Frisco schaut aus Routine bei Theo vorbei, weil Folgebesitzer von Mutters Haus bestialisch zerschnetzelt aufgefunden wurden. Kurz darauf greift denn nun auch ein dämonisches Wesen Theo in seiner Waldhütte an. Doch die kleine Elfe Apfelgriebs — ein fliegendes Klischee mit irischem Akzent und roten Haaren, wie Julia Roberts in »Hook« in deftiger, upgedatet um einige Shakespeare-Zeilen — taucht auf, um Theo zu retten. Schuppdiwupp, flüchten beide durch ein kleines Portal nach Elfien.
Dieser ganze Schmonzes zieht sich über die ersten 135 (140 im Original) Seiten dahin, aufgelockert durch wenige kurze Kapitel aus der Elfen-Welt. Da wird von menschenhassenden Elfen der besagte Dämon losgeschickt; in einem Sanatorium der Elfen sitzt eine schöne Elfenfrau apathisch herum; es wird geflüstert vom vergangenem Krieg zwischen mächtigen Elfenhäusern, die eben nach Blumen benamst sind; und berichtet über einen Zwischenfall in einem Elfien-Kraftwerk.
Vergleichswaise
Folgende Aufzählung kann vielleicht dazu dienen, sich besser ausmalen, was für einen Ideal-Leser Tad Williams beim Schreiben vor seinem geistigen Auge hatte. Soweit ich das in freundliche Worten fassen kann, handelt es sich dabei um Leser, die wohl mehr an nervenberuhigender Entspannungs-Aufregung interessiert sind, denn an wahrhaftig herausfordernden neuen Ideen. Sich als Autor besonders solchen Lesern zu widmen will ich gar nicht als unehrenhaft verdammen, denn das ist für einen kreativen Geist ebenso eine Herausforderung, wie sogenannte anspruchsvolle Literatur schaffen zu wollen. Um die Freunde der Bücher von Tad Wiliams milde zu stimmen und der Anschaulichkeit halber, nun zuerst ein angenehmes Beispiel für einen gut untergebrachten Lieber Leser, stells Dir ungefähr so vor-Vergleich.
(Kapitel 1, Seite 29/23)‡ • Theo steht seiner Freundin nach deren Fehlgeburt am Krankenbett bei. Die allgemeine Stimmung in Krankenhäusern wird dabei verglichen mit Gedichten von T. S. Eliot:
… gut ausgeleuchtete Wüsteneien, Orte leiser Gespräche, die nicht ganz verbergen konnten, daß sich hinter den Türen schreckliche Dinge abspielten.
‡ Zu den Verweisen auf die zitierten Stellen: Die erste Ziffer der Seitenangabe bezieht sich auf die englische Taschenbuchausgabe von DAW (May 2004, 828 S.); die zweite Ziffer der Seitenangabe bezieht sich auf die von Hans-Ulrich Möhring (gut lesbar) übersetzte, gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag bei Klett-Cotta (2004, 805 S.).
Als gelungen oder zumutbar empfinde ich solchartige Verweise eben, wenn sie mit etwas mehr Fruchtfleisch hingeschrieben wurden und der Geschichte eleganter dienen.
Achtzig Ideenlosigkeiten aus »Der Blumenkrieg«
— Eine Autopsie —
Ideenlosigkeit No. 1 (Kap. 3, S. 61/54) • Was für Mukke hört Theo als Sterbebegleiter seiner Mutter? Die Smiths, wen sonst? Unangenehm naheliegender Griff ins Popmusikregal zur Veranschaulichung von Kummerstimmung.
2 (Kap. 5, S. 89/83) • Theo öffnet das Schließfach mit Eamonn Dowds Nachlass und
hätte sich nicht gewundert, wenn dem Ding eine Tutanchamuns Grab würdige Staubwolke entstiegen wäre.
3 & 4 (Kap. 7, S. 103/96) • Beim Lesen von Dowds Aufzeichnungen findet Theo einige Passagen zu blöd raunend und fragt sich, ob sein Großonkel durch
zuviel Lovecraft
beeinflußt wurde. Überhaupt: Ist Dowd ein richtiger Schriftsteller oder
ein Dilettant, der seine eigenen {…} Erinnerungen mit Sachen aufpeppte, die er aus den Weird Tales und ähnlichen Blättern gestohlen hatte?
5 (Kap. 9, S. 130/121) • Theo sieht ein seltsames Lichtphänomen in seiner Waldhüttenküche:
So was, wo die Piloten früher meinten, sie hätten ein UFO gesehen.
6 (Kap. 9, S. 135/125) • Theo beschreibt die Aufzeichnungen seines Onkels über New Erewhon und Elfien als
hoffnungslos unverkäufliche Mischung aus Fantasy ohne Abenteuer (wenigstens ohne richtige Abenteuer, wie die computerspielenden Drachenkämpfer sie suchten).
Die Originalpassage lautet jedoch:
(not real adventures anyway, the kind Dungeons-and-Dragon kids wanted)
grob überstezt also:
(jedenfalls nicht wie die richtigen Abenteuer, wie sie die Dungeon-and-Dragon-Kids mochten)
Bei Klett Cotta vertraute man wohl nicht darauf, daß D&D (oder überhaupt Rollenspiele) dem deutschen Leser irgendwas sagen. Erschreckende Zaghaftigkeit.
7 (Kap. 9, S. 144/134) • Für mich schon 'ne echte Stilblüte ist dann ein Vergleich für einen Adrenalin-Schub Theos beim ersten Äktschn-Höhepunkt, dem Angriff des Dämons in der Waldhütte, am Ende des ersten Teils:
Theo's heart felt as though it were about to explode out of the top of his head like a Polaris missle.
Selbst bei Klett-Cotta klingt das gesteltzt:
Theos Herz fühlte sich an, als wolle es im nächsten Augenblick wie eine Polarisrakete durch die Schädelplatte schießen.
8 & 9 (Kap. 10, S. 148/140) • Theos Ankunft in Elfien in einer befremdlichen Gegend. Hier gibt es seltsame optische Effekte, die mit öden Malerei- und Drogenerlebnisvergleichen veranschaulicht werden:
Eigentlich sah die Umgebung gar nicht ausgesprochen anders oder verkehrt aus, sondern bot einen ganz normalen Anblick mit einem gewissen romantischen, präraffaelitischen Einschlag: {…} Es erinnerte ihn an die Art, wie eine Dosis Psilocybin den Farben alltäglicher Gegenstände eine neonartige Grellheit verlieh.
10 & 11 (Kap. 10, S. 150/141 f.) • Auf der Flucht kommt Theo sein Abenteuer vor, als ob sich die
Gegend von einer Zauberlandschaft in den Alptraum eines strapaziösen Survial-Trecks durch eine Disneyfilmszenerie verwandelt hatte. {…} Er fühlte sich allmählich wie auf einem LSD-Trip.
12 (Kap. 10, S. 160/151) • Wieder ein Malereivergleich für eine Landschaft, die
satt wie der Hintergrund eines Maxfield-Parrish-Gemäldes
auf Theo wirkt.
13 (Kap. 12, S. 185/175) • Die Klamotte, die Theo bald in Elfien bekommt, nennt der Text einen
seidenen Ninjapyjama.
14 (Kap. 12, S. 187/177) • Beim Anblick der technischen Geräte im Arbeitsraum eines Elfen-Aristokraten
fühlte sich Theo in die Anfangstage der Computertechnik zurückversetzt, eine ihm nur von Fotos und Zeitschriftenartiklen bekannte Zeit, in der die Leute ihre PCs der ersten Generation in handgefertigte Holzkisten einmontierten.
15 (Kap. 12, S. 187/177) • Das Ausshen des Elfen-Aristokraten selbst wird dem Leser nahegebracht als das
… eines mondänen europäischen Konzeptkünstlers, was auch zu dem technominimalistischen Dekor paßte.
16 (Kap. 12, S. 193/183) • Im einem Dialog bringt Theo dann über diesen aristokratischen Elfen-Wissenschaftler auch den ersten von einigen Vergleichen mit dem Dritten Reich an:
‘Wenn der ein Wissenschaftler ist, dann muß er einer wie Dr. Mengele sein.’
17 (Kap. 12, S. 199/189) • Allein unterwegs in den Gängen eines Elfienhauses während eines Stromausfalls fühlt sich Theo wie
Theseus im finsteren Labyrinth, nicht ahnend, daß der schreckliche Minotraurus hinter ihm stand.
18 (Kap. 13, S. 227/216) • Unterwegs zu einer Eisenbahnstation kommt Theo ein Elfienbegleiter vor
wie aus einem Monty-Python-Sketch.
19 (Kap. 14, S. 231/219) • Für Theo, der offentlichlich nicht gerade über ein funkendensprühendes Assoziationsvermögen verfügt (¿oder ist es Tad selbst der schwächelt?), sehen einige Fahrzeuge auf den Straßen Elfiens aus
wie Volkswagen Käfer.
20 (Kap. 14, S. 235/224) • Fremdartige Elfenschrift, die Theo aber dennoch irgendwie lesen kann, erscheint ihm wie
längst untergegangene vorderasiatische Schrift.
21 (Kap. 14, S. 237/226) • Nochmal über den Wissenschaftler, dessen Äußerliches beim ersten Treffen in Theos Rückblick beschrieben wird als
keltisch-asiatische oder skandinavisch-asiatische Mischung.
22 (Kap. 15, S. 262/249) • Später wird das Verhalten dieses Kerls schlicht klassifiziert als
er benahm sich wie in einer Geschichte mit Jeeves dem Butler.
Gemeint sind die im englischen Sprachraum klassischen komischen Romane von P. G. Wodehouse über den adeligen Junggesellen Wooster und seinen Butler Jeeves, die bei Edition Epoca exzellent übersetzt erscheinen. Verfilmt als BBc-Serie mit Hugh Laurie als Wooster und Stephen Fry als Jeeves.
23 (Kap. 15, S. 262/250) • Das Zombiewesen von der Waldhüttenäktschn wird Theo den ganzen Roman durch auf den Fersen bleiben. Mit Galgenhumor denkt sich Theo, warum ihn außer lebenden Leichen und Schleimschneckenmännern nicht auch noch anderes Böszeugs jagt:
‘wie heißen diese Ekelpakete am Anfang vom ›Herrn der Ringe‹ noch mal? Schwarze Reiter?’
Im Original freilich ist Theo noch nervig-dümmer, und dem Fantasy-Vertrauten wird eine lächerlich simple Gelegenheit zur Besserwisserei dargeboten, denn es heißt:
‘von Schwarzen Reitern wie im ›Kleinen Hobbit‹’
24 (Kap. 15, S. 266/254) • Die Angst, beim Klauen erwischt zu werden, läßt Theo fürchten, in ein
Gefängnis wie aus einem gruseligem Grimm-Märchen
geworfen zu werden.
25 (Kap. 16, S. 287/274) • In Gesellschaft mit Poppy, der Tochter des obersten Menschenhasser-Elfen, ist Theo auf den Weg zu deren Familiensitz, oder wie Theo sich zynisch denkt:
‘Klar, wir steigen übers Wochenende einfach im Führerhauptquartier ab.’
Tja, liebe geschichtsverklemmten Deutschen, in der USA-Mainstream-Fantasy eines Williams wurde die Höhle des Löwen und die Teufelsküche vom Führerbunker abgelöst. Man kann sich ruhig unwohl deswegen fühlen, aber es läßt sich nicht ändern, daß die Nazis längst in den Bilderfundus der Populärkultur eingegangen sind. Nicht wahr Dr. Jones?
26 (Kap. 16, S. 293/280) • Zur Schnulze zwischen Theo und Poppy. Er ist ja Anfang Dreißig, sie in Jahren knapp über Hundert, in Elfen-Maßstäben aber gerade mal so aus dem schlimmsten Teenageralter raus. Theo denkt sich, daß er sich eine Romanze mit Poppy wohl ausmalen muß, wie in
… de{m} Film Harold and Maude.
27 (Kap. 20, S. 339/325) • Theo wird wieder mal magisch-wissenschaftlich untersucht und wirft einen Blick auf ein Gefäß, das
gelblich-grün {glühte} wie etwas in einem billigen Horrorfilm.
28 (Kap. 20, S. 341/326) • Laborratte Theo ist es leid, behandelt zu werden
wie Charlton Heston auf dem Planet der Affen.
29 (Kap. 20, S. 349/335) • Für Theo klingen die abenteuerlichen Geschichten über das Gesellschaftshickhack der mächtigen Elfen-Familien
wie der Anfang der West Side Story, witzig und eher aufregend als gefährlich.
30 (Kap. 20, S. 357/342 f.) • In einem hippen Elfen-Nachtclub wirken die Klamotten der Anwesenden auf Theo wie
eine absurde Mischung aus viktorianischer Tracht und zerschlitzter, beschmierter punkiger Gothic-Mode.
31 (Kap. 22, S. 387/371) • Theo besichtigt die Cafeteria eines Gemeinschaftsbaus kleiner Elfen. Einige Tische dort sind so groß wie ein
Silberdollar
und die größeren bieten Platz für mehrere
Gäste von Barbiepuppengröße.
Im Original werden
G. I. Joe-Figuren
zum Vergleich herangezogen.
32 (Kap. 22, S. 393/378) • Ein weiterer Elfien-Aristokrat, der nach Theos Bildung gut in ein
Renaissancegemälde gepaßt {hätte}, vielleicht als ein Ratgeber, der neben dem Thron stehend mißbilligend zusah, wie der arme Columbus Isabella und Ferdinand zu überreden versuchte, ihm ein paar Schiffe zur Verfügung zu stellen.
33 (Kap. 25, S. 445/428) • In einer heiklen Äktschn-Situation will der gebeutelte Theo aus einem beschädigten Gebäude raus. Ein rettender Türgriff blendet da schon mal wie eine Erscheinung gleich der Offenbarung
Saulus’ auf der Straße nach Damaskus.
34 (Kap. 25, S. 455/438) • Theo vergleicht seinen Ausblick auf zerstörte Häuser als
groteske Szene {…} wie Dantes Inferno.
35 & 36 (Kap. 27, S. 483/466 f.) • Theo vergleicht Siedler, von denen ihm sein Elfenbegleiter erzählt, mit den amerikanischen Pionieren. Und bald darauf kommentiert Theo dazu:
Wow. Das ist ja fast wie in einem von unseren Western.
37 (Kap. 27, S. 485/467) • Eine Gruppe wilder Goblins auf Pferden, die Theo auf dem Weg in die Metropole Neu-Erewhon bemerkt hat, sieht für ihn aus
wie Dschingis Khans Mongolen oder so. Wild. Verwegen.
38 (Kap. 28, S. 509/491) • In der Zeltstadt hoffnungssuchender Elfen kommt sich Theo vor wie
auf einem marokkanischen Markt.
39 (Kap. 28, S. 520/502) • Wieder mal sehr befremdet von der Feariewelt fühlt sich Theo wie
der erste Mensch auf dem Mars in einem altem Science-fiction-Buch.
40 (Kap. 28, S. 522/503) • Theo macht mit Goblins Musik, fühlt sich aber so fehl am Platze
wie ein Börsenmakler bei einem Jazzfestival.
41 (Kap. 28, S. 522 f/504) • Die Musik der Goblins ist für Theo schwer einzuordnen, klingt für ihn aber am ehesten wie
Qawwali, die gottestrunkene Sufimusik.
42 (Kap. 29, S. 540/520) • Für Theo trägt ein prophetischer Rebellengoblin
Franziskanertracht.
43 (Kap. 29, S. 544/524) • Wie ein
Beduinenscheich
wirkt der Rebellengoblinboss auf Theo.
44 (Kap. 32, S. 588/567) • Pläne gegen die Machenschaften der Bösen wurden geschmiedet, doch Theo bezweifelt sehr, daß er der Richtige ist für eine
Rettungsaktion {…} wie in ›Stirb Langsam‹
45 (Kap. 32, S. 593/571 f.) • Theo begegnet wieder dem Elfenmädel Poppy, die inmitten der Hilfesuchenden im Zeltlager wirkt wie
eine idealisierte Rüstungsarbeiterin von einem Propagandaplakat aus dem Zweiten Weltkrieg.
Im Original wird genauer auf ›Rosie die Riveter‹ verwiesen.
46 (Kap. 32, S. 593/572) • Die schicke Poppy (immerhin die Tochter des Oberböslings) vergleicht dann Theo so:
Genau wie die adretten Fräuleins, die zu Hitlers Partys gingen, aber die Augen davor verschlossen, was wirklich geschah.
47 (Kap. 32, S. 600/579) • In einem Restaurant fällt Licht so auf Poppys Gesicht, daß sie aussieht wie
ein Porträt von Vermeer.
48 (Kap. 32, S. 602/581) • Nazi-Bunnies auf Davon geht die Welt nicht unter-Festen scheinen Tads Phantasie ganz schön umzutreiben. Theo fühlt sich nämlich mit Poppy im Restaurant nicht so recht wohl, denn sie macht auf ihn den Eindruck wie eines der
hübschen, munteren HJ-Mädels {…}, die in Berlin rauschende Feste feierten, während die SS die Unerwünschten in die Lager abtransportierte.
49 (Kap. 32, S. 608/587) • Ein Viertel von Neu-Erewhon, das am Wasser gelegen ist, vergleicht Theo für sich mit dem New Orleans oder Neapel des 19. Jahrhunderts.
50 (Kap. 33, S. 624/603) • Wieder zum Goblinpropheten, der diesmal umschrieben wird als eine
Art Mahatma Ghandi der Elfenrevolution.
51 (Kap. 33, S. 630/609) • Der Name eines alten und mächtigen Wesens – der Beseitiger von Hindernissen (Remover of Obstacles) – klingt für Theo nach dem Titel eines alten Black Sabbath-Songs.
52 & 53 (Kap. 35, S. 660/640) • Das Innere des Lagerhauses des besagten Beseitigers wirkt für Theo als
hätte {jemand} in großer Hast eine altmodische Apotheke mit einer besonders abartigen Spielwarenhandlung zusammengekippt und dann den ganzen Plunder großzügig mit den Beständen der Bibliothek von Alexandria garniert.
Die Szenerie erscheint Theo
wie eine Bühnenkulisse oder eine Disneyland-Attraktion.
54 (Kap. 36, S. 662/641) • Die Wächter des Beseitigers (Alraunen) sehen für Theo aus, als wären
sie gerade von ihren angestammten Plätzen an der Steilküste der Osterinsel gekommen
55 (Kap. 35, S. 666/645) • Empört über den Egoismus des Oberbösewichts der Elfen bemüht Theo wieder einen Vergleich mit dem Dritten Reich:
Selbst Hitler hätte nicht getan, was Nieswurz tun will, nämlich eine ganze Welt zerstören, bloß um an der Macht zu bleiben.
56 (Kap. 36, S. 671/651) • Die herrschenden Blumen-Elfen und ihre vertrackte Bürokratie werden umschrieben als
so schlimm wie die britischen und selbst russischen Apparatschiks.
57 (Kap. 36, S. 677/657) • Ein mächtiger Elfen-Aristorat wird vom Beseitiger verglichen
‘mit dem Oberhaupt einer reichen, alten neu-englischen Familie – Bostoner Brahmanen nannten wir sie früher.’
58 (Kap. 36, S. 680/660) • Die Pläne für Kraftwerke der Bösewicht-Elfen und deren verächtlicher Verschleiß von niederen Elfen wird so beschrieben:
Diese Pläne sahen völlig autarke Kraftwerke vor, in denen Goblins und Kobolde eigens gezüchtet, verbraucht und dann im Prinzip weggeworfen worden wären.
Im Original heißt es wiederum Drittes Reich-bezogener:
then essentially thrown them away, like the Nazi camps.
59 (Kap. 37, S. 686/666) • Das Innere des Lagerhaus von dem Beseitiger kommt Theo vor wie
die Kulisse eines existentialistischen Theaterstücks.
60 (Kap. 37, S. 694/674) • Theos Gedanken über den Beseitiger von Hindernissen:
Vielleicht ist er einer wie der ‘große und schreckliche {Zauberer von} Oz’.
Vielleicht, vielleicht.
61 (Kap. 37, S. 696/676) • Der Beseitiger erzählt davon, daß er sich
verhüllt und maskiert {hat} wie das Phantom der Oper oder sonst ein melodramatischer Blödsinn.
62 (Kap. 37, S. 700/680) • Theo weiß nicht warum verschiedene Gesinnungsgruppen der Elfen-Welt hinter ihm her sind, und warum sie glauben, er sei im Besitz von irgendwas enorm Wichtigem.
Alle machen auf mich Jagd, aber ich habe nichts! Keinen Schlüssel, keinen Zauberstab, keinen Ring sie alle zu binden, nichts!
Und Tad Williams hat echt die Chuzpe zu behaupten, daß er bestrebt ist, sich über die Händchenhaltprosa eines Tolkiens hinauszuentwickeln. Buhrufe sind angebracht.
Tad Williams Abgrenzungsbemühungen zu Tolkien kann man z.B. in einem Interview mit Marcel Feige bei misterfantastik beobachten.
63 (Kap. 38, S. 705/685) • Seltsame Salamander sehen ein wenig aus
wie Cartoondämonen.
64 (Kap. 38, S. 709/689) • Auftrieb und Durcheinander auf den Straßen,
wie beim Mardi Gras.
65 & 66 (Kap. 39, S. 718/697) • Theo schaut dem Oberbösewicht tief in die Augen, und was geht ihm als Soundtrack durch den Kopf? ‘Sympathy For The Devil’ von den Rolling Stones. Die körperliche Nähe des Oberböslings fühlt sich für Theo an
als ob Dracula hinter ihm stünde.
67 (Kap. 40, S. 733/711) • Die Zugtiere von Kriegskutschen sehen für Theo aus
wie Außerirdische aus einem Hollywoodfilm.
68 (Kap. 40, S. 734/712) • Inmitten einer wilden Äktschn sehen die vielen Gesichter aufständischer Elfen für Theo aus
wie einem Gemälde von Bosch entsprungen.
69 (Kap. 40, S. 740/717) • Schrecklicher Monstergeruch, wie
das Alligatorbecken im Aquarium von San Francisco.
70 & 71 (Kap. 40, S. 748/726) • Die heiligen Bäume im Zentrum Elfiens sind
breit und massig wie Wolkenkratzer
die Wurzeln versinken in Hügeln, die so groß sind
wie ein ganzer Sportplatz.
72 (Kap. 40, S. 749/727) • Eine gebieterische Geste des Oberbösewicht ist so lässig, daß
jeder römische Kaiser {ihn} beneidet hätte.
73 (Kap. 41, S. 756/733) • Magische Spezial-Effekte wirken auf Theo
geradezu fraktal {…}, das Ergebnis eines Experiments in der Blasenkammer, liebevoll fotografiert und im Smithsonian Magazine abgedruckt.
Bei uns bekannter: Geo und National Geographic.
74 (Kap. 41, S. 756/734) • Theo ist überzeugt, daß er vom Oberbösewicht geopfert werden wird, wie die
Vulkanjungfrau eines bezarren religiösen Rituals.
75 (Kap. 41, S. 763/741) • Magische Blubbersubstanz wird einmal als ›Plasma‹ bezeichnet, für von Star Trek und Co. Konditionierte.
76 (Kap. 41, S. 765/742) • Theo begreift, daß ein magischer Singsang in etwa funktioniert
wie die Formel für eine Wasserstoffbombe.
77 (Kap. 42, S. 782/758) • Theo über Poppys neuen Look beim Wiedersehen nach dem Showdown:
{ein} seltsam japanisches Aussehen, {…das} Gesicht ein weißes Oval wie bei einer Geisha.
78 (Kap. 42, S. 786/762) • Die Bücher von Frank L. Baum haben Tad anscheinend gut gefallen, denn er läßt Theo über das Ende seiner überstandenen Abenteuer ausrufen:
Das ist ja wie der Schluß von ›Der Zauberer von Oz‹.
79 (Kap. 42, S. 793/769) • Neue Klamotten der Elfen für Theo, diesmal wie
die Ausgehuniform einer Karateschule.
80 (Kap. 43, S. 807/783) • Die Erstaunheitsäußerungen von Theo werden von seinem Onkel beschrieben als
Sätze {die} aus einem Flash-Gordon-Comic stammen {könnten}.
In einer dunklen Passage des Romans heißt es einmal, daß Theo sich fühlt, als ob er von einem Märchen mit Zähnen verschlungen wird. Da kann ich nur den Kopf schütteln, denn Zähne oder Biß hat »Der Blumenkrieg« nun kaum.
•••
Folgende Resteln hab ich in der Magira-Fassung nicht verwertet:
Hätte ich eine Aktionskarte für einen willkürlichen Eingriff in Phantastik-Verlagsprogramme, würden die Bas Lag-Romane von China Miéville als liebevoll gestaltete Hardcover bei Klett Cotta erscheinen und dem Tad Williams seine Prosa-Maische als hektisch-schiache Abzock-Pulp-Ausgabe bei Bastei.
Meine Vorsätze also: dies ist der letzte Tad Williams den ich lese … und ich sollte mich lieber umtun, und wieder GUTEN Genre-Trash aufstöbern. So, und die nächsten Tage bekomme ich nun hoffentlich meine Meinungen zu wirklich lesenswerten Büchern aus mir raus.
Wirklich gute flott lesbare moderne Realwelt/Fantasywelt-Überschneidungs-Romane (U-Bahn tauglich) kann ich bessere aufzählen:
Neal Gaimans »Neverwhere« (Niemalsland) und »American Gods«; leider sind die deutschen Übersetzung von Gaiman ziemlich mies.
Matt Ruffs »Fool on the Hill«; gut übersetzt.
Charles de Lindts »Memory and Dream«;
Clive Barkers »Thief of Always« und »Weaveworld« (Gyre);
Peter S. Beagles »Hey Rebeck!«;
* Martin Millars »Die Elfen von New York«
usw. usf. …
•••
Und zuletzt:
Für die Bibliotheka Phantastika schreibt der Rezensent Top Dollar:
Gewalt in Romanen kann nur so lange unterhaltsam sein, wie sie sich eindeutig in einem fiktiven Rahmen abspielt und der Leser in seinem bequemen Sessel sicher sein kann, daß sie mit der Realität nicht das Geringste zu tun hat.
Abgesehen, daß Top Dollar den Roman mit 4 von 5 Sternchen bewertet, obwohl er im Fazit meint:
Starker Beginn, folgt dann aber zu vorhersehbar ›Schema F‹
… ist die Aussage zu Gewalt in Fiktionen ein ungeheuerlicher Satz … mich gruselt es richtig. Zumindest meiner Meinung nach ist es genau umgekehrt: Gewalt in Fiktionen ist eben gerade eine Meßlatte dafür, wie sehr sich die Fiktion von der (bösen bösen) Realität entfernt hat. Wird Gewalt als akzeptables Mittel zum Zweck dargestellt, verdächtigt man zurecht das Werk als ein gewaltverherrlichendes. Doch eine Verharmlosung oder »Will ich nicht wissen«-Ausblendung von Gewalt ist nicht minder verwerflich.
Douglas Coupland: »Hey Nostradamus«, oder: Traumasonate für vier Stimmen
Eintrag No. 137 – Zwischen Erst- und Zweitlektüre des hochphantastischen »Iron Council« von China Miéville, genehmigte ich mir als Balancegewicht den neuen Roman von Douglas Coupland »Hey Nostradamus« (244 Seiten, Harper, 2003).
1991 … vor dreizehn Jahren debütierte er mit »Generation X«, dessen Kultstatus vielleicht auch noch sein 1995 erschiener »Microserfs« erreichte. Für mich ist Coupland eine sichere Bank für eine anregende Lektüre. Selbst wenn – wie bei »Miss Wyoming« – mich die Geschichte nicht groß mitzittern läßt, tun sich genug interessante Dinge, und finden sich viele clevere Sätze und Dialoge, so daß ich seine übersichtlichen Romane schnell durch habe. Anregende, wenn nicht sogar atemberaubende Unterhaltung mit einer gehörigen Portion moderne Wirklichkeit, die in 12 Stunden verdrückt ist.
Nach einem Couplandbuch habe ich zudem immer einen spürbaren Weisheits-Boost. Eine sehr verführerische Wirkung und bei dem diesmaligen Thema mehr als erwünscht, denn das Buch ist die vierstimmige Geschichte eines Schulmassakers und dessen Nachwirkungen.
1988: Cheryl, siebzehn Jahre alt und letztes Todesopfer einer willenlosen Schießerei, spricht zum Leser aus dem Jenseits und lauscht den Gebeten auf ihrer Beerdigung. Auf ihr Schulheft hat sie kurz vor ihren Tod immer wieder »God is nowhere / God is now here…« gekritzelt. Vor wenigen Wochen haben sie und ihr Freund insgeheim in Las Vegas geheiratet.
(Seite 18:) It had been drilled into us that to feel fear is to not fully trust God. Whoever made that one up has never been beneath a cafeteria table with a tiny thread of someone else's blood trickling onto their leg.
Übersetzung von Molosovsky ••• Uns wurde eingetrichtert, daß Furcht zu empfinden bedeutet, Gott nicht vollkommen zu vertrauen. Wer auch immer sich das einfallen ließ, war niemals unter einem Mensa-Tisch während ihm das Blut von jemand anderem in feinen Bahnen das Bein hinab rinnt.
1999: Jason, ihr Freund, der über den Verlust nie hinwegkam, schreibt einen Schließfach-Brief, den seine beiden noch kleinen Neffen bei ihrer Volljährigkeit lesen sollen.
(Seite 87:) Maybe clones are the way out of all this. {…} as a clone, you pop off the assambly line with an owner's manual written by the previous you – an manual as helpful as the one that accompanies a 1999 VW Jetta. Imagine all the crap this would save you – the wasted time, the hopeless dreams. I'm going to really think about this: an owner's manual for me.
••• Vielleicht sind Klone die Lösung für alles {…} als Klon plopt man vom Fließband mit einem Besitzerhandbuch das von deinem vorherigen Du geschrieben wurde – so nützlich wie das Handbuch eines 1999 VW Jetta. Der ganze Miste, der einem erspahrt bliebe – die verschwendete Zeit, die aussichtslosen Träume. Ich werde wirklich mal darüber nachdenken: ein Besitzerhandbuch für mich.
2002: Heather, eine Gerichtsstenotypistin, die sich beim Kasseanstehen in Jason verliebt hat.
(Seite 111:) … Somethimes I think God is like the weather – you may not like the weather, but it has nothing to do with you. You just happen to be there. Deal with it. Sadness and grief are part of being human and always will be. Who would I be to fix that?
••• … Manchmal glaube ich, Gott ist wie das Wetter – kann sein, du magst das Wetter nicht, aber es hat nichts mir dir zu tun. Du bist einfach da. Werd damit fertig. Trauer und Schmerz gehören zum Menschsein und das wird immer so sein. Wer wäre ich, um das zu regeln?
2003: Reg, Jasons Vater, ein selbstgerechter christlicher Fundamentalist.
(Seite 156:) Inasmuch as I am a spiritual man, I do believe in God – I think that He created an order for the world; I believe that, in constantly bombarding Him with requests for miracles, we're also asking that He unravel the fabric of the world. A world of continuous miracles would be a cartoon, not a world.
••• Da ich spiritueller Mensch bin, glaube ich an Gott – Ich denke, Er hat eine Ordnung für die Welt geschaffen; Ich glaube, indem wir Ihn ständig um Wunder bedrängen, bitten wir ihn auch darum das Innere der Welt offenzulegen. Eine Welt fortwährender Wunder wäre ein Cartoon, keine Welt.
Interessant für Phantasten: die wenigen aber bedeutenden Thriller- (Geballer, Gewalt), Fantasy- (Totenwelt, Phantasie-Identitäten) und SF-Elemente (Klone, Biometrie) in einem durch und durch realitisch verorteten Roman. Die Phantastik erreicht zwar nicht so gewaltig-apokalyptische Szenarios wie in »Girlfriend in a Coma«, aber nichtsdestotrotz geht auch »Hey Nostradamus« mit mehr Science Fiction-Fusionskraft ab, als eintönige Lasercowboys- und Aliendianer-Opern.
»ENDSTUFE« von Thor Kunkel, oder: An welcher inversen Form von Eitelkeit krankt Molosovsky, wenn er gerne in solch einen schwarzen Spiegel schaut?
Reflexionen eines ehrenamtlichen Literaturfreundes
Eintrag No. 121 — Was für ein blauäugiger Narr muß ich sein, wenn ich mich im Folgendem mühe, meinem positiven Leseerlebnis, das ich mit »Endstufe« hatte, Ausdruck zu verleihen? Naivität oder Selbsttäuschung sind dabei noch die milderen Vorwürfe, Krypto- und Neofaschist oder antiamerikanischer Revanchist die strengeren Anschuldigungen, die deshalb auf mich fallen mögen. Nach längerem Nachdenken will ich dennoch wagen mein Quentchen beizutragen, denn die aggressive Deutungshoheit von Schwarz-Weißmalern stärkt mit ihrer vorliegenden Fülle in der deutschen Literaturlandschaft eine Rüpelhaftigkeit, mit der niemandem gedient ist.
Holsten {der Kameramann, untergetauchter Deserteur, Multitoxiker} lockerte sein Halstuch: »Ich meine, hatte ich eine Wahl? Manchmal kommt man im Leben an einen Punkt, eine Art Weiche, es könnte rechts oder links abgehen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man überlegt hin und her, wägt ab, doch da …»
»… ist der Zug abgefahren«, ergänzte Ferrie {der Produzent, brauner Dandy des SS-Hygieneinstitutes Berlin mit Dadtscha Gefilderaldo nahe der Wolfschanze}.
»Eben nicht.« Holsten schüttelte den Kopf. »Du sitzt bereits im Zug. Und Ddu weißt weder, wie du zu deinem Sitzplatz gekommen bist, noch hast du einen Schimmer, ob, wie und wo du aussteigen wirst.«
»Herzliches Beileid.« Ferrie öffnete das Handschuhfach {und holt eine Schnupftabakdose mit Koks hervor}. »Im Leben kommt es nicht auf Entscheidungen an, sondern auf den richtigen Riecher.« •••Seite 55

•••••Zum Photo: Das Buch ohne Schutzumschlag, schwarz schimmernd und matt reflektiv, wie vom Stiefelfetischist und Protagonist Fußmann ausgesucht Unterlage: »Sechsundfufzich kleine Nazis«, gemalt in Hepberg, 17. Februar 1994; Acryl & Tusche; ca. 820 x 600 mm. Notizen am Rand: (Um stupide kleine Geister zu malen, muß der Maler stupide, eintönige Arbeit verrichten). In der Ausstellung »Der zerbrochene Spiegel« {damals in Wien} behauptete ein Kurator, die Tafelmalerei habe zum Faschismus geführt!?! Fakt ist, das es keinen homogenen demokratischen modernen Malstil gibt. (Hommage auf Andy Warhols einziges Bild, das ich mir aufhängen würde »Onehundered and one Coke bottels«.)
In meinem Zimmer hing damals folgendes Motivations-Grafitti:
»Das Weiße im Auge / des Feindes zu sehn / heißt nichts als geduldig / vorm Spiegel zu stehn.«
Die Zeilen sind aus dem Lied »Der alte Herr« von der Heinz Rudolf Kunze-CD »Brille«•••••
Feuillitonmörserrauchschwaden
Wenn es etwas im Zusammenhang mit dem Buch »Endstufe« gibt, daß ich als Leser von Romanen und damit als Kunde von Autoren und Verlagen für beklagenswert halte, dann sind es die fehlende Ruhe der bezahlten Literaturvermittler und der verbissen geführte Überbietungswettkampf im Aufdecken oder Arrangieren(wollen) von Skandalen. Hysterie und Hype trüben jede gelassene Beschäftigung mit Konsumkunst. Leider kann ich mir nun lediglich in der Vorstellung ausmalen, wie sich rücksichtsvollere Berichte über die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Hausverlag Rowohlt und dem Autor Kunkel auf die Aufnahme des Romans in der Öffentlichkeit ausgewirkt hätten. Ist es so schwer die Ablehnung Rowohlts oder das Einspringen von Eichborn unhysterisch zu respektieren? Henrik M. Broders* initialer Angriff im Rezeptionsraum – Kunkel der revanchistische Nazi-Relativierer und US-Leitkulturkritiker – gründet in einer exemplarischen Vernachlässigung journalistischer Anständigkeit (abgesehen, daß er vor Erscheinen des Buches stattfand): kläre den Standpunkt und wähle entsprechend die Mittel, hier: Berichterstattung oder Literaturkritik. Indem Broder unverhohlen einseitig Stellung für Rowohlts Bedenken bezieht, konnte aus einer ästhetischen Differenz ein ideologischer Konflikt werden. Große Kanonen rauchen ratzfatz den Ort des Geschehens zu, und für eine Weile kann man kaum ein Objekt vor sich klar erkennen.
••• * Ich bin nicht sicher, ob der Artikel überhaupt noch im Netz stehen darf, denn SpiegelOnline hat ihn spurlos verschwinden lassen und auf Herrn Broders Homepage findet er sich auch nicht mehr. Aus Vorsicht biete ich also keinen Link dahin an. Kann aber in jeder halbwegs ausgestatteten Bibliothek nachgelesen werden in Spiegel No 7/2004, »Steckrüben der Stalinisten« •••
Andere Lesermedlungen wußten das wummernde ideologisch-historische Gefecht außen vor zu lassen. Doch selbst unter denen, die es verstanden haben »Endstufe« als modernen Roman zu lesen, konnten nicht alle die überreich mit Konventionsbrüchen herausfordernde Lektüre ertragen, und kanzelten sie als eine geschmacklose ab.
••• Empfehlung dazu: Unglaublich schmissig und vergnüglich zu lesen ist die Kritik zu »Endstufe« des Blog-Kollegen praschl, deren Aussage und Urteil ich aber nicht zu teilen vermag. Aufschlußreich sind auch die der Besucher-Kommentare und deren ordentlich pubertäre Abwehr- und Bannungsformeln, sprich: Lächerlichmachungen des Autors und Lustfeindlichkeits- und Verklemmtheitsvorwürfe gegen ihn. Die Überlegung drängt sich mir auf, ob der Herrn praschl möglicherweise seinen verletzten Stolz als Besitzer einer exquisiten Dildosammlung zu rächen hatte. Kann sein, er ist so ein lockerer, offener Typ, auf dessen Wohnzimmercouch sitzend man einer Aussicht auf lustversprechendes Plastik ausgesetzt ist.}•••
Solch eine Einschätzung des Buches läßt mich lernwillig nachfragen, nach welchen Prämissen sich aus dem Ideenknäul Drittes Reich, Pornographie und Elitendekadenz etwas Geschmackvolleres stricken ließe? Globale Biopolitik ist ein kaltes und zutiefst verstörendes Thema, eines der unsentimentalsten Problemfelder der Gegenwart und das nicht erst seit gestern oder vorgestern. Doch warum sollte man gleich abwinkend zusammenzucken, wenn ein Sprachakrobat versucht, Romanlesern eine lächerlich-gruselige Aussichtsplattform auf diesen Abgrund anzubieten?
Das ist in keinster Weise höhnisch gemeint, sondern aufgrund der Erfahrung, daß für manche Narrationskundschaft die Leni Riefenstahl-Zitate in dem Disney-Zeichntrick »Der König der Löwen« schon ein zu selbstverständliches Aufgreifen von mit Nazis konnotiertem Medienhandwerk darstellen. Gerade weil »Endstufe« ein respektloses Graffiti an den manichäischen Mauern der Großdeuter von Gut und Böse darstellt, zog es wohl so viel Unbill auf sich. Dabei gehört das respektlose Beschmieren der Landmarken der Metaphysik zu den charakteristischsten Handlungen von moderner und engagierter Literatur. Es finden sich in Deutschland aber eben zu selten Autoren (oder Autorinnen) die den Mut aufbringen, sich mit den großen konkurrierenden Gesamtmenschheitswidrigkeiten auseinanderzusetzen, und nicht nur mit den lokalen Fieberdelirien zerbröselnder Nationalgemütlichkeiten.
Das Blobbel-Konzentrationslager Erste Welt
Abgesehen davon, daß mich schon Thor Kunkels Erstlingswerk »Das Schwarzlicht Terrarium« (2000) außerordentlich begeisterte, war ich neugierig, welche Spannungen und Harmonien zwischen Nazivergangenheit und Globalitätsgegenwart durch »Endstufe« wie zum klingen oder knattern gebracht werden.
Mein persönliches Verhältnis zu der Frage, wie offen oder abgeschlossen die Beziehungen zwischen dem Dritten Reich und der aktuellen Fortschrittszivilisation sind, möchte ich durch ein Zitat illustrieren. Der amerikanische Science Fiction-Autor Philip K. Dick schreibt in einer Anmerkung (1979) zu seiner Kurzgeschichte »Ach, als Blobbel hat man's schwer« (1963):
»Ich habe beim Schreiben {…} an den Krieg allgemein gedacht; vor allem daran, wie sehr der Krieg jemanden zwingt, so zu werden wie sein Feind. Hitler hat einmal gesagt, die Nazis hätten denn einen wahren Sieg errungen, wenn sie ihre Feinde, allen voran die Vereinigten Staaten, dazu zwingen könnten, so zu werden wie das Dritte Reich – d.h. zu einem totalitären Gesellschaftssystem –, um den Krieg zu gewinnen. Hitler hoffte, damals selbst bei einer Niederlage noch auf einen Sieg. Als ich sah, wie die amerikanische Rüstungsindustrie nach dem zweiten Weltkrieg immer höhere Zuwachsraten verbuchte, kam mir Hitlers These wieder in den Sinn, und ich wurde den Gedanken nicht los, daß der Scheißkerl verdammt recht gehabt hatte. Wir hatten Deutschland besiegt, doch sowohl die USA als auch die UdSSR mit ihren riesigen Polizeiapperaten wurden den Nazis von Tag zu Tag ähnlicher. Nun ja, ich hatte den Eindruck, die ganze Geschichte entbehre nicht eines gewissen sarkastischen Humors (in Grenzen).{..} Was mußte in Vietnam erst aus uns werden, um den Krieg zu verlieren, an einen Sieg gar nicht zu denken; können Sie sich vorstellen, was aus uns hätte werden müssen, um zu siegen? Hitler hätte sich wahrscheinlich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, und zwar auf unsere Kosten… wie so viele Lacher letztlich auf unsere Kosten gingen. Und die klangen hohl und grausam, ohne jede Spur von Humor.«
•••»Zur Zeit der Perky Pat«, Haffmans 1994; nur die Geschichte auch in »Minority Report«, Heyne 2002.
Wie sehr wurde die Zukunft der Menschheit von den Nazis infiziert, und ist der entsprechende Virus ein genuin Deutsch-Nationalfaschistischer? Neben offenkundigeren Auswirkungen, wurde das 20. Jahrhundert durch das Dritte Reich auf eine sehr tückische Art infiziert, denn es hat sich bekannterweise erwischen lassen und wurde völlig zurecht – und mit Entsetzten – für seine unmenschlichen Untaten verurteilt. Mit gelassener Paranoia will ich vermuten dürfen, daß es nachfolgenden, allzu menschlichen totalitären Zukunftsgestaltern als lehrreiche Warnung gemahnte, sich eben fürderhin nicht erwischen zu lassen. Dem Auftreten von Verschwörungstheorien und anderen Harlekinaden der Phantasie sind damit Tür und Tor geöffnet, und zurecht mag man solche Spekulationen den Fabulieren, Mannierlichen und Nüchternen verzeihen, aber nicht den Berichterstattern, Gehässigen und Hysterischen. Schlechte Nachrichten – und die Entlarvung des Romans »Endstufe« als Rohrkrepierer revanchistischer Couleur wäre eine solche – sollten ruhig und klar begründet vermeldet werden.
Welche Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg bieten sich denn besipielsweise an oder drängen sich auf, wenn man heute (und in der nahen Zukunft) Ausschau hält, zum Beispiel nach Unternehmungen einer künstlichen Selektion und Zucht von Menschen im großen Maßstab? Versucht man sich das vorzustellen, bedenkt dabei den Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft, und orientiert sich grob an Allerweltsroutinen der Machtausübungspraxis – teile und herrsche; dezentralisiere und diversifiziere die Mittel; lärme im Osten und greife im Westen an; sähe Angst und bündle Hoffnung, und dergleichen mehr –, werden ehr früher als später Facetten des Unmenschlichen oder des Lebensentwertenden in der Gegenwart empfindbar.
Wenn mit der erwiesenen Umrundbarkeit der Erde, der Mensch traumatisiert ins unheimliche Äußerste ent-wohnt wurde, und durch die Reiseberichte der Ethnologen sich eine mannigfaltige Exotik der Conditio Humana verstörend vor uns kollektiven und individuellen Weltenentdeckern auftat, so hat das ans-Licht-Bringen der arischen Endlösungsmachenschaften größere Illusionsblasen über das Ausmaß menschenmöglicher Bestialität platzen lassen. Den sich ergebenden schmerzlichen Zwiespalt – die Wachsamkeit für ein »Nie wieder Ausschwitz!« zu wahren, jedoch auf die Gefahr von der permanenten Vergegenwärtigung des Grauens gelähmt zu werden – vermochte die Menschheit damals mit dem Anklagebegriff »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« zu bannen. Und während die Zivilisierten sich noch in Klausur darüber befinden, was in der Geschichte der (sagen wir) letzten 500 Jahre und seit Ende des Zweiten Weltkrieges ebenfalls als solches Verbrechen einzuordnen sei, bringen nur wenige den Mut auf klarzustellen oder zuzugeben, daß die posthumanistische Epoche nicht mehr abzuwenden ist, ja sogar im vollem Gange ist.
Mit dem Fiktionsvertrag ins Dritte Reich™
Vielleicht hätten mehr Rezensenten eine wohlwollendere Haltung gegenüber »Endstufe« gefunden, wenn der Roman sich weniger auf die Kokurrenz mit grellen und überzeichneten Narrationswelten, weitestgehend schon gewöhnlich bei Filmen, Bildliteratur und PC-Spielen, eingelassen, und sich zudem eines gemäßigteren oder erhabenerem Tons bedient hätte. Da mir das Buch gefallen hat, darf ich vielleicht eine Erklärung anbieten, warum der Autor mit seinem Buch und die Kritiker mit ihren Erwartungen sich beim Aufeinandertreffen weitestgehend mißverstehen mußten: Kunkel und Eichborn wiesen zu wenig auf den Komik- und Satireaspekt hin, wo die Kritiker doch einem Tatsachen-Enthüllungsroman entgegengefibbert haben. Bei solchen Ausgangspositionen nimmt es nicht wunder, daß faire Formen des Fiktionsvertrages nur selten zustande, und bislang kaum zur Sprache gekommen sind.
Betrachtet man eine Romanlektüre unter dem Gesichtspunkt des Fiktionsvertrages, wird Vertrauen zu einer entscheidenden Bedingung, und die Kontroverse um »Endstufe« stellt sich dann vor allem als aufgeregte Verunsicherung darüber dar, welche narrativen Bespiegelungen des Dritten Reiches zulässig sind und welche eben nicht. »Endstufe« bietet sich als Provokationsfiktion an, die als ernsten Basso Continuo die monströsen Diskurse zur Biopolitik und Anthropotechnik brummen, andererseits sprachparodistisch und thriller-komödiantisch Trivialgenre-Register präludieren läßt. Das Panorama, das »Endstufe« entfaltet, paart Zynik mit Slapstik, reiht Monströses an Haarsträubendes, jongliert mit Zitaten unterschiedlichster Herkunft und ratlos machenden Hinweisen. Selbst aus einer Nasenklammer – ohne die im Schlaf zu ersticken sich der Protagonist Fußmann panisch ängstigt –, wird ein Symbol des technikvertrauenden Menschen.
Es gehört zu den Fähigkeiten von Romanen, den Lesern Trost und Hoffnung zu spenden, Halt und Rat zu bieten, oder auf sinnlich-touristische Gedankenreisen mitzunehmen, und wie bereitwillig wird den Autoren denen solche Bücher gelingen Respekt und Lob entgegengebracht. Fern von solchen Annehmlichkeiten, kann man in »Endstufe« schon ziemlich vergeblich nach unbedenklichen Identifikationsfiguren für entspannungsbedürftige Leser suchen (abgesehen vielleicht von einem Frankfurter Privatdetektiv, dessen Recherchen nach dem in Amerika verschollenen Fußmann das Buch abschließen {oder für die ganz Abgebrühten: vielleicht Heinz Rühmann mit seinen Cameoauftritten als Spanner?}).
Keine Helden, keine poetische Moral, nur menschliche Abgründe und moralische Sprengsätze. Wer Fiktionsverträge mit »Endstufe« eingegangen ist, die zu Interpretationen führen, daß Kunkel den Holochaust nichten wolle, hat zum Beispiel die Furcht des Protagonisten vor dem KZ, daß ihm als kapitaler Sittenstrolch droht überlesen (S. 180), wie auch auffälligere Hinweise auf die Selektions- und Todespolitik des NS-Regimes. Thor Kunkel stellt noch vor Handlungsbeginn die Höllenfahrtscharakteristik und die auf den Kopf gestellten Konvention des Buches klar, beginnend mit hybriden Widmungspersonal
Für Jesus, Nietzsche, Mohammed{…}
fortfahrend mit punkderber Oswald Spengler-Zitatverfremdung als eines der beiden Motti
Sex
Das Geld wird nur vom Blut überwältigt und aufgehoben.
bis zum zweiseitigen Vorspann mit einer Opiumrauschvision über das heutige Berlin des Lebensborngynäkologen Pfister {Fickprotokollautor der Sachsenwaldfilme}, nebst seinen alternativen Rassegesetzten
1. Legislativ richtig ist, was evolutionär richtig ist.
2. Keine Jurisdiktion ohne genetisches Zeugnis.
3. Ist die Exekutive sexy, freut sich der Exekutierte.
Zumindest ich konnte mich nicht hineinsteigern in die Annahme, daß »Endstufe« beansprucht, eine argumentativ wohlbesonnene und beruhigend dargebrachte Narration zu sein.
Als Comicleser habe ich schließlich anerkennend genickt, als im Lauf des Handlungshollerdimott sogar auf das Superheldenmotiv und seine Herkunft (Doctor Magneto – Seite 487) angespielt wurde. Indem der Schluß ambivalente Lesarten zuläßt – entweder als Fußmanns Sehnsuchtshalluzination nach seiner toten Angebeteten, oder als indirekte Schilderung einer science-fictionhaften Begegenung der »elektrozoischen« Art –, lädt »Endstufe« seinen letzten Spott auf Humanismusutopien ab, in denen man für sich zwar beansprucht wie ein Vegetarier zu denken, sich aber wie ein Fastfoodkunde benimmt.
•••
Weitere Molochronik-Beiträge zu Thor Kunkel und seinen Roman »Endstufe«:
• Wahnwellenversprengtes Denken aufgrund Melange aus literarischer Inkompetenz und mieser Profilierungspraxis {Gesellschaft – Über Angriffe des Frankfurter AStA gegen Andrea wegen der »Endstufe«-Lesung am 20. April im Uni-Campus West.}
• Die Welt durch die Brille von Kultur-Gonzos: Die Nazi-Mädels vom Kulturzentrum der Uni Frankfurt {Grafimente – Zum Kulturzeit-Bericht von Tilman Jens über die »Endstufe«-Lesung am 20. April.}
• Hitler-Geburtstag als Journaillien-Fetisch {Über die Zeitungsreaktionen auf die »Endstufe«-Lesung am 20. April.}
• Skribbel für Thor Kunkel {Grafimente – Zwei lustige Blätter.}
• Verlag mag nicht {Zur Meldung, daß Rowohlt »Endstufe« ablehnt und Eichborn übernimmt.}
•••
WOANDERS: Auf den Seiten von Single-Generation findet sich eine brauchbare Übersicht zu »Endstufe« und den Rezensionen.
Und: ich habe im Scifi-Forum einen Thread zu »Endstufe« gestartet.
 — Tausendeinundvierzig Seiten, sechsundzwanzig s/w-Abbildungen, viele hilfreiche Fußnoten, ein ausführliches und anregendes Nachwort inklusive einem Vergleich verschiedener bisheriger Übersetzungen, sowie eine sechszehnseitige ›sprechende‹ (also synopsierende) Inhaltsangabe. »Das Kritikon«: ein Monsterschmöker aus dem spanischen Barock (1651-1657). Klingt nicht nach einem mal so nebenbei und schnell wegzulesendem Buch, sondern nach einem das genug Reichhaltigkeit, Tiefe, Details und Gewitztheit bietet, um den Leser über eine längere Zeitdauer zu begleiten. Nichts weniger als eine überbordende Vorstellung eines Großen Weltentheaters, ein universalsatirisches Panorama breitet der Jesuit Baltasar Gracian (1601-1658) hier aus. Der Autor ist in Deutschland hauptsächlich für sein von Arthur Schopenhauer übersetztes »Handorakel oder Die Kunst der Weltklugheit« bekannt.
— Tausendeinundvierzig Seiten, sechsundzwanzig s/w-Abbildungen, viele hilfreiche Fußnoten, ein ausführliches und anregendes Nachwort inklusive einem Vergleich verschiedener bisheriger Übersetzungen, sowie eine sechszehnseitige ›sprechende‹ (also synopsierende) Inhaltsangabe. »Das Kritikon«: ein Monsterschmöker aus dem spanischen Barock (1651-1657). Klingt nicht nach einem mal so nebenbei und schnell wegzulesendem Buch, sondern nach einem das genug Reichhaltigkeit, Tiefe, Details und Gewitztheit bietet, um den Leser über eine längere Zeitdauer zu begleiten. Nichts weniger als eine überbordende Vorstellung eines Großen Weltentheaters, ein universalsatirisches Panorama breitet der Jesuit Baltasar Gracian (1601-1658) hier aus. Der Autor ist in Deutschland hauptsächlich für sein von Arthur Schopenhauer übersetztes »Handorakel oder Die Kunst der Weltklugheit« bekannt.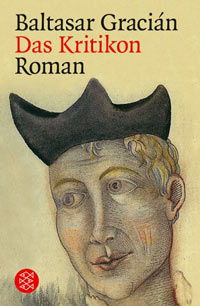 Oberstes Stilkriterium für einen guten Text war damals die Fähigkeit eines Autors zur scharfsinnigen Rede, und obwohl die Sinnes- und Erscheinungswelt für Gracian trügerisch und größtenteils von Übel ist, stellt er klar fest, daß ein schönes Geplauder in angenehmer Atmosphäre ein löbliches Vergnügen ist. Subversion ›schon‹ in dieser alten Zeit, wenn Gracian also weiß, daß ohne den Köder des gut Unterhaltenden man gar nicht erst anzufangen braucht, den Menschen Lebensweisheit und Kultiviertheit vermitteln zu wollen.
Oberstes Stilkriterium für einen guten Text war damals die Fähigkeit eines Autors zur scharfsinnigen Rede, und obwohl die Sinnes- und Erscheinungswelt für Gracian trügerisch und größtenteils von Übel ist, stellt er klar fest, daß ein schönes Geplauder in angenehmer Atmosphäre ein löbliches Vergnügen ist. Subversion ›schon‹ in dieser alten Zeit, wenn Gracian also weiß, daß ohne den Köder des gut Unterhaltenden man gar nicht erst anzufangen braucht, den Menschen Lebensweisheit und Kultiviertheit vermitteln zu wollen.
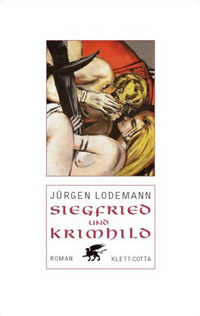
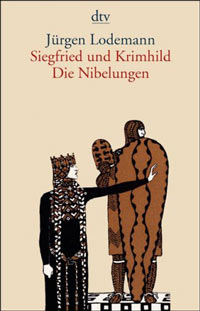

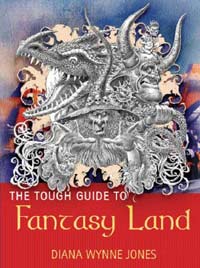 Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert.
Bereits 1996 hat Diana Wynne Jones ihren »Tough Guide to Fantasyland« in England veröffentlicht, der in fast 500 alphabethischen Einträgen von ›Adept‹ bis ›Zombies‹ die typischen Eigenheiten dieser Literatur kenntnisreich aufzählt, und spöttisch analysiert. Eintrag No. 222 — Prolog: Im Louvre mordet nächtlings ein bleicher Schreckensmönch den Kurator. Der Mörder flüchtet, das Opfer stirbt mit zwanzigminütiger Verzögerung und hat noch die Fassung, sich selbst zum Anfangsrätsel einer Schnitzeljagd zu drapieren. Das Abenteuer eines amerikanischen Historikers Landon und einer
Eintrag No. 222 — Prolog: Im Louvre mordet nächtlings ein bleicher Schreckensmönch den Kurator. Der Mörder flüchtet, das Opfer stirbt mit zwanzigminütiger Verzögerung und hat noch die Fassung, sich selbst zum Anfangsrätsel einer Schnitzeljagd zu drapieren. Das Abenteuer eines amerikanischen Historikers Landon und einer  Aber ich komme vom Thema ab. Moment — hmm, wundert mich, daß die Katharer nicht erwähnt werden. Sei's drumm — immerhin: Templer
Aber ich komme vom Thema ab. Moment — hmm, wundert mich, daß die Katharer nicht erwähnt werden. Sei's drumm — immerhin: Templer 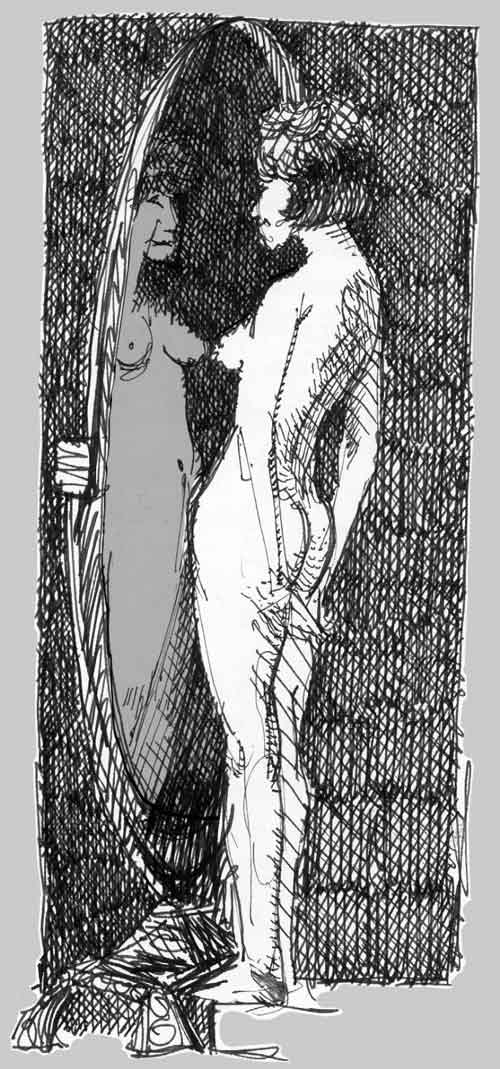





 Eintrag No. 144 – Eine weitere
Eintrag No. 144 – Eine weitere  Die »Wilden Hunde« ist sein bisher verspieltester und abenteuerlichster Roman, vielleicht auch sein hellster und freundlichster, den Zwölf- bis Hundertundzwölfjährige mit Vergnügen lesen können. Mit aufregend-schrägen Ideen und Bildern, grotesker und phantastischer Sprache kann Krausser jounglieren, wie sonst nur wenige lebende Hiesige ... vor allem bei seinen Gegenwartsromanen (»Thanatos«, »Der Große Bagarozy«, »Schmerznovelle« und zuletzt »UC - Ultrachronos«) war das für die Anhänger des zahmen Realismus oder der schlichten Unterhaltung manches male zu viel des Wilden und Gekrümmten.
Die »Wilden Hunde« ist sein bisher verspieltester und abenteuerlichster Roman, vielleicht auch sein hellster und freundlichster, den Zwölf- bis Hundertundzwölfjährige mit Vergnügen lesen können. Mit aufregend-schrägen Ideen und Bildern, grotesker und phantastischer Sprache kann Krausser jounglieren, wie sonst nur wenige lebende Hiesige ... vor allem bei seinen Gegenwartsromanen (»Thanatos«, »Der Große Bagarozy«, »Schmerznovelle« und zuletzt »UC - Ultrachronos«) war das für die Anhänger des zahmen Realismus oder der schlichten Unterhaltung manches male zu viel des Wilden und Gekrümmten. Früh schon begegnete ich als Teen Tad Williams »Traumfänger und Goldpfote« (Tailcatcher's Song), den ich auf Deutsch gelesen habe. Für mich damals eine erfreuliche Abwechslung von meinen ausführlichen Wanderungen im Land der harten Männerhelden, wo ich mich mit Hawkmoon, Conan, dem Grauen Mausling und ähnlichen Burschen herumgetrieben habe. Diesen Katzen-Fantasy-Roman empfehle ich heute noch gerne. Eine gute Dekade später robbte ich mich als Twen vier Jahre lang durch »Der Drachenbeinthron« (Memory, Sorrow, and Thorn). Es war schrecklich. Was für eine sich zum Leser kuscheln wollende elephantitische Herzschmerzwalkerei! Was für ein offensichtliches Recycling des Bildbestands und der zivilisatorischen Attribute bekannter historischer Kulturen. Unter anderem fand ich nur spärlich verkleidete Wikinger, Indianer, Japaner, Afrikaner, komplett mit Merlin, Vatikan und Cameron-Aliens-Monstern. Selten schaffte ich mehr als 200 Seiten am Stück, und »Der Drachenbeinthron« umfaßt dreitausendsechshundertsechszehn Seiten
Früh schon begegnete ich als Teen Tad Williams »Traumfänger und Goldpfote« (Tailcatcher's Song), den ich auf Deutsch gelesen habe. Für mich damals eine erfreuliche Abwechslung von meinen ausführlichen Wanderungen im Land der harten Männerhelden, wo ich mich mit Hawkmoon, Conan, dem Grauen Mausling und ähnlichen Burschen herumgetrieben habe. Diesen Katzen-Fantasy-Roman empfehle ich heute noch gerne. Eine gute Dekade später robbte ich mich als Twen vier Jahre lang durch »Der Drachenbeinthron« (Memory, Sorrow, and Thorn). Es war schrecklich. Was für eine sich zum Leser kuscheln wollende elephantitische Herzschmerzwalkerei! Was für ein offensichtliches Recycling des Bildbestands und der zivilisatorischen Attribute bekannter historischer Kulturen. Unter anderem fand ich nur spärlich verkleidete Wikinger, Indianer, Japaner, Afrikaner, komplett mit Merlin, Vatikan und Cameron-Aliens-Monstern. Selten schaffte ich mehr als 200 Seiten am Stück, und »Der Drachenbeinthron« umfaßt dreitausendsechshundertsechszehn Seiten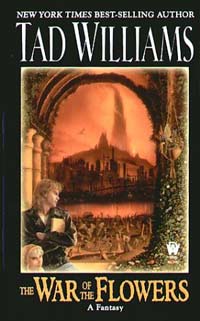 Das Buch liefert darüber hinaus auch einige wirklich mitteilenswerte und beherzigenswerte Gedanken und Ideen, nämlich: Daß Rassismus, Angst vor Fremden oder Klassenarroganz böse sind; daß Reden und Handeln sich nicht (allzu sehr) widersprechen sollten; daß die US-Amerikaner (und die Erste Welt) ruhig mal geduldiger die Aufmerksamkeit über den Tellerrand ihres simplen Schwarz/Weiß-Weltbildes richten können; daß auch für Hegemonialmächte gilt: »Niemals rechtfertigt der Zweck alle zur Wahl stehenden Mittel«. Viel Kritikerliteratur wird für empfindsam-intellektuelles Geklapper gelobt und bietet doch nicht halb so viel Fruchtfleisch wie dem Tad sein ›Genre-Trash‹.
Das Buch liefert darüber hinaus auch einige wirklich mitteilenswerte und beherzigenswerte Gedanken und Ideen, nämlich: Daß Rassismus, Angst vor Fremden oder Klassenarroganz böse sind; daß Reden und Handeln sich nicht (allzu sehr) widersprechen sollten; daß die US-Amerikaner (und die Erste Welt) ruhig mal geduldiger die Aufmerksamkeit über den Tellerrand ihres simplen Schwarz/Weiß-Weltbildes richten können; daß auch für Hegemonialmächte gilt: »Niemals rechtfertigt der Zweck alle zur Wahl stehenden Mittel«. Viel Kritikerliteratur wird für empfindsam-intellektuelles Geklapper gelobt und bietet doch nicht halb so viel Fruchtfleisch wie dem Tad sein ›Genre-Trash‹. In der Provinz treibt sich Theo in einem nahen Kaff herum, stöbert im Archiv nach Infos über den Großonkel und verguckt sich in die Bibliothekarin. Ein Komissar aus Frisco schaut aus Routine bei Theo vorbei, weil Folgebesitzer von Mutters Haus bestialisch zerschnetzelt aufgefunden wurden. Kurz darauf greift denn nun auch ein dämonisches Wesen Theo in seiner Waldhütte an. Doch die kleine Elfe Apfelgriebs — ein fliegendes Klischee mit irischem Akzent und roten Haaren, wie Julia Roberts in »Hook« in deftiger, upgedatet um einige Shakespeare-Zeilen — taucht auf, um Theo zu retten. Schuppdiwupp, flüchten beide durch ein kleines Portal nach Elfien.
In der Provinz treibt sich Theo in einem nahen Kaff herum, stöbert im Archiv nach Infos über den Großonkel und verguckt sich in die Bibliothekarin. Ein Komissar aus Frisco schaut aus Routine bei Theo vorbei, weil Folgebesitzer von Mutters Haus bestialisch zerschnetzelt aufgefunden wurden. Kurz darauf greift denn nun auch ein dämonisches Wesen Theo in seiner Waldhütte an. Doch die kleine Elfe Apfelgriebs — ein fliegendes Klischee mit irischem Akzent und roten Haaren, wie Julia Roberts in »Hook« in deftiger, upgedatet um einige Shakespeare-Zeilen — taucht auf, um Theo zu retten. Schuppdiwupp, flüchten beide durch ein kleines Portal nach Elfien.