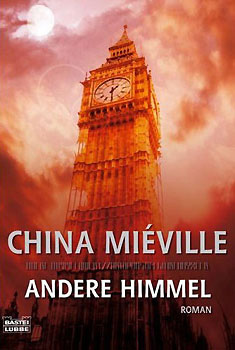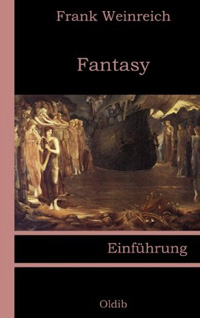Danke Frau Prof. Dr. Monika!
Eintrag No. 399 — Als ob es ein Gutzi für das heutige 2000-Tage-Jubiläum wär, stolpere ich über die frischest hochgeladenen Skripte von Frau Dr. Prof. Monika Schmitz-Emans, die im Sommer dieses Jahr eine elfteilige Vorlesungsreihe über Phantastische Literatur an der Uni Bochum gehalten hat. Soweit ich sagen kann, lohnt es sich die PDFs dort runterzuladen und zu verköstigen, obwohl Monika erstmal — wie so viele — auf Todorovs mir sehr unsympathischer »Einführung…« aufbaut. Aber wie ich in letzter Zeit desöfteren erleben durfte, kann man den guten T. auch vorzüglich als Bocksprungunterlage nutzen.
Die wilden Welten von Matt Ruff (1): Ein persönlich gefärbter Werksüberblick
{07. November 2009: Der ürsprüngliche Eintrag über »Bad Monkeys« und die Romane von Matt Ruff wurde durch die erweiterte »Magira 2008«-Fassung ersetzt.
}
Für
»Magira 2008« habe ich anders als in den Jahren zuvor und danach keine Sammelrezension geliefert, sondern mich auf das Werk eines einzigen Autors – Matt Ruff – konzentriert.
Für die Molochronik-Leser habe ich diesen langen Beitrag in zwei Teilen aufbereitet. Hier könnt Ihr meinen persönlich gefärbten Werksüberblick zu den bisher vier Roman von Matt Ruff lesen. —
Teil zwei enthält mein Gespräch mit Matt, dass ich anläßlich seiner
»Bad Monkeys«-Deutschlandlesetour im Februar 2008 in Frankfurt führen konnte.
Wie immer habe ich den Herausgebern Michael Scheuch und Hermann Ritter, den Korrekturlesern und Layoutern von »Magira« für ihre Unterstützung zu danken. Besonderen Dank schulde zudem ich dem Hanser-Verlag für seine Aufgeschlossenheit, sich auf einen Amateur-Journalisten wie mich einzulassen, und natürlich danke ich Matt Ruff selbst für seine Großzügigkeit und seine Hilfe bei der Nachbearbeitung des Interviews.
Bei
Wieland Freund möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich seine Schriften stellvertretend im Folgenden als Sandsack für Argumentationsschläge missbrauche.
•••••
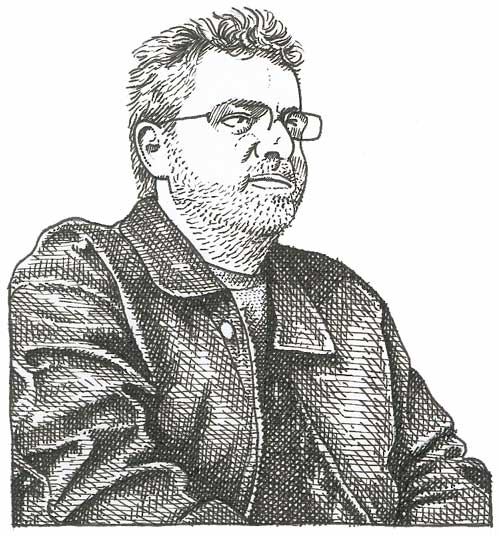 Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.
Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.
Matt Ruff hatte es als 23-Jähriger das Glück, mit einem solchen Kultbuch zu debütieren: »Fool on the Hill« (1988). Wohl besser als gelehrige Beschreibungen, veranschaulicht wie ich finde Folgendes, was ein Kultbuch auszeichnet. Als ich vor gut 15 Jahren einem mit Herzeleid und Sinnkrise geschlagenen Freund eine deutsche Taschenbuchausgabe »Fool on the Hill« geschenkt habe, und wir uns nachdem er es gelesen hatte auf einer Fantasy-Con wieder begegneten, raunte mir dieser Freund dankbar zu, wie erstaunlich punktgenau dieser Roman tröstende Kraft und gemütserweiternden Perspektivwechsel gespendet hat. Ruff ist bei Weitem nicht der einzige moderne Phantast, der über die Macht und die Magie des Geschichtenerzählens schreibt, aber als mir mein Freund dann erzählte, dass er abwechselnd dachte, beim Lesen Wahnsinnig oder erleuchtet zu werden und zeitweise den Verdacht hegte, das ich Gott sei, merkte ich auf. Einmal, weil es selbst unter guten Freunden peinlich und beschämend ist, wenn man derart heftige Komplimente entgegenzunehmen hat, dann auch, weil dieses Gespräch auch für mich ein Aha-Erlebnis war. Mein Temperament als vorlauter Skeptiker und Fan des Abstrusen machen es mir schwer mit allzu tröstlichen oder idyllischen Stoffen warm zu werden. »Fool on the Hill« empfahl ich damals gerne, weil der Roman flotten Popkornspaß bietet und dennoch Tiefgang hat, weil er augenzwinkernd Popkulturanspielungen anbringt und auf überraschende Art aus dem System springt, Seitenschritte macht, die mich zu Grübelein und Gedankenwanderungen anregten. Mein Freund machte mir klar, wie wichtig diese Fähigkeit von Romanen sein kann, wenn uns Lesern durch sie reinigende Erregungen, tröstendes Kopfzurechtrücken zuteil wird.
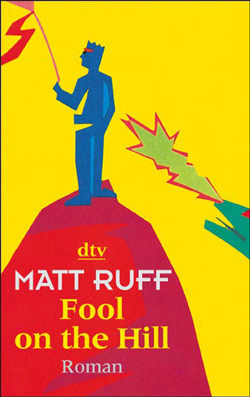 »Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.
»Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.
Worum geht es? Zentraler Held ist Stephen Titus George, ein Geschichtenerzähler, also ein Lügner, der eine Hilfsdozentenstelle an Cornell Uni inne hat; der sich optimistisch aber einsam nach der ganz großen Liebe sehnt; der beim Drachensteigenlassen mit Hunden über seine fehlgeschlagenen Liebelein plaudert; der gesegnet ist mit dem Talent durch seinem Tanz den Wind zu beschwören und nicht ahnt, dass er von niemand geringeren als einem über alle Geschehnisse des Romans wachenden griechischen Gott (ebenfalls ein Fabulator aus Leidenschaft) auserkoren wurde, ein Heiliger der Tagträumerei zu sein, ein Drachenbezwinger zur Bewahrung des chaotisch-friedlichen Miteinanders der Campus-Welt in der Nußschale. — »Fool on the Hill« erzählt aber auch die Geschichte von dem naiven Mischlingshund Luther und dem auf ihn aufpassenden Kater Blackjack, die sich von der Süd-Bronx aus aufmachen den Hundehimmel zu finden, und deren Queste, bei der sie den Groll von faschistoischen Hunderudeln auf sich ziehen, sie zur Ithaca-Uni führt. — Schließlich ist das Campusgelände auch die Heimstätte von kleinen Elfenwesen, unter ihnen tollkühne Modellflugzeugpiloten und -Schiffskapitäne, die nächtens Tiere aus dem medizinischen Versuchslabor zu befreien trachten und sich vor der Rückkehr des Koboldmagiers Rasferret und seiner Rattenarmee fürchten. Dieser in der Büchse der Pandora begrabene Wicht vermag Lebloses in golemartige Killermonster zu verwandeln, am schrecklichsten gelingt ihm das mit der horrorverbreitenden Gummibraut, dem Sexpuppenmaskottchen einer von Mittelerde begeisterten Studentengruppe des Tolkienhauses. Davor, daneben und dazwischen tummeln sich viele kleine Geschichten in der Geschichte wie die vom Mann mit der Phobie vor der Zahl 13, dem Einritt der subversiv-anachistischen Bohemier-Studentenkumpel von Stephen in ein Provinzkaff und ihr dortigers Gefecht mit einer Bikergang. Die vielleicht schönsten Eigenschaften von »Fool on the Hill« sind, dass der Roman trotz der ein oder anderen wackeligen Stelle überhaupt funktioniert, und der abenteuerliche, gerade mit der richtigen Priese Melancholie gesprenkelte Optimismus, mit dem der Roman seine Leser entlässt.
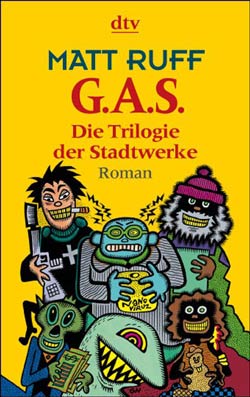 Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).
Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).
Oberflächlich betrachtet wird den Lesern hier eine wendungsreiches ›Science Fiction Fantasy Verschwörungsthriller‹-Prosacomic geboten. Die atemberaubenden Tumultszenen von »G.A.S.« wirken auf mich, als ob sie einem der exzellenteren SF-Animes, wie »Akira« oder »Robot Angel«, entfleucht sind. »G.A.S.« ist, was die bitterböse Groteskerie seiner phantastischen Übertreibungen angeht, der satirischste und bittertste Roman von Ruff, was sich vor allem in den Ungeheuerlichkeiten des übertriebenen politisch-gesellschaftlichen Aspekten Weltenbaus niederschlägt. Aber Ruff gibt Acht, dass seine Sprache nicht ausser Rand und Band gerät, sondern er präsentiert seine schrägen Ideen und facettenreichen Diskurse des Buches mit lockerem Ton und lebendigen Reden.
Die Jahre 2023 angesiedelte, jedoch immer weider von Rückblenden unterbrochene Handlung, konzentriert zum einen auf New York, wo der reichste Mann der Welt, der Erfinder und Großindustrielle Harry Gant einen gigantischen neuen ›Babel Tower‹ errichtet hat, zum anderen auf Schauplätze in Florida, den Atlantik und Kalifornien. Gant hat sein unverschämt vieles Geld mit den sogenannten ›Elektronegern‹ verdient, Androiden die groß in Mode kamen, nachdem fast die gesamte schwarzhäutige Weltbevölkerung von einer mysteriösen Seuche ausradiert worden ist. Ein Wall Street-Konkurrent von Gant wurde, wie es scheint, von einem solchen Roboter dem die durch Isaac Asimov bekannten Sicherungen durchgebrannt sind gekillt, was natürlich ganz schlecht für Gants Geschäftsimperium wäre. Also engagiert er der Publicity wegen seine radikalliberale Ex-Frau, die sich zusammen mit einem fast 200 Jahre alten Veteran des Amerikanischen Bürgerkrieges aufmacht, den Mord aufzuklären. — Auch die bunte Ökoterroristentruppe um den begnadeten Saboteur-Künstler Philo Dufrense bereitet mit ihrem bunten Wunder-U-Boot ›Yabba-Dabba-Do‹ dem megareichen Industriekapitän Gant Probleme. Darüberhinaus sorgt ein mutierter Monsterhai namens Meisterbrau in den Kanalisationseingeweide von New York für Angst und Schrecken und irgendwo hinter den Kulissen heckt eine durchgeknalle Künstliche Intelligenz wegen eines Hörfehlers Pläne aus, die selbst Hartgesottenen eine Gänsehaut bescheren dürfte. — Der Roman knöpft sich kreuz und quer in diesem schnellgeschnittenen Gewusel sehr frech und engagiert verschiedene brachial-positivistische Gesellschaftsknetenwoller und ihre Großraumphantastik vor.
Egal wer »Hurrah, die Zukunft gehört uns!« ruft, ob Kapitalisten, christliche Pfadfinder, Geheimdienststrippenzieher oder die Verwalter des dunklen Vermächtnis von Disneyland, sie alle bekommen ihr Fett ab. Am aufregendsten ist dabei die in »G.A.S.« stattfindende Auseinandersetzung mit der bei uns weitestgehend unbekannten Ayn Rand, Erfinderin des ›Objektivismus‹, einer vulgär-materialistischen Kapitalismus- und Egoismusverherrlichung. Rand inspiriert bis heute als frappierend humor- und emphatiefreies Pinupgirl Chicago-Boys, Neocons & Neoliberale. Trotz all der munter-skurielen Abstrusitäten und der zahllosen schrägen Typen wird der Leser am Ende in eine etwas bedrückende Stimmung entlassen, was aber angesichts des seit Erscheinen des Romanes ehr heftiger als milder gallopierenden Infowar-Wahnsinns die angemessene Spötterei auf hegemoniestützende Märchen vom Ende der Geschichte ist. Also ist Vorsicht oder Lesewagemut gefordert, damit man beim Lesen nicht von auf mehrfache Schallgeschwindigkeit beschleunigten Salamis K.O. geschlagen wird.
Um die für meinen Geschmack beeindruckende Reifung von Matt Ruffs Schreiben zu beschreiben, die sein nächstes Buch markiert, will ich kurz innehalten, um über die Reize und Gefahren seiner, und allgemein über phantastische Fabulationen, zu sinnieren und zwar im mir eigentlich gar nicht behaglichen, ja sogar unsympathischen weil anmaßenden ›Wir‹-Modus.
{Wir-Modus an} Aufmerksame Beobachter der kulturellen Weltläufte sagen, dass um ums herum ein Paradigmenwechsel abläuft. Das geschriebene Wort wird verdrängt vom photographierten, vom gefilmten, vom digital zusammengezauberten Bild. Keinesfalls teile ich die Ansicht, dass die erzählende Literatur durch diese vermeintlich unheilvollen Entwicklung ins Abseits gerät. Aber wer allein und lediglich schreibend erzählt, sieht sich vor die Wahl gestellt, ob man sich auf Leser spezialisiert, welche die neuen Medien meiden um lieber in den pietätvollen Gefilden der Literatur zu bleiben, oder ob man es als Geschichtenerzähler wagt, sich den Herausforderungen durch Blockbuster-Kino, TV-Serien und Computerwelten zu stellen. Wir, die mit zweiterem als etwas Selbstverständlichem aufgewachsen sind, und denen die Freuden und den Wert des ersteren nahezubringen man sich bei unserer Erziehung mühte, tun uns zuweilen schwer damit, wie vom Kulturestablishment unsere Popkultur als nichtiger oder gar gefährlicher Tüdelkram in die Schämecke geschickt wird. Man verzeihe mir, wenn ich zur Veranschaulichung hier einen fragmentarischen Remix einer solchen Skeptik zu den Freuden popkulturellen Fabulierens präsentiere:
Ruff ist ein Bewohner des Weltinnenraums, dieser vollklimatisierten, bildschirmgepflasterten, in sich selbst verdrehten Zone. … ein Nerd … Ruff bedient sich, wo er will … wie gerne Kinder sich Höhlen bauen, um darin zu kuscheln … Ruff kuschelt auch … (Fantasy ist unter anderem ein Globalisierungsphänomen) … Politisch korrekt war das bei Lichte besehen nicht, doch hat Ruff die Gabe, es dem Leser so gemütlich zu machen, dass der lieber liest, als nachzufragen. … Bilderbuch-Liberaler. … Manchmal allerdings geht es eben durch mit dem politisch korrekten Matt, vor allem beim Rennen, Retten, Flüchten und Schlagen und Schießen und Bluten. Eigentlich kommt kein Ruff-Plot ohne Tom-und-Jerry-Finale aus. … Am Ende spielen alle Bücher des Matt Ruff im Weltinnenraum der Fiktion und alles Außerhalb ist ihnen ein fernes, kaum mehr verständliches Echo.
{01}Nicht alle von uns, die wie Matt Ruff selige Tage der Adolszenz mit Rollenspielen, Comics, Soap- und SF-Serien verbracht haben, bleiben ewig treudoof unkritisch gegenüber unseren mit Postern, Action-Figures und Franchise-Icons geschmückten Kuschelhöhlen. Trotzdem (oder durchaus auch weil) wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit mit solchen Dingen wie Superheldenbiographien, Trading Cards und nicht zuletzt Weltenbau vertändeln, haben wir ein Gespühr sowohl dafür entwickeln können, dass sich die Athmo des Inneren so mancher altehrwürdigen Elfenbeintürme der Großraumphantastik-Verwalter kaum unterscheidet von der unserer infantilen Höhlen, und wie sensibel die Kulturtechniken zur Entwicklung, Installation, Instandhaltung von, und des Austausches zwischen Parzellen des klimatisierten (sprich: künstlichen) Weltinnenraums der Fiktion ist. Auch wir Fans von zuweilem arg schriller und eskapistischer Phantastik können, wie es ein Kenner der Materie beschreibt, mittels dieser
zu den Wurzeln unseres Denkens und Verhaltens vorzustoßen, was den Einzelnen befähigt, wieder Herr zu werden über seine Entscheidungen.
Freilich kann man nun trefflich streiten darüber, welche Phantastik seriöse »distentzierende Erkenntnisakte«, und welche nur liederliche, gar schädliche Ablenkung und Betäubung fördert.{02} {Wir-Modus aus}
 Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das
Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das
{w}as die seriöse Phantastik vom bloßen Obskurantentum trennt, sei es von seinen literarischen oder auch von den heute ins Kraut schießenden pseudokultischen Ausprägungen, der Umstand {ist}, dass sie nicht einer Droge ähnlich wirkt, sondern den Leser durch die literarische Gestaltung der Angst in einen Zustand erhöhter Alarmbereitschaft versetzt.
{03}Der englische Nebentitel lautet ›A Romance of Souls‹, was man in etwa mit ›Eine Abenteuergeschichte von Seelen‹ eindeutschen kann, und das ist wortwörtlich gemeint. Hier geht es um zwei Menschen, die mit dem so genannten ›Multiplen Persönlichkeits Syndrom‹ geschlagen sind. In der Realität wird diese Diagnose noch ziemlich heftig debattiert, was nicht verwunderlich ist, handelt es sich doch bei Fragen dazu, wie denn genau unsere inneren Welten beschaffen sind und funktionieren noch um eine Problematik, die sich nicht mit der objektiven Phantasie ergründen lässt, auch wenn wir in Zeiten leben, in denen man täglich über neue Meldungen den Medien stolpern kann zur wissenschaftlich-instrumentellen Erforschung dieses dunkelsten aller Weltenterrains.
Während Andy über seinem Zustand Bescheid weiß und damit ganz passabel umzugehen gelernt hat, hat die von Black-Outs geplagte Penny keinen Schimmer davon, dass viele konkurrierende Teilpersönlichkeiten sich um ihren Körper kabbeln. Im Milieu der Seattle’schen New Economy begegnen sich Andy und Penny als Mitarbeiter einer IT-Spiele-Firma namens ›Virtuell Reality‹, und brechen später auf zu einem irrwitzigen Trip ins Herz der provinziellen USA, um die Vergangenheits-Geheimnisse von Andys Seelenzertrümmerung zu ergründen.
Obwohl dieses dritte Buch von Ruff meistens genauso verspielt und humorig wie seine beiden Vorgänger ist, mutet es seinen Lesern stellenweise extrem gruselige Passagen über innerfamiliäre Grausamkeit zu. Das taugt sicherlich nicht jedem, das schreckt sicherlich manche ab, doch Ruff bleibt anständigt, da er keine Spektakelausbeutung mit dem Thema Kindesmißbrauch und sadistische Eltern betreibt. Ich persönlich fand es da sehr angenehm und passend, dass »Ich und die Anderen« nicht so wirr und trügerisch wie »G.A.S.«, sondern wieder eher wie »Fool on the Hill« versöhnlich-aufrichtender ausklingt. Zudem ist es sprachlich weniger peppig und der dramaturgische Fluß merklich ruhiger als seine beiden Vorgänger.
 2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!
2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!
»Bad Monkeys« ist einerseits ein Kammerstück, eine Charkterstudie, denn die Handlung setzt im Juno 2002 ein, im weißen Raum einer Gefängsnispsychatrie in Nevada, wo ein Dr. Vale die frischverhaftete Mörderin Jane verhört. Diese ›White Room‹-Kapitel sind kurz, auktorial erzählt, rekapitulien beziehungsweise leiten zu den längeren Kapiteln über, in denen Jane als Ich-Erzählerin ihre Lebensgeschichte als ›Bad Monkey‹-Agentin erzählt. Die Art des Verhörhumors läßt sich fein illustrieren anhand weniger Zeilen von S. 3:
»Worin besteht die Arbeit bei Bad Monkeys«, fragte der Arzt, »also was tun Sie? Böse Menschen bestrafen?«
»Nein. Normalerweise töten wie sie einfach.«
Jane ist eine packende, charismatische Erzählerin (obwohl: manche Rezensenten fanden sie unsympathisch. Am Ende des Romanes zu urteilen, ob Jane denn nun sympathisch oder unsympathisch, feige oder mutig, böse oder gut ist, gehört zu den aufregenden Angeboten, die Matt Ruff hier seinen Lesern macht) wenn sie von ihrer wilden Kiffer-Jugend im San Francisco der Siebziger und vom zunehmenden Klinsch mit ihrer Mutter berichtet; davon, wie sie ein netter Polizist zu Verwandten in die hinterletzte Provinz bringt, nachdem ihre Mutter vollends die Nerven verloren hatte, als Jane beim Dope-Anbau erwischt wurde. Schön sachte driftet dann die bisher realistische Welt ins die Gefilde der Verschwörungsphantastik, wenn die jugendliche Jane eine seltsame ›Natürliche Ursachen‹-Knarre findet, mit der man Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen kann, ein Artefakt einer namenlos bleibenden Organisation, von der Jane Jahre später für die Abteilung ›Bad Monkeys‹ rekrutiert wird.
Ganz besonders freut und beeindruckt mich, dass Matt Ruff mit diesem Roman eine hinreissende Homage auf Philip K. Dick — den (für mich) großartigsten Kurzgeschichten-Phantasten der zweitem Hälfte des 20. Jahrhunderts — vollbracht hat. Trotz aller Späßchen und Thrills pulsen die Erz-Fragen von P. K. Dicks Werk (»Was ist Menschlich?«, »Wer bin ich?« und »Was ist Wirklichkeit?«) stets merklich durch den Strang der »Bad Monkeys«-Erzählung. Was habe ich Seite um Seite gestaunt, wie eingängig »Bad Monkeys« ist, und doch zugleich wie verwickelt, mit seinen zig-ineinandergeschachtelten Finten. Der für mich schönste, alles zusammenfassende Weisheitsspruch aus »Bad Monkeys«, der zugleich auch wie kein anderer Satz die Essenz seiner vier Bücher herausdestilliert lautet »Omnes mundum facimus« (»Wir alle machen die Welt«).
••• Zu Teil zwei mit dem Interview.
•••
Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.
•••
BIBLIOGRAPHIE:
»Fool on the Hill« (»Fool on the Hill« 1988); Übersetzung: Ditte König & Giovani Bandini, 576 Seiten; — Gebunden: Hanser (Erstausgabe, vergriffen), 1991; Zweitauendeins, ISBN: 3861504057; — Taschenbuch: DTV, 1993, ISBN: 3423117370.
»G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerke« (»Sewer, Gas & Electric – The Public Works Trilogy«, 1997); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 624 Seiten; — Gebunden: Hanser, 1998, ISBN: 3446192905; — Taschenbuch: DTV, 2000, ISBN: 3423207493.
»Ich und die Anderen« (»Set this House in Order – A Romance of Souls« 2003); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 600 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2004, ISBN: 3446205357; — Taschenbuch: DTV, 2006, ISBN: 3423208902.
»Bad Monkeys« (»Bad Monkeys« 2007); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 251 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2008, ISBN: 3446230025 ; — Taschenbuch: DTV, 2009, ISBN: 3423211792.
•••
ANMERKUNGEN:
01 Wieland Freund:
»Kampfaffen in der Tiefgarage, eine Begenung mit dem Kinoerzähler Matt Ruff«, in »Die Welt« vom 09. Februar 2008. •••
Zurück
02 Paraphrase nach Winfried Freund: »Arbeitstexte für den Unterricht: Phantastische Geschichten«, Seite 90, Reclam 1979/2001. ••• Zurück
03 Ebenda, S. 92.••• Zurück
Lord Dunsany: »Das Land des Yann«
Eintrag No. 394
01. Oktober 2007: Eine Runde Fehlermerzung.
ZWEITE FOLGE VON MOLOS WANDERUNGEN DURCH
 DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
Endlich wachse ich rüber mit der zweiten Folge meiner (mindestens) zwölfteiligen Serie zur Büchergilde Gutenberg-Neuauflage der von Jorge Luis Borges zusammengestellten Anthologie-Reihe »Die Bibliothek von Babel«.
Hier geht’s zur ersten Folge (zum Borges-Band »25. August 1983«). Kommt nun an Bord und lest …
 Die Klage vorweg (dann ist sie vom Tisch), allein schon, um nachvollziehbarer zu machen, warum ich soooo begeistert bin über diesen neuen Auswahlband mit acht Stücken Dunsany'scher Kurz-Phantastik:
Die Klage vorweg (dann ist sie vom Tisch), allein schon, um nachvollziehbarer zu machen, warum ich soooo begeistert bin über diesen neuen Auswahlband mit acht Stücken Dunsany'scher Kurz-Phantastik:
Wenn man bedenkt, wie umfangreich Dunsanys Werk (Romane, Kurzgeschichten, Dramen, Lyrik), wie groß sein Repertoir ist, und vor allem, wenn man gewahr wird, wie enorm sein Einfluß auf die Phantastik die im folgte ist, dann läßt sich nur durch Heranziehen schweißtreibend deprimierender Spekulationen möglicherweise verständig erklären, warum so überaus wenig von ihm ins Deutsche übertragen und veröffentlicht wurde.
›CRAZY H.P.L.« HAT MICH VERFÜHRT
Ein bischen beklommen bin ich, über Lord Dunsany (1878-1957) zu schreiben, denn soviel ich auch darüber grüble, mir etwas Neues, Eigenes über ihn aus der Nase zu ziehen, so oft driften meine Gedanken immer wieder zurück zu einer meiner lebhaftesten Lesephasen. Vor gut zwanzig Jahren habe ich die Prosawelten des Amerikaners Howard Phillip Lovecraft für mich entdeckt, und wie so manch anderer männliche, verklemmte, nachtaktive Stubenhocker-Teenager verfiel ich in einen regelrechten Lese- und Identifizierungsrausch. Nicht nur versank ich in den Fiktionen von Lovecraft, deren Kosmisches Grauen und Wahnsinnsanfälligkeit ich bis heute als sehr sinnvolle und kräftige Kommentare über unsere tatsächliche Welt verstehe; ich ging zudem mit großer Leidenschaft darin auf, Sekundärliteratur über Leben und Denken Lovecrafts zu verschlingen. Mein Hineinversetzten in diesen seltsamen Eigenbrötler war für eine Weile schon von lächerlicher Heftigkeit, und so stakste ich mit meinem nach Ausweitung drängenden Gemüt durch die komischen Mischkulanzen aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, rationaler Kälte und melancholischer Wehmut, übersprudelnder Phantasie und pessimistischer Sicht auf die moderne Welt, die für Lovecraft typisch ist.
Entsprechend begeistert und ›gläubig‹ ließ ich mich damals von Lovecrafts Denken und Urteilen zur Phantastik leiten. Rückblickend betrachtet, war das gar nicht mal so schlecht. Klar: man sollte als Erwachsener immer auch ein kritisches Auge auf die Helden der eigenen Jugend und deren Einfluß haben. Aber ich lehne mich wohl keinen Milimeter zu ungehörig weit aus dem Fenster, wenn ich Lovecrafts Essay »Supernatural Horror in Literature« aus dem Jahre 1927 lobpreise: bis heute hat sich dieser schmale jedoch gehaltreiche Band seine orientierende und anregende Kraft bewahrt. Dort behandelt Lovecraft Dunsany im letzten von 10 Kapiteln: »Die modernen Meister«[01]:
Unübertroffen in der Zauberei einer kristallinen, singenden Prosa und von überragendem Rang in der Erschaffung einer prächtigen und sehnsuchtsvollen Welt irisierender, exotischer Visionen ist Edward John Moreton Drax Plunkett, Achtzehnter Baron Dunsany, dessen Geschichten und kurze Theaterstücke ein fast einzigartiges Element in unserer Literatur bilden. Als Erfinder einer neuen Mythologie und als Erdichter überraschender Volksmärchen steht Lord Dunsany im Dienst einer fremden Welt der phantastischen Schönheit, verschworen dem ewigen Kampf gegen die Roheit und Häßlichkeit der Wirklichkeit des Alltags.
Wie sollte ich vermögen, solch feine Literatur-Essay-Schreibe noch zu übertreffen, wie Lovecrafts Lob noch groß was hinzudichten?
»IM LAND DES YANN«
Aber zur Sache: Was für eine Suite an Dunsanyaden hat unser blinder Bibliotheksdirigent Borges für geneigte (angehende und bewanderte) Phantastik-Connaisseure zusammengestellt?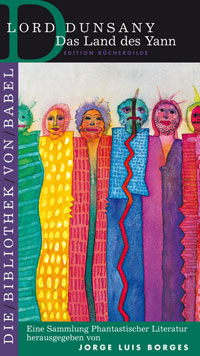 Eine repräsentative, sprich, muntere Prosa-Auswahl, mit sieben Geschichten und einem kurzen Einakter.
Eine repräsentative, sprich, muntere Prosa-Auswahl, mit sieben Geschichten und einem kurzen Einakter.
Ein paar Stellen aus Borges Vorwort die ich bemerkenswert finde: Jorge Luis tadelt (zu Recht!!!) Dunsany für seine Löwen-Abknallerei. Mittels eines Zitats deutet J.L. an, daß zur Güte von Dunsanys träumerischer Mythenbastelei wesentlich dessen ›typisch keltisches magisches Naturgefühl‹ beiträgt. Schließlich, daß Dunsany ein Musterbeispiel eines Dichters ist, der zwei Werke hinterläßt: das dichterische und das biographische, sprich: der Eindruck, den er als Mensch bei uns hinterlässt. Grad aus der Schaar der Phantasten kommen die Schöpfer selbst oftmals wie etwas fremdartige Charaktere aus einer myteriösen Welt daher. Dunsany wäre eine prächtige Ergänzung für jegliche »Liga der außergewöhnlichen Gentleman«, Baron, Märtyrer- und Raubritternachfahre, Soldat, Geheimagent, Kriegsveteran, Schachgroßmeister, Großwildjäger, Gänsekielnutzer, Weltenbauer und Erfinder von ungezähmten Märchen, der er war.
Gleich die Eröffnungsgeschichte »Am Rand der Gezeiten«[02] führt vor, wie man mit einem rahmenden ›alles nur geträumt‹-Bikini das Signal gibt, daß man als Autor mal nicht einfach eine weitere kleine aufregende Begebenheit abschnurrt, sondern lieber ein athmosphärisches, bild- und sinnenstarkes Prosagedicht ausbreitet. Auch wenn diese Phantasie darüber, wie eine Seele im Fegefeuer der cthonischen Entropie darbt, in Londons Themsegewässen angesiedelt ist, könnte sie in jeder Flußmündungsgroßstadt spielen. Und in Hafenstädten wimmeln die Agenten, und unser namenloser Protagonost alpträumt davon »eine gräßliche Untat begangen zu haben, so daß mir kein ehrliches Grab zuteil werden durfte« (S. 13). Die eigenen Freunde killen den Unbekannten und verscharren ihn zur Ebbe im Flußschlamm. Was nun folgt ist eine irrsinnige Raffung der Verfalls-Gezeiten, was sich aber alles andere als hektisch ausnimmt, sondern vielmehr morbide Grazie verströhmt.
»Das Schwert und das Idol«[03] ordne ich einer Text-/Genre-Gruppe zu, die sich ›Steinzeit‹- oder ›Vorgeschichts‹-Fantasy nennen könnte. Von Jack London (»Before Adam – Bison Frontiers of Imagination« 1906-07) an, über Roy Lewis (»Edward«, 1960), Umberto Eco (»Das Ding«, 1961), bis Alan Moore (»Hob’s Hog«, 1996), phantastisch mutet es allemal an, wenn unsere ›Ugha-Ugha‹-Vorfahren als Hauptfiguren in abenteuerlichen Geschichten auftreten, und oftmals dienen solche fiktiven Urzeitereignisse als Parabel über die Basis-Beschränktheiten des Menschen. Hat sich ja auch außer Technik und Frisurenmode kaum was geändert. — Dunsanys kurze Story kann als Einstiegslektion in die Kniffligkeiten gruppeninterner Informations- und Psychagogie-Kriegsführung verstanden werden. Auf der einen Seite die Menschen, die sich um ihr Lagerfeuer zusammendrängen, auf der anderen die gefährliche Umwelt, hier vertreten durch Wölfe. Innherhalb der Frühmenschengruppe konkurrieren Technikmeister und Glaubenshüter miteinander. Auch wenn Dunsany hier keine archäologisch korrekte Studie vorlegt, fabuliert er doch in knapper, unterhaltsamer Form offen darüber, mit welchen Selbstüberhöhungsgebahren die Militärtechnik-Machtinhaber Respekt einstreichen, und mit welch perfiden Illusionstricks die Proto-Priester die wundergläubige Gemeinde an der Nase herumführen. Für atheistische Brigths und religiöse Gläube gleichermaßen eine vergnügliche Leküre.
»Carcassonne«[04] kann jedem Phantastik-Interessierten als brilliante Anschauung dienen, wie die literarischen Zwischenschritte geartet sind, die bereits keine traditionellen Sagen, Legenden oder Künstmärchen mehr sind, aber auch noch nicht dem heute gebräuchlichen Schwarm an Fantasy-Questen angehören. Die durch die Katharer und Albigenserkreuzzüge geschichtlich berühmt-berüchtigte Stadt Carcassonne ist bei Dunsany ein magischer Sehnsuchtsort, bewacht von Drachen, beherrscht von einer schrecklichen, schönen Hexe. König Camorak von Arn und seine Krieger ergötzen sich am Harfnergesang eines namenlosen Sehers, und man beschließt, dessen Prophezeiung, daß niemand Cascassonne erreichen kann, heldisch widerlegen zu wollen. Dunsany glänzt als Stimmenmeister, und Friedrich Polakovics Übertragung ist schlicht wunderbar, wie man vielleicht schon anhand des folgenden Ausschnitts merkt (S. 41. Erinnert mich an Hans Dieter Hüschs wunderbare Mär über die Bäcker von Beumelburg):
Und Camorak hub an und sprach: »Vieles ist, das bedacht werden muß, denn viel Rats ist zu pflegen, und auch der Vorräte darf nicht vergessen werden. An welchem Tag also brechen wir auf?« Und all die Krieger riefen wie aus einem Mund: »Noch heute!« Und Camorak lächelte darob, denn er hatte die Männer bloß auf die Probe gestellt. So nahmen sie denn ihre Waffen von den Wänden: Sikorix, Kelleron, Aslof, Wole der Axtkämpfer. Und ferner Huhenoth und Friedbruch. Und auch Wolwuff, Kriegvater, Tarion, Lurth mit dem Schlachtruf und all die anderen. Und die lauernden Spinnen im lärmenden Saal ließen sich nicht träumen die Grabesruhe, der sie so bald sich erfreuen würden.
Hier spielen Drachen mit gefangen Bären wie Kätzchen mit der Maus, hier speien Berge Feuerbomben, erscheinen des Nachts Bäume herrschaftlicher als Könige und ich selbst fand besonders erfrischend, wie Dunsany nebenbei schlemisch vermerkt, wie das einfache Volk im Kuhstall über die Machokriegerqueste tratscht. Diese Erzählung bettelt geradezu danach, bei einer Fantasy-Con am Lagerfeuer vorgetragen zu werden. Auch wenn es hier (wie fast immer) gehörig unheimlich zugeht, bezaubert »Cascassonne« vor allem durch seine Sprachmelodik, und illustriert anschaulich, was H.P. Lovecraft über Dunsany schreibt:
So ist also Schönheit und nicht Entsetzen der Grundton von Dunsanys Werk.
Das titelgebende Hauptstück und der Höhepunkt des Bandes »Das Land des Yann«[05] ist meiner Meinung nach nun eine konzentrierte Vorwegnahme der bis heute wirksamen Hauptströmungen dessen, was wir Phantastik-Narren als gelungene ›Fantasy‹ bezeichnen. Der Leser begleitet (sozusagen als Tourist) einen Träumer bei seiner Reise mit der Sturmvogel auf dem großen Fluß Yann. Die Grenze zwischen Schlafen und Wachen verschwimmt dabei immer wieder, und mit zunehmender staundender Verblüffung lesen wir von den seltsamen Gebräuchen der Schiffsbesatzung, den befremdlichen Sitten der Städtebewohner an den Ufern des Yann. Auch hier macht Dunsany den ein oder anderen Jux über die Irrungen und Eigentümlichkeiten gläubiger Religions-Phantastik, z.B. wenn er schildert, wie die Sturmvogel-Crew den dräuenden Gefahren der Reise vorbeugt (S. 59):
Und dann knieten die Schiffsknechte nieder auf den Planken des Decks und begannen zu beten, doch beteten nicht alle auf einmal, sondern nur fünf oder sechs zur selben Zeit. Seite an Seite knieten sie nieder zu fünfen, zu sechsen, den es war Brauch, daß nur Männer verschiedenen Glaubens gleichzeitig ihre Götter anriefen, auf daß kein Gott vernähme, wie im selben Atem zwei Männer zu ihm beteten. Und hatte der eine sein Gebet beendet, so trat ein anderer des nämlichen Glaubens an seine Stelle.
Selten sind die Erzählungen, die derartig abwechslungsreich und spannend daherkommen, die auf so engem Raum so viel Bilderschätze und Rätsel bergen. Auch hier paßt wieder ein Zitat aus Lovecrafts Essay wie die Faust aufs Auge:
Dunsany liebt es, verstohlen und listig ungeheuerliche Dinge und unglaubliche Verhängnisse anzudeuten, wie es im Märchen geschieht.
Nun folgen die zwei kleineren Geschichten, mehr Anekdoten oder Gedankenspiele, »Die Wiese«[06] und »Der Bettler«[07]. Die erste baut auf dem Kontrast zwischen London (Stadt-Stress) und Wiese (Land-Idyll), und gönnt uns beunruhigent-empfindsamen Spekulationen darüber, daß wichtige und schicksalsträchtige Vorfälle einem Ort als Echo oder Vorklang anhaften mögen. Die zweite läßt einen kuriosen Bettlertrupp vom Piccadelli Rund zum Green Park prozessieren, wobei gesegnet wird, was absolut segenswürdig ist an unseren modernen Metropolen: Straßenlampen, Häuser, Bäume und Kanalabflüße.
»Das Bureau d'Echange de Maux«[08] unterbreitet uns die Idee, daß es in einer kleinen Gasse zu Paris einen Laden gibt, in dem man (freilich durch Entrichtung einer Vermittlungsgebühr) sein Unglück mit anderen tauschen kann, beispielsweise (S. 104):
Ich lernte, daß jedem sein eigenes Übel das ärgste auf Erden ist, und wie ihr eigenes Übel die Menschen so sehr beunruhigt, daß sie stets das entgegengesetzte Übel eintauschen wollen in dem kleinen, gräßlichen Laden. So tauschte ein Weib, dem es versagt war, Kinder zu haben, mit einem armen, halbirren Kind von zwölf Jahren. Und ein andermal hatte ein Mann seine Weisheit für Narrheit gegeben.
Besonders hier vermeine ich deutlich zu spühren, wie stark Dunsanys Einfluß auf heutige, gehalt- und ideenreiche Phantastik ist. Der ›Laden zum Tausch von Übeln‹ könnte ohne Probleme in einer der vorzüglichen Vertigo-Comics (z.B. »Sandman«, »Fables« oder »Lucifer«) oder bei zeitgenössischen Phantastik-Könnern wie China Miéville, Jeff Vandermeer oder Neil Gaiman auftauchen. (Nebenbei: man stelle sich vor, daß Joseph K. aus Kafkas »Der Prozess« sein Unglück in diesem Geschäft tauscht. Fragt sich nur, was das entsprechende Gegenteil einer anonymen Anklage ist.)
 Eine Kostprobe von Dunsanys zahlreichen Minidramen und Theaterwerken gibt abschließend »Eine Nacht im Pub«[08]. Irgendwie ergab es sich, daß ich dieses Stück über vier Diebe, die einem indischen Zyklopen-Götzen das Edelsteinauge geklaut haben und nun kaum ihr panisches Fingernagelknabbern kaschieren können, da rächende Kultisten ihnen auf den Fersen sind, wie ein Gruselcomic aufnahm; bzw. mich daran vergnügte, mir vorzustellen, wie Harry Rowohlt diese Geschichte vortragen würde. (H.P.L. schreibt passend: Auch Humor und Ironie sind oft gegenwärtig, um einen saftigen Zynismus zu verbreiten und das abzuwandeln, was sonst wohl eine naive Intensität besäße.)
Eine Kostprobe von Dunsanys zahlreichen Minidramen und Theaterwerken gibt abschließend »Eine Nacht im Pub«[08]. Irgendwie ergab es sich, daß ich dieses Stück über vier Diebe, die einem indischen Zyklopen-Götzen das Edelsteinauge geklaut haben und nun kaum ihr panisches Fingernagelknabbern kaschieren können, da rächende Kultisten ihnen auf den Fersen sind, wie ein Gruselcomic aufnahm; bzw. mich daran vergnügte, mir vorzustellen, wie Harry Rowohlt diese Geschichte vortragen würde. (H.P.L. schreibt passend: Auch Humor und Ironie sind oft gegenwärtig, um einen saftigen Zynismus zu verbreiten und das abzuwandeln, was sonst wohl eine naive Intensität besäße.)
Resumee: Dunsany beschenkt seine Leser mit einer Phantastik, die sich sowohl für’s musenhafte Sichtreibenlassen eignet, die aber auch unseren Möglichkeitssinn beim Blick auf die tatsächliche Wirklichkeit schärft. Oder, um abschließend noch einmal Lovecrafts Worte als Bürgen zu bemühen:
Seine prismatisch schillernden Städte und seine noch nie dagewesenen Riten kennzeichnet eine Sicherheit, wie sie allein Meisterschaft erzeugen kann, und das Gefühl tatsächlichler Teilnahme an seinen heimlichen Mysterien läßt uns schaudern. Für wahrhaft phantasierende Menschen ist er ein Talismann, ein Schlüssel, der das Tor zur reichen Schatzkammer des Traumes und der versprengten Erinnerungen öffnet, so daß wir ihn nicht nur einen Dichter nennen können, sondern ihn auch für einen Autor halten dürfen, der jeden Leser ebenfalls zum Dichter macht.
•••
LINK-SERVICE
- Thomas Harbach für »SF-Radio«: Lord Dunsany gehört mit William Morris zu den frühen britischen Autoren, die eine Wiederentdeckung längst verdient haben. — Genau.
- Oliver Kotowski für »Fantasyguide.de«: Der Band »Das Land des Yann« ist ein großer Gewinn für Leser, die sich für die Entwicklungslinien der neueren Phantastik interessieren {…} Doch auch für einfach nur an Wundergeschichten Interessierte sind Lord Dunsanys Kurzgeschichten immer noch lesenswert, sowohl wegen seiner wahrhaft phantastischen Wunder, als auch wegen seines gekonnten Umgangs mit Erzählmustern.
— Ein sehr schönes Bullseye-Fazit!
›Cronn‹ für »Roter Dorn«: Lord Dunsany ist eine Ausnahmeerscheinung in der Phantastik … — Kopfnick-kopfnick. Obwohl: auf dem Feld eigenständiger Autoren, die mehr schreiben als nur Beiträge für Franchise-Phantastik, ist die Schaar der Ausnahmeerscheinungen gar nicht so dünn gesäht.
Und als Schluß-Gemme gibts es waschechte Bezüge zwischen angesehener deutscher Gegenwartsliteratur und den Yann-Fabulationen, wenn Jürgen Berger in einer Rezi für die »Tageszeitung« auf Botho Strauss Anleihen bei Dunsany aufmerksam macht:
Im Falle von »Die Nacht mit Alice, als Julia ums Haus schlich« erhebt der Finger sich in Form eines Traumbildes: Die Stadt, in der der Mann sich bewegt, geht an ihrer eigenen Gedankenlosigkeit zugrunde. Die Erinnerung daran, wie es sein sollte, borgt Strauß sich bei Lord Dunsany und dessen Erzählung »Idle days on the Yann«.
Dunsany starb 1957, war irischer Schachmeister, galt als »worst dressed man« Irlands und wandelte als Erzähler und Dramatiker im Grenzgebiet zur Phantasy-Literatur. In seiner Erzählung geht es um Seemänner, die mit ihrem Schiff in einer Stadt ablegen, den Yann hinabfahren, alte, besänftigende Lieder singen und abends zu ihren ganz eigenen Göttern beten. Strauß zitiert eine längere Passage aus der Erzählung, in der die Rede davon ist, der Mensch solle sich »in tiefem Einvernehmen mit Riten und Zeremonien aus grauer Vorzeit« bewegen. Warum er aber »Idle days on the Yann« in »Idle days of the Yann« abwandelt, wird wohl sein Geheimnis bleiben.
•••
ANMERKUNGEN:
[01] Alle H.P. Lovecraft-Zitate stammen aus:
»Unheimlicher Horror – Das übernatürliche Grauen in der Literatur«, Ullstein Populäre Kultur (1987), Ubers.: Bernd Samland. S. 110 bis 113. •••
Zurück
Gnadenloses Leseprotokoll zu »Harry Potter and the Deathly Hallows«
Eintrag 392 — In den letzten zehn Jahren habe ich mich wie viele viele andere Leser und Filmgucker auch von der siebenteiligen Fantasy-Reihe um den englischen Töpferbuben hinreissen lassen. Hier nun mein (gnadenloses) Leseprotokoll zum langerwarteten Abschlußband »Harry Potter and the Deathly Hallows«.
Da ich absolut keine Rücksicht auf Geheimnisverrat nehme, richtet sich dieser Eintrag vornehmlich an andere Harry Potter-Leser, die bereits feddich sind. Wer sich den Spaß erhalten möchte, liest mein Protokoll besser nicht!!!
Deshalb, und um die »Aktuell«-Seite nicht mit ewig langen Auslassungen vollzustellen, habe ich mein Protokoll zu den einzelnen Kapiteln in den Kommantar dieses Beitrages gestellt.
Im Moment reicht mein Protokoll bis einschließlich Kapitel 12. Der Rest wird in den nächsten Tagen nachgereicht.
•••
Introdubilo:
Haberer Oliver vom Literaturwelt-Blog gibt sich (nicht nur als Papa) dem Potterwahn hin und rattert Kapitel für Kapitel seine Zusammenfassung und Ansichen zum letzten Band der Reihe runter. Hut ab für diese Aktion! Das ist im kleinen ein schönes praktisches Beispiel dafür, welche Text-Formen via Internet funktionieren, die per Print so nicht klappen oder möglich sind.
Ich häng mich mal begeistert dran.
Zur Besorgung: Ich hab ja meinen HP#7 ganz gemütlich in der Frankfurter Stadtmitte abgeholt. Kein Stress, erst so gehen 17h unaufgeregt vorbeispaziert. Zuhause dann Inhaltsverzeichnis und Gesamtinhaltsverzeichnis geschrieben (nebenbei: HP hat nach meiner Zählung 3558 Seiten; die Summe kann aber je nach Ausgabe wohl variieren).
Hier meine Gründe, warum ich als 34jähriger Edel-Phantastik-Fachdepp HP überhaupt goutiere:
- HP ist für mich schnell weglesbarer bunter ›Trash‹. Sozusagen für mich als langjähriger TV-Abstinenzler mein Nachmittags- und Vorabendprogramm-Ersatz. (Liebe Potterfans, jetzt bitte nicht den Molo haun).
- Potter ist ein Riesenhype, auf dem ich sozusagen auch als ›Hobby-Anthropologe‹ mitsurfe, um nicht immer nur als Außenstehender über Hype daherreden zu können.
- Schließlich dient mir Potter deshalb bei meiner Lektüreauswahl als eine der seltenen Ausnahmen von meinem sonstigen Lesestoff. Ohne solche Ausnahme-Abwechslung würde mich auch die allerbeste Eliten-, Klassiker- und Randzonen-Literatur auf dauer fad werden. Ab und zu sollte man eben auch als Erwachsen-Sein-Woller auf allen Vieren herumkrabbeln, damit man merkt, was sich in Bodennähe alles tummelt, und um zu merken, wie viel aussichtsreicher der aufrechte Gang ist.
Jeff Vandermeer: »Die Stadt der Heiligen und Verrückten«, oder: Pilzsporen und Kalmartentakel
Eintrag No. 391
•••
 Ach gucke mal da!, dacht ich mir am Klett Cotta-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2005, als ich deren zweiten Phantastiktrumpf des damaligen Jahres entdeckte. Kommt nicht so oft vor, dass ein Buch neben seinen Konkurrenten auffällt wie ein Artefakt aus einer anderen Welt. Schwarz wie der berüchtigte Monolith auf dem Mond, aber vollgewimmelt mit weißem Text. Erst beim zweiten oder dritten Blick entdeck ich vorne ganz unten in gelb den Titel »Stadt der Heiligen & Verrückten« (The City of Saints & Madmen) von Jeff Vandermeer (1968), daneben der bescheiden posende rote Kett Cotta-Greif.
Ach gucke mal da!, dacht ich mir am Klett Cotta-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2005, als ich deren zweiten Phantastiktrumpf des damaligen Jahres entdeckte. Kommt nicht so oft vor, dass ein Buch neben seinen Konkurrenten auffällt wie ein Artefakt aus einer anderen Welt. Schwarz wie der berüchtigte Monolith auf dem Mond, aber vollgewimmelt mit weißem Text. Erst beim zweiten oder dritten Blick entdeck ich vorne ganz unten in gelb den Titel »Stadt der Heiligen & Verrückten« (The City of Saints & Madmen) von Jeff Vandermeer (1968), daneben der bescheiden posende rote Kett Cotta-Greif.
Schon der Buchrücken wird durch ein zentrales Gestaltungsmotiv des Autoren geprägt: die Collage, dem Mit- und Durcheinander von längeren und kürzeren Fitzeln und Fragmenten, die zusammen etwas gänzlich Neues ergeben. Unter dem Titel und dem Autorennamen prangt wie ein klassisches Emblem ein Detailausschnitt des Front-Covers: Eine sehende Hand mit Auge[01]. Darunter sieben programmatische Wörter, die für einen Dr. V von größtem Interesse sind: hochmütig Dunkelheit tapfer Last Flut Grauhüte Grimasse. Es folgt wiederum ein Bild, diesmal logohaft reduziert: ein grünlicher Kalmar, angeblich das Selbstportrait eines gewissen F. Madnok. Zuletzt eine figürlich-abstrakte, an urzeitliche Symbole erinnernde Männchen-Zeichnung mit dem Titel »Sporer Nr. 2« von Orim Lackpole, ausgestellt im Morhaim Museum. Vordere und hintere Schutzumschlagseite flirren, denn auf ihnen lesen wir in weißer Schrift zwei prosa-lyrische Szenen, die jeweils eine mittig platzierte Illustration umrahmen. Der Text der Vorder- und Rückseite ergibt bereits die erste kleine Geschichte von einem sich nachts in einem Boot auf dem Mott-Fluss der Stadt Ambra nähernden Reisenden, der im Gepäck unter anderem ein Exemplar des Buches »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« hat. Der Reisende plumpst ins Wasser und hat eine unheimlich-visionäre Begegnung mit einem der großen Königskalmare.
Derart ist das ganze Buch, sogar für gewöhnlich harmlose Teile wie ›Andere Bücher des Autoren‹ und ›Biographie‹, von kreativer Devianz befallen. Da tummeln sich fiktive oder noch zu schreibende Bücher von Vandermeer[02], und der Lebenslauf franst ins Mysteriöse aus, wenn er angibt, dass der Autor für einige Zeit als spurlos verschwunden galt. Ein völliges Novum sind die ›Anmerkungen zu den Schriften‹, eine exemplarische Kostprobe von Vandermeers synästhetischem Humor, wenn es z.B. über die Caslon Old Face heißt:
»Nach feinem Leder duftend, nach Sandelholz und Zimt, ist die Caslon trocken, aber samten«;
und zur Times New Roman wird kommentiert, dass sie
»das grobe Fluidum eines zähen Bratens mit der Struktur von Kartoffeln (vereint), und ihrem steinernen Bukett eine feuchte Textur beigemischt (ist)«.
Grob gesagt, ist das vollkommen durchgeknallte, ziemlich elitär-feinsinnige Phantastik, sozusagen 72% Edel-Fantasy-Schoko.
 Doch wie sieht es in dem Buch aus? Jede Übersicht muss hier gröblichst vereinfachen, denn der ›Collage-Roman‹ ist so geradeaus wie ein Korkenzieher für n-dimensionale Weinflaschen. Die erste Hälfte des Buches füllen vier längere Geschichten, die auf Amerikanisch 2002 erschienen. In »Dradin verliebt« erzählt ›ganz normal‹ ein auktorialer Erzähler von einem jungen Missionar des Religionsinstitutes von Morrow, der nach seinem Scheitern aus den südlichen Dschungeln nach Ambra zurückkehrt. Seine überreizte Verliebtheit in eine unbekannte Schönheit verquirlt sich mit dem Fieberwahn einer Geschlechtskrankheit und idyllisch-bitteren Erinnerungen an die Eltern. Schließlich stolpert Dradin, der Möchtegern-Ex-Missionar, durch nächtliche Widrigkeiten ärgerer Güte.
Doch wie sieht es in dem Buch aus? Jede Übersicht muss hier gröblichst vereinfachen, denn der ›Collage-Roman‹ ist so geradeaus wie ein Korkenzieher für n-dimensionale Weinflaschen. Die erste Hälfte des Buches füllen vier längere Geschichten, die auf Amerikanisch 2002 erschienen. In »Dradin verliebt« erzählt ›ganz normal‹ ein auktorialer Erzähler von einem jungen Missionar des Religionsinstitutes von Morrow, der nach seinem Scheitern aus den südlichen Dschungeln nach Ambra zurückkehrt. Seine überreizte Verliebtheit in eine unbekannte Schönheit verquirlt sich mit dem Fieberwahn einer Geschlechtskrankheit und idyllisch-bitteren Erinnerungen an die Eltern. Schließlich stolpert Dradin, der Möchtegern-Ex-Missionar, durch nächtliche Widrigkeiten ärgerer Güte.
Es folgt als Zweites ein Sachtext, der »Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra«, die ein Duncan Shriek für das große Handels- und Verlagshaus Hoegbotten schrieb[03]. Ursprünglich hieß Ambra Cinsorium und war das blühende Kulturzentrum eines Volkes kleiner Pilzmenschen (die im späteren Buchverlauf sogenannten Grauhüte), bis der im mächtigen Mündungsdelta des Mott-Flusses gelegene Ort von Piraten-Kaufleuten (den Katten) entdeckt und in gut räuberisch-›merkantil-imperialer‹ Manier erobert wurde. Hier werden neben vielen anderen Dingen halluzinogen-gesättigte Berichte von Irrwanderungen durch die unterirdischen Gänge der gedemütigten Grauhutkultur vom Historiker abgeklopft; Shriek spekuliert, wie (wenn überhaupt) die Grauhüte besiegt wurden, oder ob sie nicht vielmehr langsam und subversiv Ambra zurückerobern.
Der dritte Text »Die Verwandlung des Maler Martin See« erzählt von der , der durch eine (Nabokov läßt grüßen) geheimnisvolle ›Einladung zu einer Enthauptung‹ in eine brutal-heikle Lage gerät. Der Zwischenfall traumatisiert ihn, macht aber seiner bis dahin brav-zahmen Malerei flotte Beine, und See geht als einer der großen Kunstheroen in die Geschichte der Stadt Ambra ein. Im Hintergrund liefern sich innige Verehrer und Verächter des verschwundenen Komponisten-Titans Voss Bender einen handgreiflichen Straßenkrieg. Zwischen diese wieder auktorial dargestellten Erlebnisse von See fügt Vandermeer Auszüge aus einem Essay über Sees Bilder von der gescheiterten Malerin, (dann) Galeristin und Kunstgeschichtlerin Janice Shriek[04]. Wunderbar der Kontrast zwischen den Schauer-Schilderungen der Abenteuer, Visionen und Alpträume die Martin See zu seinen gerühmten Gemälden treiben, und den in Monographiestilistik gehaltenen Deutungen über Sees Werk und Leben.
Als Viertes folgt »Der seltsame Fall von X«, und man begleitet (wieder auktorial) den ›Vernehmer‹ einer geschlossenen Anstalt Ambras bei seiner Arbeit mit dem Patienten X. Soweit ich das verstanden zu haben glaube[05], soll der Mann in der Zelle niemand anderes als der in seinem Lebenslauf als verschollen gemeldete Vandermeer selbst sein, der dem Verhörer/Arzt Rede und Antwort über seinen Wahn von der Fiktionalität/Realität der Stadt Ambra liefern muss.
Bestes Hin- und Her und Ineinander von echter Welt (hier) und Fantasy-Welt (dort) also. Das Motiv des in seine Fiktion hineingestülpten Autors (bzw. ›Helden‹) ist zwar jetzt nicht sooo brennend neuartig[06], aber Vandermeer traut sich, diese Narrationsschraube schwindelerregend weit zu drehen. Immer wieder, aufeinander verweisend, ineinander geschachtelt, variierend finden verwirrende Bild-, Sprach- und Wirklichkeitsscharaden statt: Über Menschen und Menschenförmiges; über Kalmare, deren Intelligenz der Menschlichen das Wasser reicht und über Menschen, die sich für Kalmare halten; über Zellen, Gefängnisse, Käfige, Labyrinthe und Verwandlungen, aber auch über Impres-sionen, Erinnerungen, Ängste, Träume und Visionen.
Die Frage, was genau ›das Rezept‹ von Vandermeers registerreicher ›Erzählweise‹[07] ist, ließe sich z.B. so präzisieren: Wie schafft Vandermeer es, sich einerseits im besten Sinne dem leidenschaftlichen Schwulst düster-dystopischer Empfindsamkeit hinzugeben, dem aber andererseits mit einer erfrischend trocken-lakonischen Stimmlage gegenzusteuern? Meine Antwort wäre: —Vor allem mit stilistischer Eleganz. So bringt Vandermeer die ureigene Überreiztheit und Hybris der Phantastik, ihre Neigung zu einer monströs-paranoiden Eskapistik der Faszinationen mal witzig, mal berauschend, mal träumerisch, aber immer lebendig zum Schillern. Vor welchem ›Hintergrund‹ könnte man solch schlierenbunte Phantastik-Ästhetik besser glänzen lassen, als vor einem passend-elegantem Strudel finster-undurchschaubarer Komplexität?
In der rätselhafteren zweiten Hälfte, dem »Annex«, um den das Buch in seiner Ausgabe 2004 ergänzt wurde, befindet sich die schriftliche Hinterlassenschaft, die man in der Zelle des verschwundenen Patienten X. gefunden hat, nebst Briefen seines Arztes und Manuskripten anderer Personen. Die literarische Technik, in kleinen Dosen ›hand outs‹ aus der Fiktions- bzw. Phantastikwelt einer Geschichte beizugeben, findet sich ja durchaus mal ein. Kommt schon in jedem Krimi vor, wenn z.B. Zeitungsartikel ›eins zu eins‹ wiedergegeben werden. Für einen Literaten, selbst für einen Phantasten, treibt Vandermeer aber auch diesen Kniff atemberaubend weit.[08]
Doch weiter mit der Buchbesichtigung des Vandermeer’schen Labyrinths. Ein Orientierungsverlust-Schub ergibt sich ab Annexbeginn schon aufgrund der fehlenden oder irreführenden Paginierung, aber wenn ich richtig zähle, dann sind hier elf unterschiedliche Dokumente, Buchauszüge, Broschüren, und sonstige Unterlagen versammelt, inklusive Werbeanzeigen wie:
»Erfahren Sie, warum der Strattonimsus Schwindel ist. (…) Werden Sie Ihr eigener ›Kampfphilosoph‹«
und:
»Strattonismus / Verehre das zweigekammerte Hirn (…) Du kannst die Stimmen in Deinem Kopf beherrschen«.
Der Leser versucht indes, das Stimmenwirrwarr des Buches in den Griff zu bekommen. Gutes Trainingsgerät, um die ›willing suspension of disbelief‹-Muckis bis zum Kribbeln zu reizen.
Für meinen Geschmack ist der ›abgefahrenste‹ Text des »Annex« ist »Der Königs-Kalmar / Als da ist eine kurze Monographie von Frederick Madnok (nebst einigen zusätzlichen Untersuchungen von dem Bibliothekar Candace Harpswallow)«. Hier gibt es eine monströse Bibliographie mit 265 fiktiven Titeln, die sich überwiegend mit Kalmaren befassen. Einige der aufgeführten Titel hat Madnok kommentiert oder zusammenfasst. Er versucht dabei, verschlüsselt von seinen eigenen dunklen Familienerinnerungen zu berichten. Und nebenbei gibt’s dann plötzlich in all diesem Durcheinander köstliche Parodien auf trashige Rumsbums-Genreserien, wenn Madnok die fetzige »Folterkalmar-Serie« einer gewissen (fiktiven) Vivian Price Rogers zusammenfasst und kommentiert.
Auf den »Annex« folgen ca. 50 Seiten mit 130 Glossar-Einträgen über Geschichte, Gesellschaft, Persönlich- und Eigentümlichkeiten der Welt von Ambra. Hier gönnt sich Vandermeer nun als Ausgleich nach all dem empfindsamen Wahnsinn, den aufdringlichen Halluzinationen und unheimlichen Verwandlungen die dicksten Kalauer[09]. Ich muss den euro-chauvinistischen Smutje meines Lese-Schiffs mit Rum ruhigstellen, um ihn davon abzuhalten, mit großem Gewese dem Amerikaner Vandermeer mittels Ordenanheften zum ›literarischen Europäer ehrenhalber‹ zu ernennen. Aber ist so ein Impuls erstaunlich bei einem Autoren, der von sich sagt, dass er am ehesten der Tradition des Magischen Realismus folgt, und der Nabokov und Kubin und Herzmanovsky-Orlando zitiert?
Jeff Vandermeers Debüt in Deutschland ist eines der wenigen Bücher der letzten Jahre, an denen nicht wenig Leser scheitern mögen, was aber die Qualität des Werkes keineswegs in Frage stellt. Okay, der Vorwurf, »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« sei so ›artsy-fartsy‹- oder ›Kunstkacke‹-Phantastik, mag vulgär klingen, liegt aber nur im Ton, nicht sachlich daneben. Das Buch taugt nicht mal mit Schwimmflügeln und Schorchel als U-Bahn-Lektüre, und ich empfehle erregbaren Gemütern ausdrücklich, es nicht zum Einschlafen zu lesen[10].
Allen anderen kann ich nur wünschen, dass in ihnen ebenfalls dieses wunderbare Gefühl erblüht
»… für die unvergleichliche Pracht der Stadt – ihre Liebe zum Ritual, ihre Leidenschaft für die Musik, ihre unendliche Fähigkeit zu schöner Grausamkeit«
.
•••
[02] Mit Titeln wie
»Das trunkene, aber reuige Leben des Cadmion Signal«. •••
Zurück
[03] Annotations-Fetischisten aufgepaßt: Hier gönnt sich Vandermeer durch die Schrulligkeit der Figur Shriek sprechend tollen Fußnotenspaß. Dagegen ist Pratchett zahm! •••
Zurück
[05] Immerhin liegt Ambra am Mott-Fluß, und
›Dr. Mott‹ hieß der Arzt, der Edgar Allan Poe in dessen letzter Phase womöglich mehr schlecht als recht behandelte. Angeblich mit zu laxer Hand, was Morphium, Opium oder sonstiges dunkelromantisches Rauschmittel betrifft. Jedenfalls verschwand Poe spurlos einige Tage, um völlig derangiert, verwirrt und todkrank wiederaufzutauchen und kurz darauf zu sterben. Niemand weiß, was damals wirklich mit ihm geschah. •••
Zurück
[06] Siehe z.B.
»The Blazing World« (1658) der Herzogin Margaret von Newcastle, J. L. Borges, Fernando Pessoa, Michael Ende, Matt Ruff und jüngst im breitfließendem Genre-Mainstream Stephen King in seinem
»Dark Tower«-Epos. Auch Cornelia Funkes
»Tintenherz«-Trio lebt von diesem Motiv. •••
Zurück
[07] Hier könnte im ursprünglichen Sinne des Wortes
›Phantastik‹ stehen; was ich umständlich der Ethymologie des Wortes Phantasie folgend
›medial-narrative Modi, die sich besonders dadurch auszeichnen, daß sie beim Empfänger Bilder, Vorstellungen und Eindrücke sichtbar werden lassen, oder eben für ihn und/oder in ihm erscheinen lassen‹ nenne. •••
Zurück
[08] Klassische Beispiele für literarische Texte, in denen Originalquellen aus der Fiktionswelt als ornamentale Ergänzungen zur Geschichte gereicht werden, sind z.B. Rudyards Kiplings
»With the Night Mail – A Story of 2000 A.D.« (1909) und natürlich Karel Çapeks
»Der Krieg mit den Molchen« (1936). Und sind nicht auch der von Bilbo Beutlin verfaßte Reise- und Abenteuerbericht
»There and Back Again« (Der kleine Hobbit), sowie das von seinem Neffen Frodo und dessen Freund Sam fertig-geschriebene
»Grosse Rote Buch der Westmark« (Der Herr der Ringe)
›Original-Manuskripte‹ aus der Mittelerdewelt, und sind entsprechend z.B. die Lieder und Gedichte nicht solche
›Authentizifizierungsfenster‹ in die Phantastikwelt? •••
Zurück
[09] Mit sprichwörtlichen Reinsteigerschenkelklopfern. Wo immer man das Buch in die Pfoten bekommt, ich empfehle als Kostprobe den Glossareintrag
»Hyggboutten«, so um die vierzigstletzte Seite vom Buchende gezählt zu finden. •••
Zurück
[10] Außer natürlich, man liest auch sonst gerne solche Dinge wie Baudelaire-Verse, Bierce-Fabeln oder Hebbel-Tagebuchnotizen zum Einschlafen. •••
Zurück
Neil Gaimans »The Sandman« Band 1: »Prädludien & Notturni« mit »Hilfreichen Handreichungen« als PDF
Erster Teil von Molos Empfehlungen von
Neil Gaimans

inkl.
»Hilfreicher Handreiche« über mythologische, historische und literarische Anspielungen.
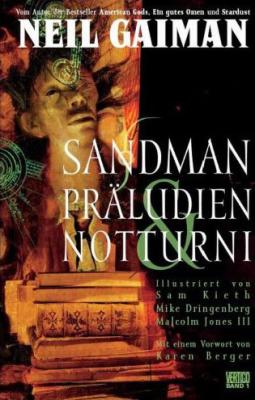 Eintrag No. 389 — Schön langsam mutiert die Molochronik zu einem Neil Gaiman-Fanblog. Was soll ich auch machen? Gaiman ist nun mal einer der originellsten und fruchtbarsten Gegenwartsvertreter der Genre-Phantastik, und da durch so manches Ungeschick seine Werke bei uns bisher zumeist in nicht so dollen Ausgaben erschienen, werf ich mich gern ins Zeug um diesen ›modernen Multimedia-Ovid‹ lobzupreisen. Ich schätze Gaiman deshalb so hoch, weil er es (nicht immer aber eben immer wieder) schafft, einem Literatur-Ideal gerecht zu werden, daß mir durch solche respektablen Klassiker wie den Römer Horaz oder den Barock-Gelehrten Gracian schmackhaft nahegebracht wurde. Kein Zweifel: Literatur, Fiktionen, Fabulation sollten zu mehr nützen, als dem Publikum eine Wohlfühlmassage zu verschaffen. Leser von Romanen (egal ob in Prosa oder in graphischer Form) sollten auch zum Nachdenken angeregt werden. Doch zweiteres will nun mal besser schmecken, wenn die Belehrung nicht so dröge, steif und nur bildungshuberisch daherkommt. Zuerst einmal muß unterhalten werden, muß die Hemmung durch den Zweifel überwunden werden. Derart beschwingt ist es dann auch locker-flockiger möglich, den Lesern ernste Gedanken nachzubringen, auf die sie sich ansonsten nicht einzulassen die Lust gehabt hätten.
Eintrag No. 389 — Schön langsam mutiert die Molochronik zu einem Neil Gaiman-Fanblog. Was soll ich auch machen? Gaiman ist nun mal einer der originellsten und fruchtbarsten Gegenwartsvertreter der Genre-Phantastik, und da durch so manches Ungeschick seine Werke bei uns bisher zumeist in nicht so dollen Ausgaben erschienen, werf ich mich gern ins Zeug um diesen ›modernen Multimedia-Ovid‹ lobzupreisen. Ich schätze Gaiman deshalb so hoch, weil er es (nicht immer aber eben immer wieder) schafft, einem Literatur-Ideal gerecht zu werden, daß mir durch solche respektablen Klassiker wie den Römer Horaz oder den Barock-Gelehrten Gracian schmackhaft nahegebracht wurde. Kein Zweifel: Literatur, Fiktionen, Fabulation sollten zu mehr nützen, als dem Publikum eine Wohlfühlmassage zu verschaffen. Leser von Romanen (egal ob in Prosa oder in graphischer Form) sollten auch zum Nachdenken angeregt werden. Doch zweiteres will nun mal besser schmecken, wenn die Belehrung nicht so dröge, steif und nur bildungshuberisch daherkommt. Zuerst einmal muß unterhalten werden, muß die Hemmung durch den Zweifel überwunden werden. Derart beschwingt ist es dann auch locker-flockiger möglich, den Lesern ernste Gedanken nachzubringen, auf die sie sich ansonsten nicht einzulassen die Lust gehabt hätten.
In den frühen 90gern lauschte ich auf einer Fantasy-Con Freunden beim Fachsimpeln über die »Sandman«-Comics. Es ging um die ›Endless‹, die Endlosen, jene 7-köpfige, dysfunktionale Familie anthropomorpher Personifizierungen, deren Namen auf englisch alle mit D beginnen (der ernste Destiny/Schicksal, die lockere Death/Tod, der vergrübelte Dream/Traum, der lebenslustige Destruktion/Zerstörung, die intrigante Desire/Verlangen, die selbstquälerische Despair/Verzweiflung und die jüngste im Bunde Delirium, die einst Delight/Entzücken war). — Als jemand, der schnell mal hingerissen ist, wenn philosophische Menschen- und Weltenlauf-Bespiegelung mit Äktschn, Spannung und Soap vermengt werden, spitzte ich die Ohren. Hmm, neue, neutrale ›Götter‹, eine moderner Pantheon für eine globalisierte Welt, dachte ich mir neugierig.
Worauf läßt man sich ein? Auf einen großen, zehnbändigen Epos über die Krise von Dream/Morpheus, seinen Niedergang und seine Wiederauferstehung; auf eine kecke Mischung aus Altem und Neuen, wobei Mythologien und Klassiker von frühester Zeit an und aus allen möglichen Weltgegenden Hand in Hand mit Neo-Mythen der westlichen Pop-Moderne einen abwechslungsreichen Reigen tanzen.
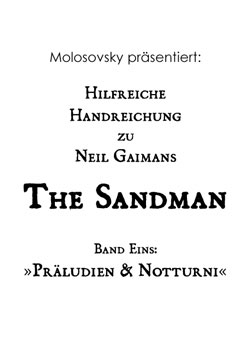 Entbrannt vor Begeisterung für Gaimans graphischen Wunderzyklus werde ich basierend auf den von Greg Morrow und David Goldfarb gesammelten, und von Ralf Hildebrandt betreuten englischen Anmerkungen zu »Sandman«, begleitend zur Neuauflage der Sammelbände, in der Molochronik künftig reichlich Material für bildungsinteressierte Freunde der Edel-Phantastik reichen.
Entbrannt vor Begeisterung für Gaimans graphischen Wunderzyklus werde ich basierend auf den von Greg Morrow und David Goldfarb gesammelten, und von Ralf Hildebrandt betreuten englischen Anmerkungen zu »Sandman«, begleitend zur Neuauflage der Sammelbände, in der Molochronik künftig reichlich Material für bildungsinteressierte Freunde der Edel-Phantastik reichen.
Hier zum Download des PDFs der ersten Abteilung meiner »Hilfreichen Handreichungen« zu Neil Gaimans großartigen Comicroman. — 1000 Dank an lucardus für eine spendierte Runde Korrektur!
Der erste Band »Prädludien & Notturni« versammelt den aus acht Kapiteln/Heften bestehenden eröffnenden Handlungsbogen, dessen Arbeitstitel auf englisch »More than Rubies« (Mehr als Rubine) lautet.
Ein nach dem Vorbild des Scharlatan-Okkultisten Aleister Crowley gestalteter englischer Gurumotz hegt die alte Menscheitsambition den Tod zu überwinden zu wollen. Dazu zieht dieser Roderick Burgess Anfang des 20. Jhd. ein Beschwörungsritual mit seiner Kultgang durch, verhaut sich aber grob. Statt Death/Tod zu bannen, fängt Burgess deren ›kleinen‹ Bruder Dream/Traum in seinem Zauberkreis, wo der bleiche König der Traumlande über siebzig Jahre darbt. Durch Dreams Abwesenheit verfiel sein Reich, viele Traumlandbewohner haben sich auf und davon gemacht und treiben ihr Unwesen in unserer Welt.
<img src="molochronik.antville.org" title="»Sandman«, Heft 1, Seite 1, alte Kolorierung. Copyright by Vertigo/DC."align="right" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">Erster und Zweiter Weltkrieg vertreichen, wie auch die Nachkriegsepoche, bis es Dream schließlich Ende der 80-ger gelingt seinen Kerkermeistern zu entkommen und in seine Heimatgefilde zurückzukehren. Soweit das erste Kapitel.
Der Rest von »Präludien & Notturni« erzählt dann ausführlich und abwechslungsreich, wie der geschwächte Morpheus Stück für Stück seine machtvollen Artefakte wiedererlangt und sein Reich halbwegs restauriert. Zu den Höhepunkten des ersten Sammelbandes gehört ein Ausflug von Morpheus in die Hölle, wo er sich mit einem gemeinen Dämon ein ›Duell der Realität‹ liefert; ein verstörendes Kapitel über Größenwahn und Maßlosigkeit, wenn ein Straßenrestaurant zum Hort tödlichen Gruppen-Irrsins wird; und natürlich das abschließende achte Kapitel des ersten Bandes, wenn dem selbstmitleidigen Morpheus von seiner überaus symphatischen Grufischwester Death der Kopf gerade gerückt wird.
Meine ersten »Sandman«-Einzelhefte las ich noch leihweise, bevor ich im September 1992 mit Heft 41 selbst anfing zu sammeln. Im Lauf der Zeit besorgte ich mir die zehn englischen Sammelbände von Vertigo/DC. Mit großer Verstörung beobachtete ich vor Jahren, wie diese Sammelbände in schrecklicher Art und Weise das erste Mal auf Deutsch herausgebracht wurden. In zu großem (europäischem) Albumformat auf viel zu schwerem Papier, und (was am rügenswertensten ist) oftmals wurden die Original-Sammelbände für die deutsche Ausgabe einst zweigeteilt veröffentlicht. Zudem wurde diese erste deutsche Ausgabe nie abgeschlossen. Sicherlich hat das für enorm viel Frust bei der Comicliteratur-Leserschaft gesorgt (und wieviele Jungleser durch diese ›Schlampausgaben‹ dazu getrieben wurden, gleich auf Englisch zu lesen, wage ich gar nicht zu spekulieren).
 Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei Panini/Vertigo erneut. Panini hat Sandman neu übersetzten lassen lassen und folgt dabei der neusten Sammelauflage der Amerikaner, tischt uns damit also die neue digitale Kolorierung auf. Die alte Kolorierung ist freilich nicht gänzlich zu verachten; vor allem Freunde der klassischer Gruselrießer-Comics dürften daran Gefallen finden. Immerhin: die 75 Hefte der »Sandman«-Reihe, die von 1989 bis 1996 (fast immer) monatlich erschienen, dokumentieren nebenbei auch die Geschichte der Umstellung zum digitalen Einfärben der s/w-Linienzeichnung. Der Vergleich von Seite 1 in alter und neuer Kolorierung zeigt, wie Dank digitaler Bildbearbeitung feinere Farbnuancen & -verläufe möglich sind. Die Seiten sind zugleich dezenter eingefärbt, und wirken dennoch plastischer. Dadurch geht zwar der horror-trashige Charakter der ursprünglichen Koloierung verlohren, aber alles in allem finde ich die neue Farbgestaltung angenehmer, stimmungsvoller, kurz: schöner.
Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei Panini/Vertigo erneut. Panini hat Sandman neu übersetzten lassen lassen und folgt dabei der neusten Sammelauflage der Amerikaner, tischt uns damit also die neue digitale Kolorierung auf. Die alte Kolorierung ist freilich nicht gänzlich zu verachten; vor allem Freunde der klassischer Gruselrießer-Comics dürften daran Gefallen finden. Immerhin: die 75 Hefte der »Sandman«-Reihe, die von 1989 bis 1996 (fast immer) monatlich erschienen, dokumentieren nebenbei auch die Geschichte der Umstellung zum digitalen Einfärben der s/w-Linienzeichnung. Der Vergleich von Seite 1 in alter und neuer Kolorierung zeigt, wie Dank digitaler Bildbearbeitung feinere Farbnuancen & -verläufe möglich sind. Die Seiten sind zugleich dezenter eingefärbt, und wirken dennoch plastischer. Dadurch geht zwar der horror-trashige Charakter der ursprünglichen Koloierung verlohren, aber alles in allem finde ich die neue Farbgestaltung angenehmer, stimmungsvoller, kurz: schöner.
Zu den bezaubernsten Markenzeichen von Gaiman gehört, wie es ihm gelingt, kleine Geschichten in der großen Geschichte unterzubringen; wie er vor allem mit »Sandman« eine Geschichtenerzähl-Maschinerie anwirft, die im Besten Sinne an die berühmte Wendung aus Michael Endes »Die Unendliche Geschichte«
Aber dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden
oder auch an die labyrinthische Weberei von Schahrasads Erzählungen in »Tausendundeiner Nacht« erinnert.
Wie bei jeglicher ehrwürdiger Phantastik bietet »Sandman« seinen Lesern ein facettenreiches philosophisches Panoptikum an. Philosophisch im hehresten Sinne, eignet sich dieses Epos über Niedergang und Wiederaufstieg, über Sehnsucht und Zorn doch vorzüglich dazu, den Leser unaufdringlich die Kunst des Sterbens zu lehren, ohne Verzweiflung damit fertig zu werden, daß unser aller Leben auf ein unausweichliches Ende zustrebt, es also nur in unserer eigenen Verantwortung liegt, welche Welten wir für uns und unsere Mitmenschen bauen.
•••
LINK-SERVICE
- In der deutschsprachigen Wikipedia schreiben Sandman-Leser fleißig, stellen Übersichten zu den zehn Sammelbänden und die Charaktere zusammen. Guter Einstieg, um in den Tiefen der Sandman-Comics zu gründeln.
- Jürgen Weber lobt für »Buchkritik.at« und meint trefflich, daß…
»Sandman« Ihnen erlauben {wird} besser zu träumen.
- Björn Backes lobt in seiner Besprechung für »Buchwurm«:
»Sandman« ist ein ehrenwerter Fundus abstrakter Poesie, düster, betörend, verwirrend und in seiner Form definitiv einzigartig.
Leider stößt Björn aber auch wieder in das Horn, welches tutet, daß Gaiman verschreckend und verstörend ›brutal‹ ist. Liebe Leut: »Sandman« ist gedacht für ›mature readers‹. Trotz aller Auch-Eignung für aufgeweckte Teens, ist »Sandman« eben kein Kinderfantasykram, sondern beste Phantastik für reife Leser.
- Für »Roterdorn.de« schreibt Arielen (Christel Scheja) über Sammelband 1., und lobt sehr trefflich:
Einerseits kann man sich einfach nur von einer spannenden und ungewöhnlichen Geschichte unterhalten lassen - andererseits ist es auch möglich in die hintergründigen Szenarien einzutauchen, die in Text und Bildern erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Das macht die Serie zu Recht zu einem der Klassiker der Comic-Geschichte.
- Blogger-Kollege Miko O. von »Screwtape’s« beschreibt das umfassende Staunen, das Sandman seinen Lesern bereitet.
Neil Gaiman & Charles Vess: »Sternenwanderer«, oder: Geh’ und fang eine Sternschnuppe
 Eintrag No. 385 — Ich wage mal zu prophezeien, daß innerhalb des nächsten Jahres der Name Neil Gaiman endlich auch bei und zu einer endgültig strahlenden Größe der Mainstream-Phantastik wird (freilich nicht so ein gewichtiger Magnet wie Tolkien oder Rowling, aber deutlich bekannter als bisher).
Eintrag No. 385 — Ich wage mal zu prophezeien, daß innerhalb des nächsten Jahres der Name Neil Gaiman endlich auch bei und zu einer endgültig strahlenden Größe der Mainstream-Phantastik wird (freilich nicht so ein gewichtiger Magnet wie Tolkien oder Rowling, aber deutlich bekannter als bisher).
Immerhin: er war 2006 (und davor auch schon) auf Lesetour im Deutschsprachigen unterwegs; sein großes Hauptwerk, das 10-bändige Comicepos »Sandman« erscheint in neukolorierter und neuübersetzter Fassung endlich in einer schönen Ausgabe; und — last but not least — drei Filme nach Gaimans Stoffen stehen ins Haus (mehr darüber in meinem Bericht der Buchmesse-Leibzig-Lesungen von Gaiman). Als erstes kommt am 18. Oktober 2007 »Stardust« zu uns.
 Die Berichte von Testvorführungen in den englischsprachigen Webgefilden lassen mich hoffen, daß ›Besser-Fantasy-Freunde‹ gehörig auf ihre Kosten kommen. Die Verfilmung fährt mit einem Reigen z.T. länger nicht mehr gesehener Stars auf (neben Claire Danes, Jeremy Irons und Robert de Niro u.a. Michelle Pfeiffer und Peter O’Toole). Auch der wohlwollende Vergleich den begeisterte Testgucker zwischen der »Stardust«- und der »Die Braut des Prinzen«-Verfilmung ziehen, läßt zumindest mich hoffnungsvoll fibbern. Handelt es sich doch bei Williams Goldmans Klassiker »Die Braut des Prinzen« doch um einen modernen Klassiker der leichtfüßigen, munter fabulierfreudigen Fantasy, in der das Genre zwar nicht so bierernst und ›äpisch‹ daherkommt wie bei den geliebten Schlachtenpanoramen, die (zumindest meiner Meinung nach) unseeligerweise das Bild von dem was Fantasy leisten kann dominieren. Aber dafür brilliert »Stardust« wie auch schon Goldmans Meisterwerk mit lebendigen, lebensechteren Figuren, die im Gegensatz zu Heilgeschichtenfantasy nicht »sprechen und agieren, als ob sie Marmor scheißen würden« (um in etwa einem Ausspruch den fiktiven Herrn Mozart aus dem Drama/Film »Amadeus« zu zitieren). Dabei nehm ich die »Der Herr der Ringe«-Romane & Verfilmung mal in Schutz, denn diese überragen, trotz aller Epik-typischen Schwächen & Eigenheiten, solch oberöde und peinlich anzuschauende Abklatschwahre wie »Eragon« und »Narnia« bei weitem.
Die Berichte von Testvorführungen in den englischsprachigen Webgefilden lassen mich hoffen, daß ›Besser-Fantasy-Freunde‹ gehörig auf ihre Kosten kommen. Die Verfilmung fährt mit einem Reigen z.T. länger nicht mehr gesehener Stars auf (neben Claire Danes, Jeremy Irons und Robert de Niro u.a. Michelle Pfeiffer und Peter O’Toole). Auch der wohlwollende Vergleich den begeisterte Testgucker zwischen der »Stardust«- und der »Die Braut des Prinzen«-Verfilmung ziehen, läßt zumindest mich hoffnungsvoll fibbern. Handelt es sich doch bei Williams Goldmans Klassiker »Die Braut des Prinzen« doch um einen modernen Klassiker der leichtfüßigen, munter fabulierfreudigen Fantasy, in der das Genre zwar nicht so bierernst und ›äpisch‹ daherkommt wie bei den geliebten Schlachtenpanoramen, die (zumindest meiner Meinung nach) unseeligerweise das Bild von dem was Fantasy leisten kann dominieren. Aber dafür brilliert »Stardust« wie auch schon Goldmans Meisterwerk mit lebendigen, lebensechteren Figuren, die im Gegensatz zu Heilgeschichtenfantasy nicht »sprechen und agieren, als ob sie Marmor scheißen würden« (um in etwa einem Ausspruch den fiktiven Herrn Mozart aus dem Drama/Film »Amadeus« zu zitieren). Dabei nehm ich die »Der Herr der Ringe«-Romane & Verfilmung mal in Schutz, denn diese überragen, trotz aller Epik-typischen Schwächen & Eigenheiten, solch oberöde und peinlich anzuschauende Abklatschwahre wie »Eragon« und »Narnia« bei weitem.
Und dennoch: auch Gaiman fühlt sich aufgerufen, sich abzugrenzen vom übergroßen Einfluß Tolkiens und seines Mittelerde-Ringkrieges auf das, was man im englischen Raum heute ›Fantasy‹ nennt. So erzählt er Quint von »Aint It Cool News« seine Ambition zu »Stardust« (Übersetzung von Molo):
GAIMAN: Tolkien ist wundervoll. Ich bin ein großer Fan von
»Der Herr der Ringe«, aber trotzdem: es hat etwas auf sich damit, wie sich das Fantasy-Verständis aller hinsichtlich von »Der Herr der Ringe« seit dessen Erscheinen gewandelt hat. Mich fasziniert nun mal diese Zeit vor 1930, wenn ab und an Menschen Fantasy, also Märchen- und Elfen-Geschichten schrieben. Man schrieb damals magische Erzählungen und das waren einfach nur ganz normale Romane. Es gab da nicht etwa eigene Regale für Fantasy. Man schrieb Romane, die halt in Form von Märchen auftraten.
So war auch meine Einstellung als ich »Stardust« schrieb. Ich wollte etwas machen, daß ganz für sich stehen kann, das anders war und sich doch wie Fantasy, wie ein Märchen anfühlen sollte. Dabei war mir von Beginn an klar, daß es eine ›Romanze‹
{engl. ›romance‹; die Übersetzung mach daraus nict ungeschickt ›zauberhaftes Abenteuer‹ — Anmerk. Molo} werden sollte. Auch beim Schreiben selbst hatte ich die Liebesgeschichten alter Screwball-Komödien als Vorbild im Sinn. Sachen wie
»Es geschah in einer Nacht« {Dem Frank Capra-Klassiker von 1934 mit einem jungen Clake Gable und der bezaubernden Claudette Colbert in den Hauptrollen — Anmerk. Molo}: da sind Heldin und Held gemeinsam unterwegs, und die beiden können sich zuerst gar nicht ausstehen, verlieben sich aber aber schließlich ineinander und werden ein romantisches Pärchen.
Für mich immer schön, wenn statt Epik weniger pathetiklastiges Zeug als Inspirationsquell herangezogen wird. Aber was bietet nun »Stardust« das Buch?
Der Phantastik-Weltenbau geht so: Seit mindestens sechshundert Jahren gibt es in England das Örtchen Wall, und dort befindet sich eine Mauer deren einzige Lücke von den Dorfbewohnern bewacht wird. Denn: diese Lücke ist ein permanenter Übergang in die Elfen-, Zauber-, Märchenwelt. Jenseits der Mauer befindet sich eine Wiese, an die grenzt ein Wald an und was dahinter kommt, kann man sich als Leser munter selbst ausmalen (Gaiman würzt zwar seine Erzählung munter mit Terrain-Namen der Elfenwelt, aber es gibt — mutiger- und für mich erfeulicherweise — keine Karte.)
Im ersten von zehn Kapiteln lernen wir noch nicht den eigentlichen Helden kennen, sondern bekommen erstmal die erotischen Jugendabenteuer seines Vaters Dunston Thorn geschildert. Alle neun Jahre im Mai findet nämlich ein Markt auf der Elfenwiese statt. Wir lernen Wall und einige Bewohner kennen, genauer: das Dorf Wall der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, etwa um 1837-1839 (so mache Rezischreiber/innen haben das nicht gerafft und verorten die Geschichtlich zeitlich grob zu früh oder zu spät), als Königin Victoria regierte und Charles Dickens in Fortsetungen seinen »Oliver Twist« in »Bentley’s Miscellany« veröffentlichte. Am Ende des ersten Kapitels ›erntet‹ Papa Thorn neun Monate nach seiner Markt-Liebesnacht seinen Elfen/Menschen-Mischlings-Sohn Tristran.
Jahre vergehen, und wir begleiten Tristran als liebesblinden Verehrer der Dorfschönheit, der er eines Nachts verspricht, ihr eine Sternschnuppe als Beweis seiner ergebenen Liebe zu bringen. Das Dumme: die Sternschnuppe kam auf der Elfenseite der Mauer runter und entpuppt sich dort als junge, eigenwillige Frau. Auf seiner Queste steht Tristran diesem Stern in Menschengstalt bei, denn die Arme hat sich bei ihrem Sturz einen Fuß gebrochen. Zudem sind andere hinter der Gefallenen her. Die Anführerin eines Hexentrios, der Lilim, hat vor, der Sternenfrau das Herz rausschneiden, damit die Lilim weiteren Zauber zum Erhalt ihrer Jugendlichkeit wirken können. Und die lebenden (und toten) Söhne des verstorbenen Königs des Elfenlandes kabbeln und itrigieren darum, den gestürzten Stern in ihren Besitz zu bringen, denn damit wird die Thronfolge entschiedenen.
Mir gefällt vor allem das Neben- und Ineinander, mit dem der große Bogen des Romantik-Ping-Pongs und die episodenhaften Stationen der verschiedenen Questen miteinander verwoben sind. Und ich liebe wie immer die Kunstfertigkeit, mit der Gaiman kleine Geschichen in der Geschichte unterbringt und anschneidet. So erzählt die Lilim-Anführerin in einer Szene nächtens am Lagerfeuer (S. 116):
»Man hat die Lilim schon des Öfteren für tot erklärt, aber es war jedes Mal gelogen. Das Eichhörnchen hat die Eichel noch nicht gefunden, aus dem die Eiche wachsen wird, die das Holz für die Wiege des Kindes liefert, das mich erschlagen wird.«
Und eine Seite weiter endet dieser Abschnitt so:
Zögernd hoppelte ein Eichhörnchen in Licht des Feuers. Es nahm eine Eichel, hielt sie einen Moment in seinen handartigen Pfoten, als wollte es beten. Dann rannte es davon, um die Nuss zu vergraben und zu vergessen.
Diese Art von Phantastik-Tollerei begeistert mich ja auch bei Tolkien (ich denke an den über die lärmenden Hobbits grollenden Fuchs). Kurz: Derzeit kenne ich keinen Phantasten, der es so hervorragend versteht, zugleich gradlinig und auf Umwegen zu erzählen, wie Gaiman.
ACH, GEJAMMER
So. Nun will ich meine klagenderen Töne nicht länger zurückhalten, denn manchmal ist es eben zum Verzweifeln.
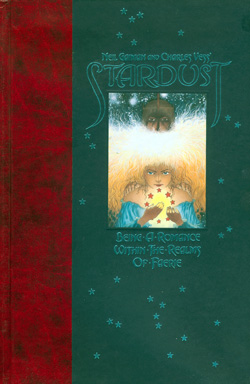 Da werden im anglo-amerikanischen liebevoll gestaltete Sachen vorgelegt, so richtig dolle altmodisch mit fetten Illustrationen und Vignetten, Federzeichnungen in schwarz-weiß, mal flüchtiger (150 Vignetten und Rahmen), mal aufwändiger (4 doppelseitige und 19 ganzseitige Bilder) gearbeitet, davon ganzseitige, Arbeitsskizzen. Einige schöne Beispiele kann man im Greenmanspress-Blog von Charles Vess bewundern. Aber die Lizenzheinis von Heyne haben sich bei der deutschen Erstausgabe die ›Nur Text‹-Version andrehen lassen. Ob Stephen Kings »Dunkler Turm«, Susanna Clarkes »Die Damen von Grace Adieu« oder eben Gaimans »Sternenwanderer«, für uns deutschsprachige Trottelkunden reichts billig und unzierlich. »Ist ja nur Fantasy und Genrequatsch«, scheint man in den Kalkulationsabteilungen zu denken. Das mag für einige Genre-Leser gelten, aber ich werde weiterhin nölen und mosern, wenn ich über solche Schwachmatik stolpere, und ich werde mich hüten solche schmucklosen Deutschausgaben zu kaufen (aber: als Unterwegslektüre ist die ›Nur Text‹-Ausgabe freilich besser geeignet).
Da werden im anglo-amerikanischen liebevoll gestaltete Sachen vorgelegt, so richtig dolle altmodisch mit fetten Illustrationen und Vignetten, Federzeichnungen in schwarz-weiß, mal flüchtiger (150 Vignetten und Rahmen), mal aufwändiger (4 doppelseitige und 19 ganzseitige Bilder) gearbeitet, davon ganzseitige, Arbeitsskizzen. Einige schöne Beispiele kann man im Greenmanspress-Blog von Charles Vess bewundern. Aber die Lizenzheinis von Heyne haben sich bei der deutschen Erstausgabe die ›Nur Text‹-Version andrehen lassen. Ob Stephen Kings »Dunkler Turm«, Susanna Clarkes »Die Damen von Grace Adieu« oder eben Gaimans »Sternenwanderer«, für uns deutschsprachige Trottelkunden reichts billig und unzierlich. »Ist ja nur Fantasy und Genrequatsch«, scheint man in den Kalkulationsabteilungen zu denken. Das mag für einige Genre-Leser gelten, aber ich werde weiterhin nölen und mosern, wenn ich über solche Schwachmatik stolpere, und ich werde mich hüten solche schmucklosen Deutschausgaben zu kaufen (aber: als Unterwegslektüre ist die ›Nur Text‹-Ausgabe freilich besser geeignet).
Insofern also: Lob und Jubel über Vertigo/Panini! Vertigo hat in den letzten 15 Jahren seines Bestehens die Genre-Phantastik in Comicform ordentlich reloaded. Ich bin von Beginn an ein richtiggehender Fan dieses Labels und werde in Zukunft sicherlich noch mehr gelungene neue Phantastik dieses Verlags hier vorstellen.
Dann aber leider: Die Übersetzung von Christine Strüh schwächelt z.B. was den Umgang mit kursiven Stellen betrifft. Was ist so schwer daran, im Deutschen konsequent kursiv zu formatieren, was auch im Englischen kursiv ist?
Auch sind (wohl wegen Stress, Hektik, Fußpilz) veloren gegangene Stellen zu beklagen. Einmal habe ich sogar einen ganzen fehlenden Absatz erspäht (S. 61 sowohl in dt. wie angl. Ausgabe):
A small, yellow bird in a cage sat on its perch outside the house. It did not sing, but sat, mournfully upon its perch, feathers ruffled and wan. There was a door to the cottage, from which the once-white paint was peeling away.
Ein kleiner, gelber Vogel saß auf seinem Ast vor dem Haus. Er sang nicht, sondern hockte auf seinem Ast, die Federn zerrauft und blass. Eine Tür führte in das Häuschen, von der die einstmals weiße Farbe abbröckelte.
Bei anderen Gelegnheiten stelle ich fest, daß die deutsche Ausgabe deutlich ausführlicher als meine englische Edelausgabe von Titan Books. (Das kann aber auch Gaimans eigenem Durcheinander liegen, denn es gibt im englischsprachigen eben auch Nur-Text-Ausgaben — und auf dieser beruht die Übersetzung von Christine Strüh — für die Gaiman hie und da den Text bearbeitet hat. Schönes Durcheinander wieder mal. Immer diese Kreativen!)
Aber aus, weg ihr Nörgelgedanken, denn immerhin ist nun was »Stardust« angeht der Not-/Mißstand behoben, noch dazu, weil die schmuckvolle Ausgabe einen bemerkenswert günstigen Preis hat (Neupreis ca. 20 Euro).
•••
SERVICE: LINKSAMMLUNG
- Michael Drewnik für Phantastik-Couch (›nur Text‹-Ausgabe): »Ein modernes Märchen mit scharfen Zähnen.« — Genau! Und Krallen, die sowohl zu kratzen wie zu streicheln vermögen.
- Götz Piesbergen für Splashbooks (›nur Text‹-Ausgabe): »Neil Gaiman hat nämlich ein paar Szenen eingestreut, die, sagen wir mal, nicht für Leute mit schwachem Magen geeignet sind. In diesen Szenen wird ziemlich detailliert gestorben und geschlachtet, was dann eher unpassend wirkt.
Das heißt nicht, dass das Buch bierernst ist. Einige Figuren und Szenen haben einen schönen schwarzen Humor, den sie mit sich tragen.«
— Woher kommt diese refelxhafte Pfui-Bäh-Abneigung von Fantasy-Fans gegen Härten? Warum sollte in Fantasygeschichten irgendwie lieber und süßer gestorben werden als in anderen Genres? Da kann ich ja gleich Teletubbies gucken und den lieben langen Tag mit der Sonne lachen. NeNe, lieber Götz: richig gute Phantastik wie die von Gaiman bietet eben neben dem Bezaubernden, Romantischen, Lustigem auch das Unheimliche, Brutale und Gemeine.
- Mistkäferl für Bibliotheka Phantastika (›nur Text‹-Ausgabe): »Der Autor benutzt die genreübliche, leicht anachronistische Sprache äußerst virtous und versteht es, komische Szenen gekonnt einzubauen … enormer Ideenreichtum.« — Auch hier werden Gaimans »typisch(e) abgedrehte Horrorelemente« besorgt vermerkt. Ja sind denn die Grimm-Geschichten nur Friede, Freude, Eierkuchen. Unheimliches und blutiges gehören nun mal zu einem richtigen Märchen.
- Michael Matzer für carpe librum (›nur Text‹-Ausgabe): »Dies ist ein wirklich zauberhaftes und ironisch erzähltes Garn, das uns Gaiman da vorsetzt. Und man unterhält sich auch wunderbar dabei, wartet doch an jeder Ecke eine neue Überraschung.«
- Arielen (Christel Scheja) für Rotern Dorn (illustrierte Ausgabe): »Der Roman ist jedoch kein Märchen für Kinder, dazu sind die angesprochenen Themen zu komplex und die Figuren zu bösartig. »Der Sternenwanderer« richtet sich eher an Erwachsene, die die kleinen Anspielungen und leisen Zwischentöne in den Zeilen herauslesen können und sich voll und ganz auf dem magisch mythischen Text einlassen wollen.« — Nichts für Kinder! Also ich mochte als ›Noch Nicht‹-Teen und Frühteen solche blutigen, facettenreichen Sachen.
Abschließend also meine Leseempfehlung: »Sternenwanderer« ist was für aufgeweckte Jungleser (so ab 10 bis 12 würd ich sagen), und die illustrierte Ausgabe kann man meiner Meinung schon gewitzten Noch-Jüngeren in die Hand drücken.
Sid Jacobson und Ernie Colón: »The 9/11 Report« — Das Comic
Eintrag No. 382 — Verwirrung erstmal. Zuviel Ungeheuerliches ist auf einmal geschehen. Wie der Fuß eines Riesen stampfte das ›Schicksal‹ einmal in den USAmeisenhaufen. Wie immer, wenn z.B. Präsidenten erschossen wurden, Schiffe sanken, Atomkraftwerke hochgingen, Raumfähren explodierten, Sekten in U-Bahnen die Apokalypse einläuten wollten oder Einzelgänger im Amokrausch einen Haufen Mitmenschen killten, sicher ist: Jedes spektakuläre Unglück zieht investigative Anstrengungen nach sich. Die Betroffenen und Hinterbliebenen möchten verzeifelt verstehen: »Wie es dazu/soweit kommen konnte?«.
 Wie wohl so manch anderer auch, habe ich noch einen Stapel Berichte, kopierte Zeitungsartikel und Sonderausgaben verschiedener Magazine über IX.XI angesammelt. Da kommt mir nun dieses Sachcomic, das auf dem gleichnamigen, sehr dicken Report der 9/11-Untersuchungskommission beruht, gerade recht.
Wie wohl so manch anderer auch, habe ich noch einen Stapel Berichte, kopierte Zeitungsartikel und Sonderausgaben verschiedener Magazine über IX.XI angesammelt. Da kommt mir nun dieses Sachcomic, das auf dem gleichnamigen, sehr dicken Report der 9/11-Untersuchungskommission beruht, gerade recht.
Immerhin führt gleich der Beginn eindringlich vor, welche großartigen Darstellungsmöglichkeiten die graphische Erzählform bietet. Statt die Unglückschronologie der vier entführten Flugzeuge nacheinander aufzubereiten, stellt das Comic auf den etwa ersten 30 Seiten in vier waagrechten Schichten die zeitliche Folge der Ereignisse gleichzeitig dar. Der Umstand, daß das letzte der vier Flugzeuge noch gar nicht gestartet war, als der erste Flieger in den Nordturm des World Trade Centers einschlug, wirkt auf diese Weise besonders verstörend.
An besagten September-Dienstag vor sechs Jahren kramte ich doch mal wieder (nach einigen Monaten der Vernachlässigung) damalige Kladde heraus und schrieb:
11. September 2001: Anschlag auf USA. Nicht überrascht. Habe ein solches mit dem zunehmenden Chaos seit Regierungsantritt von Bush jr. mehr oder minder erwartet. Inzwischen, nach 6 St. Infosucking breche ich (emotional & konzentrationsmäßig) a weng zusammen. Dies ist für die Meisten wohl der Beginn eines neuen Zeitalters. Die ›Moderne‹ ist vorbei, wobei die Chance ist, daß Amerika (und der Westen) zum Erwachsensein und Beenden ihrer Heuchelei ›geprügelt‹ werden. In SF-Welten wird manchmal etwas vorgestellt, daß im frühen 21. Jhd. anhebt: The New Dark Ages.
Auch heute noch empfinde ich die IX.XI.-Anschläg auf World Trade Center, Pentagon und Weißes Haus größtenteils als etwas Beruhigendes, Klärendes. Die Welt hat sich mal unumwunden als das entblößt, wofür ich sie (kleiner Katasthophikus der ich bin) schon lange halte; als chaotisches Jammer- und Jubeltal, als Arena der Rangelein um Verwöhnungsresourcen aller Parteien die auf dicke Hose machen. Jedes Kollektiv will halt erstmal für sich und seine Leute ein schickes Paradies abgrenzen. Zugegeben: seit den Anschlägen wurde deutlich, wie sehr ›dem Westen‹ — sprich: den Ex-Kolonialmächten der Globalierungstäter — das von ihren Aufbruchsdynamiken verursachte Ungleichgewicht und Elend der Globalisierungsopfer Wurscht war.
New York ist also entsetzt, die westliche Welt fällt auch allen Wolken vor geschockter Verdutztheit; im Orient aber werfen viele begeistert und freudig die Arme in die Höhe und heben zu gern den Aktions- und Konzeptkünstler Bin Laden als Robin Hood unserer Tag auf den Schild. »Kampf der Kulturen« nennen das dann jene, die beim Interpretieren von Politik und Geschichte über (zivilisierte) Cowboys und (bestialische) Indianer nicht hinauskommen. Groß ist die Verführung, den Hexenkessel der menschlichen Konflikte auf das Niveau eines Schachspiels zwischen zwei Parteien zu versimpeln.
Kein anderes Land der westlichen Moderne versteht es so glänzend wie die USA, seine Wahloligarchie (vulgo: Demokratie) zugleich sakral und pragmatisch zu inszenieren. Das Sakrale liefert dabei den Drive und die Aura für das mediale Auftreten, als erwählte Nation, als Heim der Mutigen, als Gottes ureigenes Land. Dass dieses gelobte Land dabei zutiefst durch die Offenbahrungswahrheiten fundamentalistischer Evangelikaler und die Chauvenismen z.B. der WASP-Minderheit pervertiert wurde, wird mittlerweile auch von den US-Amerikanern selbst kritisch verhandelt. Da kamen Topf und passender Deckel zusammen, als selbsternennte Heilige Krieger im Namen eines anderen montheistischen Obermännchens ein buchstäbliches Mordsecho als Erwiderung auf diese Machtarroganz verlauten ließen.
Mittlerweile sprechen ja die US-Amerikaner selbst über die auffälligen Ungerechtigkeiten ihres mehr oder minder unverhüllten Feudalismus, der krassen asymmetrischen Macht- und Wohlstandshierarchie, die die ganze westliche Welt mehr oder weniger prägt (und ja: auch ich halte diese westliche Schieflage noch immer für ›besser‹, als die traditionellen, vormodernen Stammesformate der Zweit- und Drittwelt-Gesellschaften).
Von all dem ist in der Comic-Adaption nicht ausdrücklich die Rede, bildet aber für mich den Hintergrund, vor dem die Anstrengung des Verstehens sich lohnend lesen lassen. Zu komplex und undurchschaubar ist das ganze Geflecht aus Politik und Medialität.
Was das Comic aber schön herausgarbeitet, ist die seltsame Untätigkeit und ›Selbst im Weg Steherei‹ der Geheimdienste und Sicherheitsinstitutionen vor und während der Anschläge. Dass sich in den radikalisierten Kreisen des mittleren Ostens etwas zusammenbraut zeichnete sich lange vor IX.XI ab, wie der Kommissionsbericht rügt. Man hätte schon zu Clintons Zeit etwas unternehmen können. Was nicht im Comic steht abr für mich ebenfals zum wichtigen Hintergrund gehört, ist die peinliche Tatsache, daß die amerikanische-westliche Öffentlichkeit u.a. mit hysterischen Voyeurismus lieber der Ausbreitung der intimen Fehltritte ihres Präsis Clinton Aufmerksamkeit schenkte; auch das Pahö um den Hickhack der gefinkelte Wahlen und des umstrittenen Sieges der Bush jr.-Regierung trug nicht dazu bei, daß Amerika und der Westen aus ihrer notorischen Baunabelpuhlerei bei Zeiten heraufand. So schlug dann scheinbar völlig aus dem Nichts kommend überraschend die Große Geschichte vier Mal auf die größte Bushtrommel der Welt.
Ich will die Comic-Adaption nicht als Poragandawerk abtun, auch wenn ich ab und an genau diesen Eindruck bei der Lekütre hatte. Jedoch: Die ehrliche Anstrengung der Kommission, die eigenen Versäumnisse zu ergründen erscheint mir zutiefst aufrichtig. Mir, als ›kritischen Europäer‹, ist aber dennoch mulmig. Zwar finden sich viele der sprechensten Ikonographien die seit 9/11 in den Bildermythos des Informationszeitalters eingingen im Comic wieder. Es fehlt aber z.B. das dumme Geschau von Bush jr. bei seinem Besuch einer Grundschule, als ihm die Meldung vom Anschlag in New York zugeflüstert wurde; es fehlen die schrillen Töne von Bush jr., als er sich verbal auf die Brust trommelte:
»We will hunt them down and smoke them out« (»Wir werden sie {die Terroristen und ihre Hinterleute} zur Strecke bringen und ausräuchern«).
Später im Comic, bei den zwei Seiten über den Vergeltungkrieg der Amerikaner gegen das Talibanregime in Afghanistan lese ich zwar, daß diese Aktion von »Symphatiebekundungen für die USA« begleitet wurden. Kein Wort aber über jubelnde Sympathisanten der Anschläge, kein Wort über die politischen Einsprüche der westlichen Nationen und der bis heute anhaltenden weltpolitischen Verstimmungen (»Old Europe«), die der Krieg gegen den Terrormismus zeitigte.
Gerechterweise aber kann ich die Adaption loben, wenn es darum geht, wie nüchtern und dennoch ergreifend die Anschläge als schockierendes Unglück darstellt werden. So sehr man die US-amerikanische Hegemonialpolitik, dieses breitbeinige Gebahren als Möchtegern-Rom verachtet, die Erschütterung und Verunsicherung der amerikanischen Seele welche die Terroranschläge bewirkten, kommt glaubwürdig rüber. Sind halt auch nur Menschen, die Amis.
Das beginnt schon beim Umschlag: ganz unten ein Panoramabild der Manhattenskyline mit WTC und einem nahenden Flieger; darüber das monströse Räucherwerk der brennenden Türme; und darüber ein Feuerwehrmann, der aus Fassungslosigkeit sein Gesicht mit der Hand bedeckt.
Die unheimlichste Passage aber ist für mich als Maximalphantast der Ausklang des Buches, wenn die 9/11-Kommission Überlegungen anstellt, welche Lehre man aus dem Unglück ziehen kann, was man in Zukunft besser machen kann. Neunzehn Terroristen waren in der Lage, der letzten Supermacht deshalb gehörig ins Gemüth treten, weil die entsprechenden Organe der Supermacht zu wenig Phantasie zeigten. Es ist mehr als bittere Ironie, daß die Wohlstandszonen bis heute von paranoiden Zuckungen und Verschörungshysterien gelähmt werden.
(Das markanteste Beispiel, daß Fabulatoren der Unterhaltungsindustrie diesbezüglich den strategischen Analysten und Planern aus Politik und Armee ›überlegen‹ sind: ein halbes vor dem 11. September bot der Pilotfilm des »Akte X«-Ablegers »The Lone Gunmen« genau den Terroranschlag-Plot, nur mit der Wendung, daß es finstere Klüngler des militärisch-industriellen Komplexes der USA sind, die mittels Fernsteuerung ein Flugzeuganschlag auf das WTC durchführen wollen, um sich ein sattes Budget zu sichern.)
Im 9/11-Report und seiner Comicumsetzung heißt es entsprechend mahnend:
»Es muß eine Möglichkeit gefunden werden, wie Fantasie auch von Amts wegen routinemäßig eingesetzt werden kann.«
Man kann das von Donald Rummsfeld ins Leben gerufene ›Des-Informationskader‹ als eine Anstrengung dieser Routinisierung von Phantasie im War on Terror, im Rennen um das 21. Jahrhundert, im Dominanzgerangel des Informationszeitalters mit seinem Kampf um die besten Köpfe usw. sehen. Und dies ist vielleicht der unheimlichste Eindruck, den dieses spannend zu lesende Sach-Comic bei mir hinterlassen hat.
•••
Link-Service: Hier zu einer kleinen Sammlung Quicktime-Filmchens bei Bookwarp mit Selbstauskunft der Comicmacher Jacobson und Colón über ihre Adaption.
China Miéville: »Der Eiserne Rat« und Bas-Lag, oder: Wenn die ›Weird Fiction‹ revoluzzt
Eintrag No. 379
•••
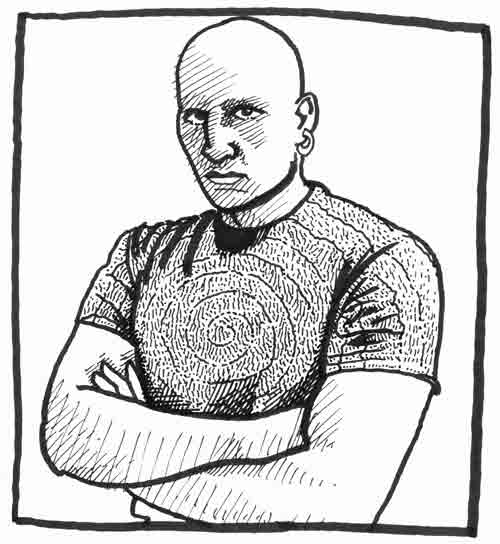 Vorweg der Offenbarungseid: Seit meiner ersten Reise zur »Perdido Street Station«[01] New Crobuzons in der ›Weird Fiction‹[02]-Fantasywelt Bas-Lag bin ich von China Miéville (1972) und seinem Schreiben in zappeliger Fan-Manier begeistert. In noch heftigeres Erstaunen versetzte mich die zweite, diesmal maritime Ausfahrt mit »The Scar«[03]. Entsprechend besorgt und her-ausgefordert bin ich deshalb, ob’s mir denn dermaßen heftig infiziert überhaupt gelingen kann, nicht-peinlich über »Der Eiserne Rat« zu schreiben. Immerhin ist Miéville einer dieser Autoren, die Leserschaften polarisieren. Noch vor wenigen Jahren, im Umfeld des Erscheinens von »Perdido Street Station« und »The Scar«, hat Miéville rabaukig über die ›ausgelatschten‹ Touristik-Pfade in tolkienartige ›Fäntäsyländs‹ gemosert.[04]
Vorweg der Offenbarungseid: Seit meiner ersten Reise zur »Perdido Street Station«[01] New Crobuzons in der ›Weird Fiction‹[02]-Fantasywelt Bas-Lag bin ich von China Miéville (1972) und seinem Schreiben in zappeliger Fan-Manier begeistert. In noch heftigeres Erstaunen versetzte mich die zweite, diesmal maritime Ausfahrt mit »The Scar«[03]. Entsprechend besorgt und her-ausgefordert bin ich deshalb, ob’s mir denn dermaßen heftig infiziert überhaupt gelingen kann, nicht-peinlich über »Der Eiserne Rat« zu schreiben. Immerhin ist Miéville einer dieser Autoren, die Leserschaften polarisieren. Noch vor wenigen Jahren, im Umfeld des Erscheinens von »Perdido Street Station« und »The Scar«, hat Miéville rabaukig über die ›ausgelatschten‹ Touristik-Pfade in tolkienartige ›Fäntäsyländs‹ gemosert.[04]
»Jüngstes Superduper-Genie der anspruchsvollen Genre-Zunft!«, jubeln durch die Phantastikbeete ondulierende Hurra-Schlümpfe wie ich; »›Nett‹, jedoch störend verhunzt durch renitente Marxistenprophetenpolemik«, meinen Skeptiker, und deuten dazu jetzt besonders bei »Der Eiserne Rat« auf die befremdende politische Heftigkeit von Miévilles verdrehter Fabuliererei hin. Später mehr zu diesen ›Vorwürfen‹.
Allein das Kuddelmuddel an Widersprüchen, in die sich Miéville verstrickt, wenn er über die empfohlene Lesereihenfolge der Bas-Lag-Romane spricht: Mal sagt er, dass jeder der drei Bas-Lag-Romane für sich allein genommen ›rund‹ sei; als Text Genuss verschaffen, als Story Substanz, und als Statement Virulenz haben soll. Dann aber nennt er die drei Bücher auch mal locker ›Anti-Tolkien‹-›Anti-Trilogie‹-Trilogie, deren Teile sich in beliebiger Reihenfolge lesen ließen. Und schließlich, dass in der Folge ihres Erscheinens (die auch dem Verlauf der Bas-Lag-Chronologie entspricht) nach »Perdido Street Station« und »The Scar« nun »Der Eiserne Rat« so was wie ein Abschlussstein ist. In mehrfacher Hinsicht wird damit diesem Dritten im Bunde strukturell und programmatisch die Aufgabe aufgebürdet, kulminativer Höhepunkt zu sein. Wurscht, was man sonst über das Fantasy-Genre zu wissen glaubt, sicher ist immer: Der letzte Teil einer Trio lässt die Fetzen nur so fliegen!
Jetzt wäre China Miéville nicht dieser unverschämt talentierte Ideen-Lausbub der er ist, wenn er nicht schon bei der Komposition der Struktur einer Trilogie ›Unsinn‹ anstellte. »Perdido Street Station« und »The Scar« ähneln einander, sind beide noch verhältnismäßig konventionelle Romane. Beide schildern auktorial die Handlung linear von A nach Z. »Perdido Street Station« bietet kleine Intermezzi einer, »The Scar« mehrere Ich-Erzähler-Stimmen, von denen eine auch in längeren Briefauszügen zu Wort kommt. »Perdido Street Station« ist ausschließlich in New Crobuzon (der bratzigsten Industriemetropole der Welt Bas-Lag) angesiedelt und umspannt einen Zeitraum von einem halben Jahr[05]. »The Scar« setzt nur wenig später ein, erstreckt sich über etwa ein Jahr[06] und begibt sich auf eine weite Rundreise durch die östliche Hemisphäre von Bas-Lag mit der schwimmenden ›Gestalt‹-Großstadt Armada (EIN Konkurrent von New Crobuzon beim Rennen um Macht und Reichtum).
Buch drei schlägt nun aus der Art. »Der Eiserne Rat« springt zwischen New Crobuzon und den westlichen Weiten des Kontinents Rohagi hin und her. Es gibt diesmal keine Ich-Erzählerstimme, alles wird aus einer Art auktorialer Vogelperspektive geschildert. Eine lange Rückblende steckt wie ein Fremdkörper im Gewebe des linearen, chronologischen Erzählverlaufs. Der Kernzeitraum der Gegenwartshandlung schildert die Ereignisse eines Jahres[07], die bis zu den Ereignissen der beiden Vorgänger reichende Rückblende aber umfasst einen Zeitraum von etwa 20 Jahren. Obwohl man die beiden Vorgänger nicht gerade als ereignisarm bezeichnen kann, überbietet »Der Eiserne Rat« — das kürzeste der drei Bücher — in fast schon beängstigender Manier die Geschehnisdichte von »Perdido Street Station« und »The Scar«.
Kurzum: »Der Eiserne Rat« ist als Bas-Lag-Einstiegslektüre nur Lesern anzuraten, die als waghalsige Freeclimber ohne Sicherung gern gewillt sind, die schwierigsten Hänge zu erklimmen. Man sollte schon ›einen leichten Schuss‹ haben, oder über so etwas wie ›robuste Lesegeschicklichkeit‹ oder ›Aufnahmeflexibilität‹ verfügen, wenn man mit »Der Eiserne Rat« seine Freude haben will.
Mit einer gewissen ›musikalischen Lesart‹ aber lässt sich diese widersprüchlich daherkommende Trilogie-Partitur als klassisch-dreisätzige Symphonie nehmen. In den einzelnen Sätzen greift Miéville thematisch und bezüglich des Settings auf ein jeweils anderes historisches Vorläufer-Genre der modernen Phantastiksparten zurück. Und jeder der drei Romane beschäftigt sich mit einer anderen Facette zum Thema Magie, die in Bas-Lag größtenteils als Thaumaturgie bezeichnet wird.
So gibt »Perdido Street Station« als urbaner Horrorthriller das Allegro ma non troppo, und ein freischaffender Querbeet-Thaumaturg baut einen Transformator, mit dem sich ›die Macht‹ der allgegenwärtigen Krisis-Energie nutzen lässt. Als Adagio in exile schildert dann »The Scar« eine Entdeckungsabenteuerfahrt von Piraten, und setzt sich anhand arkaner Möglichkeitsmagie mit den quantenphysikalischen Eigenschaften der Thaumaturgie auseinander. »Der Eiserne Rat« darf nun das Finale allegretto extravaganza sein und als großangelegtes, aus den Nähten der üblichen Romanform platzendes Potpourrie dem Eisenbahn-Western seine Referenz erweisen.
 »›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.
»›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.
Nach einem kurzen ›raunend‹-lyrischem Intro über einen Mann, der weiß, dass seine Pläne heilig sind, wird der Leser mitten in die Äktschn des ersten von drei großen Handlungssträngen in den Wald geschickt. Dort erwartet Cutter, ein Ladenbesitzer in den Dreißigern aus dem Gelehrtenviertel, in einer Hahnenkampfgrube seine Revoluzzerkameraden aus dem nahen New Crobuzon. Das Stadtimperium führt Krieg gegen das ferne und quecksilbrig-rätselhafte Tesh. Wie der Krieg losging, weiß niemand mehr so wirklich, sicher ist aber, dass der Konflikt für New Crobuzon bitterer und zäher verläuft, als das herrschende Stadtparlament und dessen Milizia erwartet haben. Die sechs Revoluzzer folgen der Spur des von ihnen allen verehrten, von Cutter sogar sehnsüchtig geliebten Judah, einer Art Guru der Dissidentenszene, der selbst auf der Suche nach dem legendären Eisernen Rat ist. Cutters und Judahs homoerotisch-, tragisch-romantische Liebesgeschichte erzählt von der Asymmetrie des Verlangens, mit für erfolgreiche Fantasy ungewöhnlicher Offenheit und ›Härte‹. Wer Schwulitäten in der Fantasy nicht abkann, sei ein wenig beruhigt. Der diesmal überwiegend knorrige, ›an kurzer Leine gehaltene‹ Sprach- und Szenenrhythmus bewahrt solche Leser davor, seitenlanges Auswalken von Homo-Herzeleid und Sexszenen ›erleiden‹ zu müssen. Alle anderen, denen es wie mir auch piepegal ist, zwischen wem oder was sich eine bewegende Liebesgeschichte abspielt, können Cutters Leiden an seiner eigenen be-dingungslosen Treue zu Judah als gute Darstellung von universellen Problemen lesen, die sich nun mal aus intimer Nähe ergeben. Doch Romanze beiseite, kommt Cutter mit am weitesten herum in der Welt des Romans. Seine ersten fünf Kapitel ist er mit seinen Revoluzzerkumpeln auf sich gestellt. Man reist mal zu Fuß, mal in einem Luftvehikel, mal übers Meer, und es ereignet sich auf diesen ersten 80 von 680 Seiten mehr Äktschn und Hatz, als anderswo im ersten von fünf dickleibigen Büchern.
Der zweite Handlungsstrang begleitet den jungen Dissidenten Ori auf seinem Weg durch die radikale Untergrundszene von New Crobuzon. Zugegeben, Ori vertritt sehr deutlich den Typ des tatendurstigen ›zornigen jungen Mannes‹. Man lernt ihn kennen bei einem außer Rand und Band geratenen Auftritt der Nuevisten, einer Gruppe kritisch-provokativer Agitprop-Aktionskünstler. Ein bissiges Marionettentheaterstück über die Hinrichtung des legendären Volkshelden Jack Gotteshand vor zwanzig Jahren wird gegeben. Ein Zensor der Stadtregierung hat ein wachsames Auge auf diese Michael Moores, und die extrem rechten Schlägerjungs von der Spitzen Feder Partei wollen den linken Provokateuren ans Leder: Tumult, Saloon-, pardon: Vaudeville-Schlägerei par excellence. So cool Ori die kreativen Sticheleien, Aktionen und Happenings der Nue-visten findet, ist er dennoch auf der Suche nach zupackenderen Tatgemeinschaften. Ori hat keinen Bock, seinen Gestaltungsdrang für eine gerechtere und bessere Zukunft mit Diskutierereien zu vertrödeln, und folgt lieber den wirren Weisungen eines alten Fuzzis aus einem Obdachlosenasyl. Dieser irre Alte, Spiral Jacobs, hat Jack Gotteshand noch gekannt und hilft nun Ori, das heikle Initiationsritual der Aktivisten-Zelle von ›Toro mit dem Stierkopf‹ antreten zu können. Nur fair und billig, in heutigen Zeiten die gute alte ›Knappe wird zum Ritter‹-Queste mal mit fanatischen Terrorzellen zu inszenieren (und: dieser Handlungstrang kommt mir zudem vor, wie eine sehr auf den Kopf gestellte Verarbeitung des minoischen ›Minotaurus im Labyrinth‹-Mythos).
Im dritten Gegenwartsabschnitt sind wir wieder mit Cutter unterwegs, diesmal durch die Randzonen des Krieges zwischen New Crobuzon und Tesh. Nach diesen Kriegsgräuel und Flüchtlingsschicksalen folgt die Unterbrechung, die große Synkope der ›Anti-Trilogie‹: Judahs Vorgeschichte, oder genauer, die »Anamnese«[08] vom ewigen Zug. Judah hat vor vielen Jahren als Kundschafter für den visionären Industriekapitän Wrightby das Sumpfland des Stiltspear-Volkes erforscht. Wrightby wollte das Unmögliche schaffen und eine Eisenbahnlinie westwärts quer durch den ganzen Kontinent errichten. Als die Bautruppen den Sumpf erreichten, konnte Judah nichts ausrichten und Wrightbys Unternehmen verdrängt die Stiltspear, wie alles andere, was sich dem Zug in den Weg stellt. Judah versucht verzweifelt, so viel wie möglich von der Stiltspearkultur zu bewahren und zu lernen. Dazu gehört die seltsame Kunst, Zeit zu manipulieren, welche schon Kinder üben, indem sie kleine, ungeschickte Matschmännlein machen. Nach der Zerstörung des Lebensraums der Stiltspear will Judah nichts mehr mit Wrightby und seinem ›Trancontinental Railway Trust‹ zu tun haben, kann sich jedoch dem Sog des Zuges nicht entziehen und bleibt so in dessen wuseligem Umfeld. Hier gibt es nun ordentlich viel Wilden Westen, und mittendrin Judah als Mann vieler Karrieren in den schnell entstehenden und wieder verfallenden Orten am Rande der Gleise, zwischen Kopfgeldjägern, Eisenbahnräubern, Spielern, Duellisten und Streckenbauern. Judah lässt sich auf ein junges wildes Landei ein, Ann-Hari, die sich lebenshungrig als Hure dem Eisenbahn-Tross anschließt. Für einige Zeit gehen die beiden nach New Crobuzon, und Judah beginnt sich intensiv mit Golemetrie zu beschäftigen.
Dieses bewusste Eingreifen in den Lauf der Dinge, diese Unterbrechung und Neuausrichtung von Vorgefundenem ist das magische Hauptthema dieses Bas-Lag-Romans. Judah wird zu einem Genie in der Kunst des thaumaturgischen Formatierens von ›Etwas‹ zu einem meist menschenförmigen Wesen und dem Programmieren dieser Wesen zu selbsttätig handelnden Agenten. Atemberaubend, woraus Judah im Lauf seines Lebens alles Golems macht[09], oder wie er diese Kunst mit Uhrwerken zu Zeit-bomben und Fallen ›verfeinert‹.
Zu den aufregenden Gedankenspielen Miévilles über Golemetrie gehört etwas, das man Judahs ›inneren Moral-Golem‹ nennen könnte. Diese ›Gutheit mit eigenem Willen‹ hat ein alter Stiltspear in Judahs Brust als Abschiedsgeschenk erweckt. Eine bewegende Szene und typisch für Miévilles zerschartete Idyllik: Die Rückmeldung der vom Fortschritt Überrollten ist hier nicht blinde Rache, sondern eine Gabe, die man ›Gewissen‹ nennen könnte. Gäbs ‘ne Hall of Fame für Metaphern, würde ich diesen Moral-Golem in der Abteilung vermuten, in der auch die goldene Kugel aus »Picknick am Wegesrand« der Strugatzki-Brothers ausgestellt wird. Atemberaubend auch, wenn in einem der längeren Großkämpfe des Buches Golemetrie und die am anderen Ende des thaumaturgischen Tat-Spektrums angesiedelte Elementarbeschwörung aufeinanderprallen: Wilde, ungezügelte Begierde von Feuer-, Fleisch- und Mond-Elementardämonen gegen mehrere Golems aus Eisenbahnbestandteilen und einen Lichtgolem.
Ich geh mal die Gefahr ein, als blauäugiger oder unentschlossener Depp dazustehen. Ich kann nicht erkennen, dass der bekennende Trotzkist und ›politische Aktivist‹ China Miéville mit solchen thematischen Melodien über bewusstes Manipulieren und leiden-schaftliches Draufloshandeln dem Leser wie auch immer geartete Propaganda für allgemeine oder extrem linke Programme auftischen will. Alle drei Bas-Lag-Romane führen am Ende ihrer argumentativen Verläufe allerdings zu vielstimmigen Fragestellungen, zu Aussichtsposten auf einschüchternd große und komplexe Probleme. Die Geschichten aus Bas-Lag sind eben kein Manifest und versuchen nicht, dem Leser das ein oder andere DU SOLLST! MANN MÜSSTE! reinzureiben, oder das sich dem menschlichen Komplettverständnis immer entziehende Echtwirklichkeits-Tohuwabohu in griffige Vereinfachungen zu pressen. Freilich werden Miévilles Bücher durch seine persönlichen Interessen und Vorlieben geprägt. So berechtigt eine gewisse Paranoia gegenüber der fabulierenden Zunft auch ist, ›vertraue‹ ich Miéville aber soweit, seine Romane als seine erzählende ›Kür‹ zu verstehen, in der er sich als Weird Fiction-Freak austobt. ›Nebenbei‹ zu seinen Romanen arbeitete Miéville an seiner akademischen ›Pflicht‹ in Form der Abschlussarbeit (über Theorie und Geschichte des Völkerrechts aus marx-istischer Sicht) »Between Equal Rights« an der London School of Economics. Seine Sympathien sind deutlich zu erkennen, wenn man sich z.B. die Milieu-Architektur seiner Dramaturgie anschaut: Die eigentlichen Machthaber, und die sonst oftmals im Zentrum von Genre-Stoffen stehenden Reichen und Schönen spielen meist nur am Rande eine Rolle, die tragenden ›Helden‹ der Bas-Lag-Bücher aber sind Außenseiter, Abweichler, oftmals aus den unteren Gesellschaftsschichten und entsprechend arm und durch’n Wind.
Die kräftigste Einzelillustration Miévilles für die Probleme, die sich aus der Um-zingelung des Menschen durch den Menschen ergeben, sind dabei vielleicht die ›Remade‹ von New Crobuzon. Die Rechtssprechung des imperial-merkantilen Stadt-staates verurteilt ihre Delinquenten zu einer Behandlung in den thaumaturgisch ausgestatteten Straffabriken, in denen die Körper der Verurteilten mit allen Kniffen der Kunst einer meist abartigen Umgestaltung unterzogen werden. Die Umgemodelten sind in den schlechteren Gegenden der Stadt zuhause und bilden neben den Armen und Immi-granten den verachteten und ignorierten Bodensatz der Gesellschaft von New Crobuzon. ›Glück‹ haben dabei noch jene Remade, die speziell für ihre jeweiligen Tätigkeiten als Kampf- oder Arbeitsmaschinen hergerichtet werden, oder als Sklaven in den fernen Kolonien und für andere Großprojekte schuften. Richtig arm dran sind die Remade, an denen sich ihre Richter kreativ ausgetobt haben. Dann werden aus den Verurteilten lebendige Skulpturen gemacht, ihre Körper zu perversen, bescheuert-grausamen ›Sinnbildern‹ der jeweiligen Verbrechen umgeformt.
»Die Moral von der Geschicht?« Na, einer tragischen Kindsmörderin werden halt die Arme ihrer toten Tochter wie Fühler auf die Stirn gepflanzt, oder einem Verräter die Zunge durch ein gefräßiges Meeresvieh ersetzt. Für Liebhaber von Grotesquerie-Revues ist das freilich für sich schon ‘ne feine Monsterparade, doch die Remade sind mehr als nur das: nämlich bitter-brilliante Phantastik über die finsteren Gepflogenheiten in allen Kulturen, wenn eben jene mit Deutungs- und Gestaltungshoheit, wie es ihnen richtig erscheint oder beliebt, Leben, Psyche und Physis der ihnen Ausgelieferten zurechtkneten. Die Utopien vom neuen Menschen (bzw. die Träume vom unverdorbenen Menschen) entpuppen sich in der Welt Bas-Lag als die Schokoladenseite der Untaten, die Menschen einander antun, oder die sich antun zu las-sen sie bereit sind. Doch es gibt auch Remade, die sich auflehnen, die in New Crobuzon untertauchen oder ins Umland fliehen, zu ›fReemade‹ werden, sozusagen Freigemodelte.
Der oben erwähnte Jack Gotteshand[10] wurde in Perdido Street Station als solch ein krimineller Volksheld vorgestellt und hatte dort einen Heldenauftritt[11]. Jack war ein Mann der Tat, der Miliziaspione und Hinterzimmerschreibtischtäter in bester Vigilantenart meuchelte oder bloßstellte, den Reichen Geld stahl und an Arme verteilte. Nach seinem Tod ist die Stelle des Volkshelden vakant, und in »Der Eiserne Rat« geht’s es zu einem Gutteil darum, wie dieser Posten eines hoffnungsspendenden Widerstandsmythos neu besetzt wird. Nachdem Judah und Ann-Hari zum ewigen Zug zurückkehren, verschärfen sich dortz in der Anamnese die Zustände. Nachschub und Lohnzahlungen stocken, die Stimmung lädt sich auf und es kommt zu einer Rebellion der Trosshuren, einiger nichtumgemodelter Arbeiter und der Remadesklaven gegen die Aufseher des TRT. Der ewige Zug macht sich frei von New Crobuzons Kontrolle, flieht westwärts in die Wildnis und wird für die Bewohner von Rohagi schnell zum sagenhaften Eisernen Rat. Als Barde für die Sache des Eisernen Rates wird Judah später wieder nach New Crobuzon zurückkehren und den dortigen Widerstandgruppen vom unerhört erfolgreichen Aufbegehren das sich in der fernen Fremde zutrug berichten. In dieser Zeit wird er Cutter kennen lernen, und sich dann in der zuspitzenden Krise des Krieges New Crobuzon gegen Tesh aufmachen, den Eisernen Rat zu suchen.
Ganz passend empfiehlt Kolja Mensing für Deutschlandradio Miéville als »Begleitlektüre für die globale Katerstimmung zu Beginn des 21. Jahrhunderts«[12]. Vor allem »Der Eiserne Rat« wendet sich trotz all seiner Vernarrtheit für genrespezifische Steckenpferde eher an eine Fantasy-, Horror- und SF-Leserschaft, die sich bei allem ›Eskapismus‹ gern und heftig mit der Echtweltwirklichkeit konfrontiert, und/oder auch beim geliebten Genre-kram avantgardistischen Anspruch mag. In zwei jüngeren Interviews hat Miéville sein literarisches ›Programm‹ umschrieben:
»Es gibt mehrere Werte — das avantgardistische Fein-gefühl, die realistische Schilderung von gesellschaftlichen Strukturen, ein reißerisches Garn zu spinnen — und es ist unklar, bis zu welchem Maß diese Werte in einem Text miteinander fruchtbar auskommen.«
[13]und:
»Mein Ziel wäre also, genau dieses reißerische Garn zu spinnen, das gesellschaftlich ernsthaft und stilistisch avantgardistisch ist. Meiner Meinung nach ist das doch der Heilige Gral.«
[14]Für mich eine Wonne, dass es Genreautoren gibt, die sich, obwohl sie ihre Leserschaft im Blick haben, dennoch trauen auf ästhetische Gralssuche zu gehen, und nicht ›nur‹ den Markt zu bedienen trachten.
•••
[01] Siehe
»Magira 2003«: Besprechungen von Werner Arend (S. 23) und Molosovsky (als Alexander Müller) (S. 91). •••
Zurück
[02] ) Übersetzte ich mir mit
›verdrehte, verrückte, seltsame, befremdende Fiktionen‹. (Nebenbei. Bemerkenswert, daß am ethymologischen Brunnen des Wortes
›weird‹ wiederum drei alte Zauberweiber rumhängen.) Um den Begriff New Weird gabs und gibts in
›der Szene‹ sowohl angeregte wie auch aufgeregte Diskurse. So ganz kann ich auch (noch) nicht nachvollziehen, wie der neue Subgenrebegriff aufkam, aber als einer der ersten die ihn gebrauchten, wird immer wieder M. John Harrisson genannt, von dem Freund China ja bekennender Fan ist. Von Harrisson hat Miéville sich das Ettikett New Weird geborgt und sich selbst und vielen anderen — von denen nicht alle darüber glücklich waren — ans Revers geheftet. Wichtig erscheint mir, daß mit ›New Weird‹ ein Begriff da ist, mit der sich die heutigen Strömungen brauchbar umschreiben lassen, die weniger an die ›klassische‹ (High Fantasy) Phantastik eines J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Lloyd Alexnder oder E. R. Eddison anknüpfen, als vielmehr auf Werken von Autoren wie Mervyn Peake, Stefan Grabinski, Bruno Schulz, den jungen H. G. Welles und den Papst des Old Weird H. P. Lovecraft aufbauen. — Die derzeit verlässlichste Auskunft zur ›New Weird‹-Entwicklung gibt Thomas P. Weber in
»Fischer Kompakt: Science Fiction« (Fischer Taschenbuch, November 2005), S. 81 ff. Dort heißt es z.B. knapp und einleuchtend über Miéville, daß er
»… die Möglichkeiten der SF und Fantasy {und des Horrors. – Molo}
zu nutzen {versucht}, um die in einer neoliberalen Welt verkümmerte soziale Phantasie wiederzuerwecken.« •••
Zurück
[03] Siehe
»Magira 2004«: Besprechung von Manfred Roth, S. 191. •••
Zurück
[05] Von Chet (April) bis Thatis (Juni) des Jahres ›Anno Urbis‹ 1779. •••
Zurück
[06] Von Rinden (Oktober) 1779 bis Tathis 1780. •••
Zurück
[07] Von Chet 1805 bis Lunary (Januar) 1806. •••
Zurück
[08] Bedeutet allgemein
›zur Sprache gebrachte Erinnerung‹; medizinisch
›Vorgeschichte‹; liturgisch der Teil einer Messe, in der man der Toten (und besonders der Märtyrer) gedenkt. •••
Zurück
[09] Erde, Fels, Leichen, Giftgas, Schwarzpulver, Schatten, um ein paar Beispiele zu geben. Auch spekuliert Judah, ob sich aus Hoffnung, Angst und Ähnlichem Golems schaffen lassen. •••
Zurück
[10] Jack Half-a-Prayer im Original. Der Spitzname bezieht sich auf Jacks rechten Unter-arm, der durch eine übergroße Gottesanbeterschere ersetzt wurde. •••
Zurück
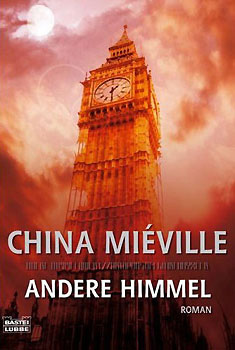
[11] »Ein versteckter Schlüssel?«, trau ich mal in einer Fußnote drauflos zu spekulieren, denn mit der Story
»Jack« reicht China Miéville in seinem Kurzgeschichtenband
»Looking For Jake« (»Andere Himmel«, Bastei 2007) ein Zuckerl über diesen legendären fReemade-Rebellen. Darin erzählt ein Mitarbeiter der Straffabriken nach Jacks Tod seine Meinung zu diesem fReemade im besonderen und den Remade im Allgemeinen. Die Kurzgeschichte
»Jack« liest sich wie eine grimmig-kritische Meditation über Heldentum und die Sehnsucht nach großen Gestalten und deren typischen
›Trieb‹, ihren wahren Gefühlen um scheinbar jeden Preis gestaltend Ausdruck zu verleihen, also Zeichen und Markierungen in der Welt zu hinterlassen. •••
Zurück
Unbekannte Gefilde
EDIT vom 14. Okt. 2007: Schöneres Cover-Img eingepflegt.
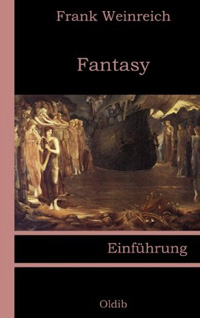 Eintrag No. 378 — Frank Weinreich hat mich schon beeindruckt, mit seinen umsichtigen Artikeln zu Tolkien. Klar, für mich als Tolkien-Skeptiker schreibt Frank zwar immer noch zu nachsichtig über JRR, aber dennoch gehört Frank zu den klügeren deutschen Tolkien-Exegeten und Fantasy-Erklärern.
Eintrag No. 378 — Frank Weinreich hat mich schon beeindruckt, mit seinen umsichtigen Artikeln zu Tolkien. Klar, für mich als Tolkien-Skeptiker schreibt Frank zwar immer noch zu nachsichtig über JRR, aber dennoch gehört Frank zu den klügeren deutschen Tolkien-Exegeten und Fantasy-Erklärern.
Da freut es mich, daß im neuesten (Juno-)Magazinteil der Phantastik-Couch eine zusammenfassende Vorschau auf sein neustes Buch geboten wird, in dem es um nichts weniger gehen wird, als eine »Einführung in die Fantasyliteratur«.
Oftmals fühle ich mich wie ein querulantischer Kobold, wenn ich meine literaturgeschichliche Maximalsicht auf »Fantasy« (ich rede halt lieber von »Phantastik«) verbreite und auf dieser meiner Sicht beharre;— und es taugt mir deshalb enorm, daß Frank eine ganz ähnlich unverschämte Weitwinkelobjektivsicht auf das Genre pflegt, wenn er z.B. schreibt (Hervorhebung von Molo):
Vielleicht wäre es am treffendsten, die Fantasy als nicht geglaubte Mythen zu bezeichnen. Das zeigt dann auch, dass die Geschichte der Fantasy nicht erst mit muskelbepackten Schwertschwingern wie Conan beginnt, sondern schon mit muskelbepackten Schwertschwingern wie Achilles. Nur dass Homers Geschichten über den Letzteren allgemein als Fanal für den intellektuellen Aufschwung des Abendlandes gehalten und als erster glänzender Höhepunkt der Literatur im speziellen und der Kreativität im allgemeinen interpretiert werden, während man Conan auch ganz gerne als Symbol für kulturellen Trash empört in die Höhe hält. Und auf hohem homerischen Niveau geht es ja weiter, wenn man schaut, welche namhaften Menschen Fantasy schrieben, auch wenn man es zu ihrer Zeit natürlich nicht so nannte: Dante, Chaucer, Shakespeare, Goethe und und und. Der Autor hält sich jedoch nur kurz bei der Geschichte der Vorläufer der eigentlichen Fantasy auf und legt den Schwerpunkt der Darstellung auf die moderne Fantasy, die im 19. Jahrhundert mit den Werken George MacDonalds und William Morris´ beginnt.
Schade nur, daß in der Vorschau das Trösten und Sinnmachen für meinen Geschmack zu einseitig betont. Nix gegen den Sinnmach-Aspekt der Phantastik, aber neben dem Trösten gibts halt noch viel anderes, was »Fantasy« kann. Nicht umsonst fransen die drei Hauptgenre der Phantastik — Fantasy, Horror, SF — an den Rändern aus und werden von entsprechenden Kreativen miteinander munter verflochten.
Fantasy/Phantastik übertreibt und fuhrwerkt mit Zauberdingen, Wunderorten, Monstern, Halbmenschen und vielerlei anderen Extotismen. Sie bedient also zuallererst unsere Neugier bzw. unseren Sinn für das Wundersame (Sense of Wonder), unser menschliches Verlangen danach, das Gesichtsfeld zu erweitern, Neues zu entdecken (und dieses Neue kontrolliert zu erschließen, zu beherrschen).
Die echte Welt ist zuallermeist eben banal, eintönig und langweilig, und die Gravitationskräfe des Daseins ziehen uns alle in Richtung Vergänglichkeit und Auflösung. Die Phantastik bietet nun mit ihrem als Eskapismus übel beschimpften Moment einer raumerschließenden Horizontserweiterung eine Milderung zu dieser alles niederziehenden Schwerkraft des Daseins an. Und ohne einem entsprechenden Talent zum Selberstiften solcher Fluchtbewegungen ist keine Kultur denkbar (siehe das Nietzsche-Zitat am Ende).
Was ich aber gerne betone ist, daß so wie die Fantasy Sinn zu stiften vermag, so kann sie auch alle sicher geglaubten Sinngerüste zum Wanken bringen; und so wie sie zu trösten vermag, kann Phantastik eben auch beunruhigen. Mit Namen wie George McDonals, William Morris und JRR Tolkien wird eine bestimmte Spielart der modernen Phantastik betontz, die ihre Stimme überwiegend als kritisch-romantische Gegenstimme zur ach so bösen Moderne erhob. Bin schon neugierig, ob (und wenn wie) Frank hier einer gegen die Übel der Moderne anwetternden Fantasy das Wort redet, oder nicht. — Aber so im Großen und Ganzen macht die Vorschau auf Frank Weinreichs Buch einen guten Eindruck bei mir.
So zum Beispiel, wenn er sich auf das Übernatürliche als Definitionsfundament beruft. Gespannt bin ich auf das kommende Buch, denn schon bei der Aufdröselung des für die Fantasy grundlegenden Übernatürlichen bekomme ich ein wenig Schwindelgefühle, wenn es heißt (Hervorhebung von Molo):
Meist wird das Übernatürliche in Form von drei charakteristischen, ebenfalls auf der inhaltlichen Ebene zu findenden Motiven in Szene gesetzt: durch das für die Geschichte bestimmend wirkende Vorhandensein von Heldinnen und Helden (die können auch mal negativ gezeichnet sein), durch eine imaginäre Welt als Haupthandlungsort (dies kann auch ein irrealer Teil der realen Welt sein, wie die Zauberschule Hogwarts) und durch die Ausübung von Magie (im Sinne von Praktiken, die den Verlauf von Ereignissen auf übernatürliche Weise beeinflussen) als für die Erzählung selbstverständliches Faktum.
Magengrummeln bereiten mir die Helden, bzw. daß pauschal alle Protags der Fantasy gleich als Held bezeichnet werden. (Andereseits kann man freilich alle Protagonisten aller Genre-Felder als Helden bezeichnen. Hat sich halt so eingeschliffen.) Aber wahrscheinlich bin ich da voreingenommen, weil ich nun mal den Begriff Held mit großer Vorsicht und Skepsis nehme. Helden sind die Figuren der großen Taten, sind die Burschen und Mädels, die der Welt ihre Meinung/Haltung aufprägen müssen. Helden sind zwielichtige/zweischneidige Figuren, was deutlich wird wenn man beobachtet, daß die eigenen Krieger, Beschützer, Eroberer und Trickser gefeiert & verehrt, die Helden der anderen aber als Monster, Unholde und Kriegsverbrecher gefürchtet & verachtet werden.
Weiter: gern les ich, daß Weinreich sich in seinem kommenden neuen Buch mit den literaturwissenschaftlichen Arbeiten von Helmut Pesch und Northrop Frye auseinandersetzten wird. Ersterer (Pesch) hat die bis heute ergiebigste deutschsprachige Arbeit zu Geschichte und Wesen der Fantasy (1982/2001, »Fantasy—Theorie und Geschichte«) geschrieben; zweiterer ist ein englischer Literaturwissenschaftler, der für die Güte seines Buches »Analyse der Literaturkritik« (1957, »Anatomy of Criticism«) hierzulande sträflich-beschämend unbekannt ist (Meine Meinung lautet ja, daß die Germanisten den Anglisten und Amerikanisten was Literaturbeschäftigung betrifft ca. 20 Jahre hinterherhinken. Allein wie die bereichernden Entwicklungen der Genre Studies und Cultural Studies hierzulande nicht in die Puschen kommen {¿dürfen?}, läßt mich wähnen, in einem kirchturmfixierten Dorf zwischen Runkelrüben und Kühen zu weilen). — Aber ich gräme mich, daß auch Weinreich den unsäglichen, zu nichts außer zur Abschreckung zu gebrauchenden Tzvetan Todorov aus der Mottenkiste verschwurbelter Siebzigerjahredenke vervorzerrt (1970, »Einführung in die fantastische Literatur«), in der Todorov einem die entweder/oder-Pistole auf die Brust setzt, und für die Phantastik nur einen ziemlich kleinen Raum übrig läßt, der von kläglich wenigen Genre-Texten eingenommen werden kann. Klassisches Beispiel einer Theorie, die am Gegenstand vorbeitüdelt und damit vielleicht als Denkschwulst beeindruckt, aber als Leitfaden und Werkzeug völlig versagt.
Gespannt bin ich auf Weinreichs Behandlung des innigen Zusammenhangs von Phantastik und Mythos. Immerhin kannten die alten Griechen schon zwei Begriffe für Wort: einerseits nannten sie die vernünftige Rede, das Be-sprechen Logos, das ›unnüchternde‹ Reden in Sagen- und Legendenformat aber nannten sie Mythos. Man sieht also: so neu ist das Alternativkultur-Thema des ›Wilden Denkens‹ (und Fabulierens) gar nicht. Und es ist, wie Nietzsche so trefflich sagte, ein ›umhüllender Wahn‹ der Kulturgemeinschaften bindet. Phantastik ist nicht zuletzt wegen seiner Auseinandersetzung mit diesen Wahn ein so wertvolles und wohl auch heikles Genre.
•••
Zuckerl:
Nietzsches Wort vom ›umhüllenden Wahn‹ findet sich in seinen »Unzeitgemäßen Betrachtungen«, 1974):
Aber selbst jedes Volk, ja jeder Mensch, der reif werden will, braucht einen solchen umhüllenden Wahn, eine solche schützende und umschleiernde Wolke; jetzt aber hasst man das Reifwerden überhaupt, weil man die Historie mehr als das Leben ehrt. Ja man triumphirt darüber, dass jetzt »die Wissenschaft anfange über das Leben zu herrschen«: möglich, dass man das erreicht; aber gewiss ist ein derartig beherrschtes Leben nicht viel werth, weil es viel weniger Leben ist und viel weniger Leben für die Zukunft verbürgt, als das ehemals nicht durch das Wissen, sondern durch Instincte und kräftige Wahnbilder beherrschte Leben.
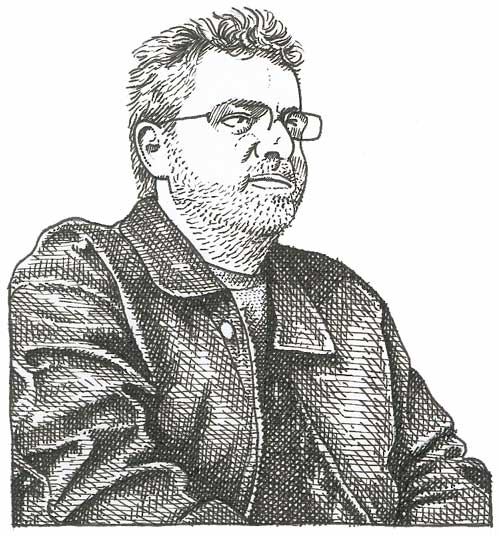
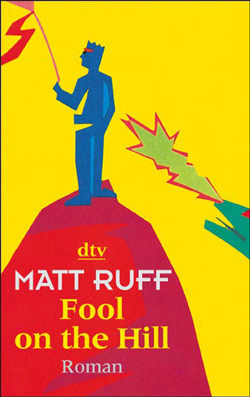
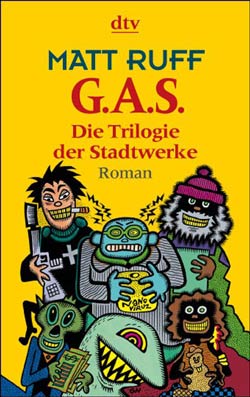




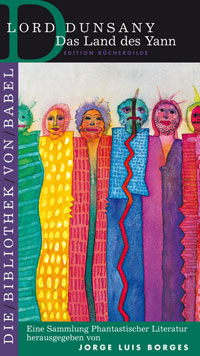



 inkl. »Hilfreicher Handreiche« über mythologische, historische und literarische Anspielungen.
inkl. »Hilfreicher Handreiche« über mythologische, historische und literarische Anspielungen.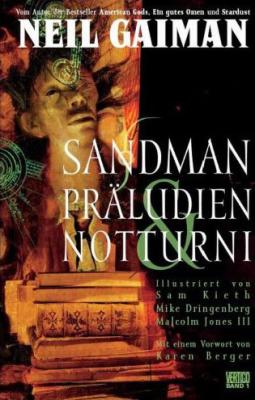
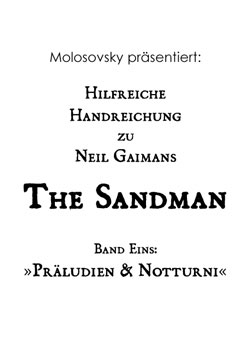
 Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei
Nun — endlich! — mit großer Verspätung, dafür aber auch mit erfeulicher Sorgfalt gestaltet erscheinen seit Anfang dieses Jahres die Sammelbände bei 

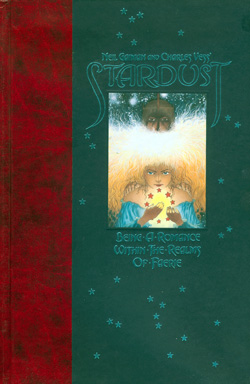 Da werden im anglo-amerikanischen liebevoll gestaltete Sachen vorgelegt, so richtig dolle altmodisch mit fetten Illustrationen und Vignetten, Federzeichnungen in schwarz-weiß, mal flüchtiger
Da werden im anglo-amerikanischen liebevoll gestaltete Sachen vorgelegt, so richtig dolle altmodisch mit fetten Illustrationen und Vignetten, Federzeichnungen in schwarz-weiß, mal flüchtiger  Wie wohl so manch anderer auch, habe ich noch einen Stapel Berichte, kopierte Zeitungsartikel und Sonderausgaben verschiedener Magazine über IX.XI angesammelt. Da kommt mir nun dieses Sachcomic, das auf dem gleichnamigen, sehr dicken Report der 9/11-Untersuchungskommission beruht, gerade recht.
Wie wohl so manch anderer auch, habe ich noch einen Stapel Berichte, kopierte Zeitungsartikel und Sonderausgaben verschiedener Magazine über IX.XI angesammelt. Da kommt mir nun dieses Sachcomic, das auf dem gleichnamigen, sehr dicken Report der 9/11-Untersuchungskommission beruht, gerade recht.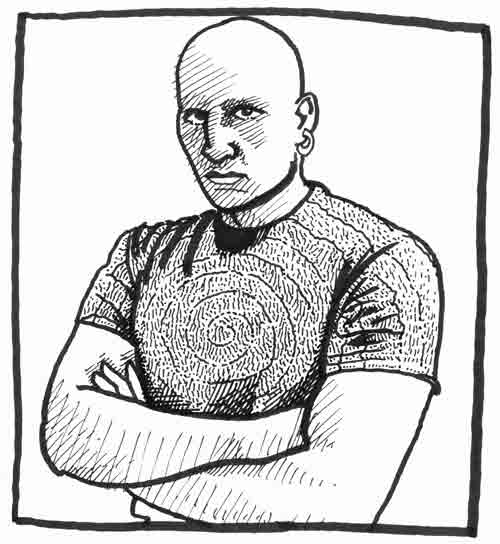
 »›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.
»›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.