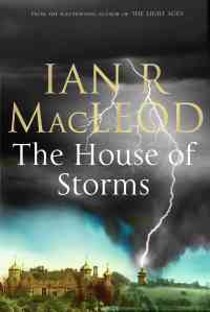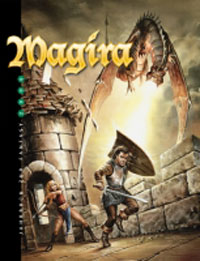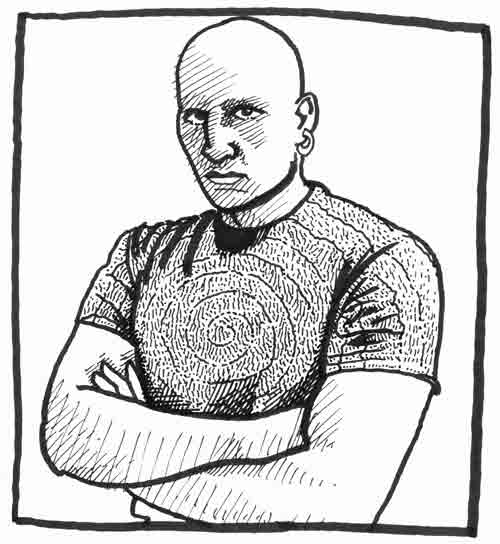Thomas Pynchon: »Gegen den Tag«, oder: Leinen los, oh Ihr Gefährten der Fährnisse!
•••
 Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.
Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.
Ganz anders der Riesenroman »Gegen den Tag«, der mich von der ersten bis zur letzten Seite derart heftig mitgenommen und für Pynchon eingenommen hat, dass ich in rascher Folge seine beiden ersten Romane »V.« (1961, dt. 1968) und »Die Versteigerung von No. 49« (1966, dt. 1973) las, und siehe: vor allem zweiterer ist alles andere als sperrig.[02]
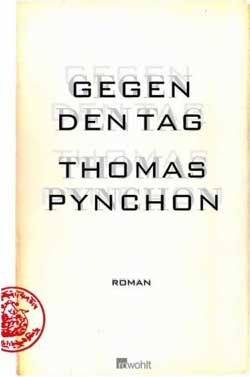 Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.
Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.
Auf welches Hauptthema man »Gegen den Tag« auch verkürzen will, man kann diesem Riesenschinken dabei nicht gerecht werden. Forsch drauf los behauptet, schlage ich vor, dass die große Themenlandschaft von »Gegen den Tag« aufgefaltet wird durch Fragen über die, und Zweifeln an der (Un-)Zielgerichtetheit der Geschichte der modernen Welt und ihrer Individuen. Dazu spannt das Buch einen Zeitbogen von der Großen Weltausstellung in Chicago 1893, bis knapp nach Ende des Ersten Weltkrieges. Eine ungeheure Milieu- und Umgebungs-Vielfalt wird aufgeboten um zu illustrieren, wie sich damals die Weltläufte beschleunigt und sich zerfasernd in jene unheilvollen Strudelbewegungen bezogen wurden, die zu den großen (größtenteils menschengemachten) Katastrophen des 20. Jahrhunderts führten. Den Reigen der Bösewichter führt dabei der vulgärkapitalistische Industriekapitän Scarsdale Vibe an, der seine gewissenlosen Handlanger unter anderem ausschickt, um unbequeme Bergarbeiter-Sozialisten zu meucheln. Von den gegen solche wie Vibe revoluzzenden Verkündern des Evangeliums des Sabotage-Dynamits bringt einer, Moss Gatling, den »Gegen den Tag« und gegen die Kontroll- und Unterwerfungsabsichten gerichteten Impuls des Widerstands mit folgenden Worten auf den Punkt:
Aber wenn ihr einen Punkt in eurem Leben erreicht, wo ihr begreift, wer wen bescheißt – vergib mir, Herr –, wer nimmt und wer nicht, dann seid ihr verpflichtet, euch zu entscheiden, mit wie viel ihr euch einverstanden erklärt. Wenn ihr nicht jeden Atemzug eines jeden Tages, ob im Wachen oder im Schlafen, an die Vernichtung jener wendet, welche die Unschuldigen so leichthin schlachten, wie sie einen Scheck unterschreiben, wie unschuldig wollt ihr euch dann nennen? Dieser Frage müsst ihr euch jeden Tag neu stellen und zwar in dieser Absolutheit.
[04]Egal, wie sehr man sich nun dafür ins Zeug legt, Pynchon zum Großmeister der engagierten, modernen Anspruchsliteratur zu stilisieren, man mindert den Status dieses Autor keineswegs, wenn man ihn ›nur‹ als Lieferanten ausufernder Abenteuerlichkeiten und Blödeleien nimmt (inklusive alberner und zotiger Lieder, die von den Figuren immer wieder angestimmt werden). Die für die E-Literaturmedien schreibenden Rezensenten drücken sich nicht selten davor, auf die ausgesprochen heftigen Phantastikstrahlung von »Gegen den Tag«hinzuweisen, doch hier, in einem Phantasten-Blog, ist dieser Aspekt des Buches natürlich besonders zu betonen.
Den deutlichsten roten Phantastikfaden liefern die an die ›scientific romances‹ von H. G. Wells und die ›voyages fantastique‹ von Jules Verne erinnernden Luftschiffabenteuer der ›Gefährten der Fährnisse‹[05] (deren Vornamen — Chick, Miles, Lindsay, Randolph und Darby — alle von Größen des Jazz entliehen sind; außerdem gehört noch der intelligente Hund Pugnax zur Crew). Da wird die Hohlwelt durchquert, oder sich so weit in astrale Höhen vorgewagt, bis man in Gegen- und Nebenwelten wieder runterkommt. Auch wühlt man sich in einem Land-U-Boot unter der asiatische Wüste hindurch, um in Städten, die schon vor langen Zeiten vom Sand verschluckt wurden anzudocken.
Geisterhafte Erscheinungen treten regelmäßig auf, mal in Gestalt einer jungen Frau (Yashmeen Halfcourt), die so grazil und anmutig ist, dass zuweilen das Licht durch sie hindurchscheint; mal als Vatergeist, der bevorzugterweise bei Eisenbahnfahrten oder im Traum einem seiner Söhne als anspornender Rachemahner erscheint; mal als grausamer österreichischer Offizier, der aufgrund seines Sadismus als Vampir gilt; ein andermal treibt ein gutbetuchter englischer Dandy seine nocturale Empfindsamkeit soweit, dass er vorzieht wie eine Fledermaus im Keller kopfüber schlafend zu verbringen. – Verschiedene nach der Weltherrschaft strebende Mächte strecken ihre Hand nach dem geheimnisvollen Islandspat aus, das die Eigenschaft besitzt, Dinge die man durch ihn sieht zu verdoppeln. Das Motiv der Verdoppelung wird weitergetrieben zur Bifuraktion, was einige Figuren bis hin zur Kunst bringen, zugleich an zwei Orten zu sein, zum Beispiel, wenn jemand bequem im Sessel liest, und sich zugleich in der Arktis befindet. — Auf Konferenzen beschäftigen sich Wissenschaftler seltsamer Disziplinen mit den Möglichkeiten der Zeitreise und den Geheimnissen des Aethers, oder trachten danach, die Turbulenzen und Vibrationen von Tornados in Sprache zu übersetzten, um im entsprechenden Code mit den schicksalsmächtigen Wirbelwinden kommunizieren zu können. — Ein indischer Yoga-Wissenschaftler, beherrscht die Kunst, durch komplizierte Verrenkungen (sprich: dimensionale Krümmungen des Raumes) sein körperliches Aussehen (bis hin zum Geschlecht) zu verändern, so wie unsereins mittels Fernbedienung den Sender wechselt. — Zeitreisende aus der Zukunft, und Flüchtende von den Massakern der kommenden Weltkriege und womöglich auch der ihnen folgenden Stellvertreterkriege des Kalten Krieges und des Krieges gegen den Terror schleichen durch die Welthintertüren. — Ein sprechender, gutmütiger Kugelblitz, begleitet kurz eine Familie. — Ein den Atlantik überquerendes Passagierschiff verwandelt sich gleitend in ein Schlachtschiff. — Mit einem raffinierten Lichtspielapperat kann man nicht nur aus einem beliebigen Photo die Vergangenheit wieder erscheinen lassen, sondern bei entsprechender Manipulation der analysierten Lichtkonserve lassen sich auch alternative Seitenpfade des Möglichkeitsgeflechts ersehen.
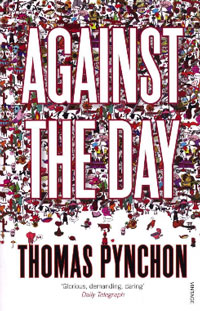 Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen:
Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen:
Noch eine Weile nach dem Ereignis liefen verrückt gewordene Raskolniki in den Wäldern umher, geißelten sich und gelegentliche Gaffer, die zu nahe kamen, und delirierten von Tschernobyl, dem zerstörten Stern namens Wermut aus der Offenbarung. Rentiere entdeckten ihre uralten Flugfähigkeiten wieder, die im Laufe der Jahrhunderte seit dem Eindringen von Menschen in den Norden verloren gegangen waren. Bei manchem regte die Begleitstrahlung die Epidermis insbesondere im Nasenbereich zu einem Leuchten am Rotende des Spektrums an. Stechmücken büßten ihre Vorliebe für Blut ein, eigneten sich stattdessen eine Vorliebe für Wodka an und wurden beobachtet, wie sie sich in großen Schwärmen in einheimischen Kneipen zusammenfanden. Uhren, auch Armbanduhren, gingen rückwärts. {…} Sibirische Wölfe kamen mitten im Gottesdienst in Kirchen, zitierten in fließendem Altslowanisch Stellen aus der Heiligen Schrift und gingen friedlich wieder hinaus. {…} Ganze Dörfer kamen zu dem Schluss, dass sie sich nicht dort befanden, wo sie sein müssten, worauf die Einwohner ohne große Vorausplanung schlicht zusammenpackten, was sie besaßen, zurückließen, was sie nicht tragen konnten, und sich gemeinsam in den Busch aufmachten, wo sie kurz darauf Dörfer errichteten, die niemand sonst sehen konnte. Jedenfalls nicht sehr deutlich.
[06]Ebenso reichlich geboten wird prickelnde Situationskomik (wenn ein kauziger Wild West-Fuzzi sich auf eine sinnliche Eskapade mit einem Schoßhündchen einlässt), haarsträubende Äktschn (wenn ein Abenteurer in einer Lebensmittelfabrik vom schrecklichen Tod durch Mayonnaise bedroht wird), bezaubernde Liebes- und Erotikabenteuer, Einblicke in Elends- und Luxuswelten mit all ihren durch von ideologischen, politischen, spirituellen und transzendenten Verblendungen befeuerten Intrigen. Zwar mag »Gegen den Tag« unverschämt vollgestopft mit Details und ausufernd bei seiner Weltenwanderei sein, aber folgt man den Rat von Pynchon-Veteranen, und schert sich (beim ersten Mal) einfach nicht um Fragen aufwerfende Stolperstellen, sondern liest mit gebotener Sturheit weiter, dann kann man wahrlich etwas erleben.
SERVICE:
Ausführliches Inhaltsverzeichnis zu »Against the Day«
•••••
Thomas Pynchon: »Against the Day«, (2006); 70 Kapitel in 5 Teilen auf 1220 Seiten; Vintage Taschenbuch (Yuko Kondo-Cover Edition) , 2007; ISBN: 978-0-099-51233-2.
Thomas Pynchon: »Gegen den Tag«; Deutsch von Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren; 1596 Seiten. Gebundene Ausgabe: Rowohlt Verlag 2008; ISBN: 978-3-498-05306-2.
Taschenbuch: Rowohlt Verlag, 2010; ISBN: 978-3-499-24609-8:
•••••
ANMERKUNGEN:
[01] Auch wenn dieser Passage in »Trainspotting« von Irving Welsh und seinem Verfilmer Danny Boyle Tribut gezollt wurde, ich fands sie nur grenzenlos unappetitlich. •••
Zurück
[02] Der Griff zu »Die Versteigerung von No. 49«, dem kürzesten Roman von Pynchon, sei als Einsteig für Neugierige angeraten, die bezweifeln die Ausdauer/Konzentration für seine dicken Romane aufbringen zu können. Am erstaunlichsten ist, wie dieser von Verschwörungsunsicherheiten gesättigte Roman trotz, oder gerade wegen seiner Kürze durch Ideenfülle und Quadruppel-Bödigkeit brilliert.
Auch »V.« ist reizvoll facettenreich, wenn auch schon formal schwerer, da sich hier verschiedenste Handlungsfäden und Episoden lange Zeit nur auf äußerst vage Art aufeinander beziehen. Doch auch bei V. macht die kunterbunte, humorige, manchmal sogar deftige Mischung aus Fabublödelei und hochtrabender Spekulation Laune. ••• Zurück
[03] Ein modern-einheimisches Anschauungsexempel bietet das thüringische Panorama Museum nahe Bad Frankenhausen, in dem ein zylindrisches Ölgemälde von Werner Tübke, im Format 14 x 112 Meter, mit über 3000 dargestellten Figuren, die Bauernkriege von 1524 in einer prächtigen Rundschaukunde präsentiert. ••• Zurück
[04] »Gegen den Tag«, Seite 133/134. ••• Zurück
[05] Im Original tragen sie den schmissigen Namen ›Chums of Chance‹, was auch als ›Kumpel des Glücks‹ übersetzbar wäre. ••• Zurück
[06] »Gegen den Tag«, Seite 1157 f. ••• Zurück
Cherie Priest: »Boneshaker«, oder: Alternativwelt-Seattle 1880 mit Luftschiffen & Zombies
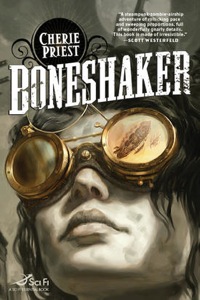 Eintrag No. 601 — Okey, ich geb’s ja zu, dass ich derzeit eine Steampunk-Phase durchmache. Aber ich habe schon länger eine Schwäche für in Alternativ- oder Zweitschöpfungs-Welten angesiedelte Phantastik, welche entsprechend als Inspiration auf das 19. Jahrhundert (plus/minus einiger Generationen früher oder später) zurückgreift. Mir sind Wells und Verne als Väter von Fantasy-Bastards allemal lieber als die üblichen ollen verdächtigen Mittelalter- und Archaik-Schönträumer a la Tolkien. (Eigentlich müsste man mal anfangen ›Tolkien‹ statt Tolkien zu schreiben, besser noch ›McTolkien‹, denn sein Name wird in Phantastik-Argumentationen eh nur als Platzhalter verwendet … auch von mir freilich).
Eintrag No. 601 — Okey, ich geb’s ja zu, dass ich derzeit eine Steampunk-Phase durchmache. Aber ich habe schon länger eine Schwäche für in Alternativ- oder Zweitschöpfungs-Welten angesiedelte Phantastik, welche entsprechend als Inspiration auf das 19. Jahrhundert (plus/minus einiger Generationen früher oder später) zurückgreift. Mir sind Wells und Verne als Väter von Fantasy-Bastards allemal lieber als die üblichen ollen verdächtigen Mittelalter- und Archaik-Schönträumer a la Tolkien. (Eigentlich müsste man mal anfangen ›Tolkien‹ statt Tolkien zu schreiben, besser noch ›McTolkien‹, denn sein Name wird in Phantastik-Argumentationen eh nur als Platzhalter verwendet … auch von mir freilich).
Auf »Boneshaker« von Cherie Priest wurde ich durch Empfehlungen des deutschen Steampunk-Blogs »Clockworker«, Hinweisen von Scott Westerfield und Jeff Vandermeer aufmerksam. Das Buch ist noch nicht auf Deutsch erschienen, die Übersetzungen liefere ich aus dem Stegreif. (Schon mal zum Seufzen, dass die beste Entsprechung für das knappe englische ›Boneshaker‹ das umständlich klingendere aber dennoch schöne ›Mark- und Beinerschütterer‹ ist.)
Zum Glück für den Roman hat mich beim Anlesen im Laden bereits der eröffnende 6-seitige Auszug des in Arbeit befindlichen fiktiven Sachbuchs »Unwahrscheinliche Ereignisse aus der Geschichte des Westens« eines gewissen Hale Quarter aus dem Jahre 1880 überzeugt. In »Kapitel 7: Der seltsame Zustand des ummauerten Seattles« wird prall das Setting vorgestellt: Goldrausch an der Westküste: Entdeckung einer großen Goldader unter Permafrosteis. Seattle ist noch nicht Teil der Vereinigte Staaten. Eine russische Interessensgruppe lobt einen fetten Rubelbetrag für eine Machine aus, die das Gold schürfen kann. Ein Erfinder names Leviticus Blue baut ein Riesenbohrerfahrzeug, verursacht damit 1863 bei einem Testlauf ein ansehnliches Desaster, mit dem das Geschäftsviertel von Seattle lahmgelegt wird. Aus den in den Untergrund gebohrten Tunneln wabert ein schweres Pestgas (engl. ›Blight‹) an die Oberfläche, das massenweise die Leute krepierten läßt und sie zu willenlosen frischfleischgierigen Untoten, vulgo, Zombies macht. Die Überlebenden bauen geschwind eine 61 Meter hohe Mauer um das verseuchte Gebiet und fünfzehn Jahre später setzt die eigentliche Handlung ein.
Fast hätte ich dann bei den ersten vier Kapiteln das Handtuch geschmissen, denn Priest meidet raffende Dramaturgie und läßt sich nicht hudeln, um die Heldin Briar Wilkes und ihren Sohn Zeke vorzustellen. Da wird Arbeitsklamottenausziehen, Essenmachen, jeder Wechsel von einem Zimmer ins andere, fast jede Wendung eines Dialoges mit entsprechender Mimikreaktion und Mimikdeutung beschrieben. — Briar schuftet in einer Wasserfilterungsfabrik im Siedlungsgürtel um das verseuchte Seattle. Als Witwe des verschollenen wahnsinnigen Wissenschaftlers Blue hat sie mit dem Groll der Leute zu ringen. Allerdings war ihr Vater ein legendärer Sherriff, der bei der Blight-Katastrophe sein Leben ließ um Gefängnisinsassen vor dem Tod zu retten. Immerhin sind also einige Leut der zwielichtigen Gesellschaftsschicht ihr wohlgesonnen. Ihr fünfzehnjähriger Sohn Zekes macht die Pubertätsphase durch, nicht auf Authoritäten und Anweisungen hören zu wollen, und bricht gegen den Rat seiner Mutter auf, mehr über seinen Vater zu erfahren, mit dem Ziel in dem ummauerten Seattle Beweise zu finden, um Leveticus Blues schlechten Ruf zu tilgen.
Der Roman steigt dann richtig in die Eisen, kaum dass die Handlung sich ins von Zombiehorden (die hier ›rotters‹, also ›Verwesende‹ genannt werden) geplagten (Ex-)Seattle verlagert. Im Prinzip eine Variation des »Die Klapperschlange«-Motivs. Gesperrtes, mordsgefährliches Gebiet mit lauter hartgesottenen Durchgeknallten; wichtiges Quest-Ziel ist dort zu finden und dann heißt es wieder heil rauszukommen. — Da erscheint mir auch die Ausführlichkeit von Priests Prosa sinnvoll, wenn das Fluchttunnel- und Rettungsleitern-, AntiZombiebarrieren-, Luftschleusen- und Belüftungssystem der Überlebenszonen geschildert wird (übrigens sehr reizvoll wie sehr diese der tödlichen Blight-Gasumwelt abgetrotzten ÜberLebebsräume einer Raumstation gleichen. Buchstäblich die gleiche spannende Athmosphäre wie in Weltraum-Sagas, wo oftmals die Gefahr der lebensunmöglichen Weite des Alls beschworen wird.)
Zeke findet mit einem Tag Vorsprung durch die ehemaligen Kanalisiationstunnel unter der Mauer hindurch seinen Weg in die Stadt. Briar folgt ihrem Sohn, doch muss sie wegen eines die Tunnel zerstörenden Erdbebens mit Hilfe von Luftschiffschmugglern einen Weg über die Mauer finden. — Kein Zweifel: Neben den Zombies ist die waschechte Steampunk-Athmo der Luftschiffe eine der Hauptattraktionen dieses Phantastikweltenbaus. Und so darf der geneigte Genreleser sich auf kernige Männer, exotische Crewmitglieder mit entsprechenden Piratengebahren, Luftkämpfe und Absturztumult freuen. Zu den Besonderheiten des Blights gehört, dass sich aus diesem Unglücksgas eine opiumartige Droge herstellen läßt (die zum Beispiel bei den Soldaten des länger als in unserer Echtwelt andauernden amerikanischen Bürgerkrieges immer größerer Beliebtheit erfreut). Die Luftpiraten machen ein gutes Geschäft als Zwischenhändler dieses Stoffes, und lassen sich deshalb auf den eigentlichen Herrscher des ehemaligen Seattles ein, den geheimisvollen und gefährlichen Dr. Minnericht.
Cherie Priest weiß wirklich überwiegend mit einer gut arrangierten Reihe hervorragend inszenierter Kapitel zu unterhalten. Leider nervte sie mich aber manchmal mit einer Dramaturgie, in der durch den Wechsel der beiden Hauptfiguren, Briar und Zekes, Informationen doppelt und dreifach ausgebreitet werden, und Zufallsbegegenungen und -Ereignisse mir etwas zu oft aus der Klemme halfen oder diese erst bereiteten. Aber als schnell wegzublätternde Zwischendurch- und Unterwegslektüre fand ich »Boneshaker« unterm Strich durchaus gut.
»Boneshaker« ist der erste Roman aus einer Reihe für sich stehender Erzählungen aus der Alternivwelt des »Uhrwerk-Jahrhundert«. Zwar habe ich das Gefühl, dass ich ich, ähnlich wie bei Gordon Dahlquist, schon durch ein Buch gesättigt bin, aber wenn mich die kommenden Romane von Preist beim Anlesen ködern können (Dahlquists Fortsetzung konnte das nicht), greif ich gerne wieder zu.
P. S.: Vor kurzen in die Sparte ›Kunst‹ meiner Linkliste aufgenommen wurde die Website von »Boneshaker«-Coverkünstler Jon Foster.
••••
Scott Westerfeld: »Leviathan«, oder: Dengler gegen Darwinisten im Ersten Weltkrieg
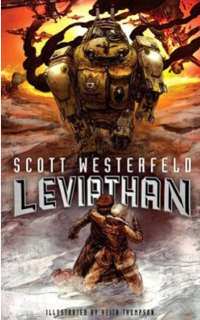 Eintrag No. 592 — Gerne posaune ich laut in die Welt, dass ich Serien in Buch- und Comicform ›eigentlich‹ meide wie die Pest. Das ist aber so nicht ganz richtig, denn ab und zu greife ich doch zum ersten Band eines Mehrteilers und lasse mich anfixen den Folgebänden entgegenzufibbern. Es stimmt aber, dass ich es hasse, mich auf aktuelle Fortsetzungswerke einzulassen, denn mir ist das Warten und das Hegen von Lesertreue für eine lange Geschichte zuwider. So sitze ich beispielsweise herum und harre auf Band 3 von Scott Lynchs »Gentlemen Bastard«-Reihe und mühe mich ab, mit stoischer Geduld das Erscheinen der nächsten Sammelbände von Brian Woods »DMZ« und »Northlanders« oder Urasawas »20th Century Boys« abzuwarten.
Eintrag No. 592 — Gerne posaune ich laut in die Welt, dass ich Serien in Buch- und Comicform ›eigentlich‹ meide wie die Pest. Das ist aber so nicht ganz richtig, denn ab und zu greife ich doch zum ersten Band eines Mehrteilers und lasse mich anfixen den Folgebänden entgegenzufibbern. Es stimmt aber, dass ich es hasse, mich auf aktuelle Fortsetzungswerke einzulassen, denn mir ist das Warten und das Hegen von Lesertreue für eine lange Geschichte zuwider. So sitze ich beispielsweise herum und harre auf Band 3 von Scott Lynchs »Gentlemen Bastard«-Reihe und mühe mich ab, mit stoischer Geduld das Erscheinen der nächsten Sammelbände von Brian Woods »DMZ« und »Northlanders« oder Urasawas »20th Century Boys« abzuwarten.
Nun also, Anfang Oktober hat mich ein <a href="www.youtube.com" target?"_blank" title="Zum Buchtrailer bei »youtube«.">Buch-Trailer verleitet, zum frisch auf Englisch erschienen ersten Band von Scott Westerfelds »Leviathan« zu greifen und entsprechend habe ich jetzt ein (bzw. zwei) Jahre blöde Warterei vor mir, bis ich Teil 2 (bzw. 3) verschlingen kann. — Der <a href="www.youtube.com" target?"_blank" title="Zum Buchtrailer bei »youtube«.">Trailer ist Dank der sanft animierten Illustrationen von Meister Keith Thompson verführerisch brilliant, so brilliant sogar, dass ich hier eine schnelle Übersetzung anbiete:
Wir schreiben das Jahr 1914.
Soeben ist Erzherzog Franz-Ferdinand das Opfer eines Attentats geworden und Europa befindet sich kurz vor einem Krieg. Doch legt eure Geschichtsbücher zur Seite, denn dies ist nicht der Krieg wie ihr ihn kennt.
Etwas anderes steht auf dem Spiel: Wer wird gewinnen? Die ›Dengler‹ (Clanker), die auf Maschinen vertrauen, oder die ›Darwinisten‹, die lebende Kreaturen zu Werkzeugen und Waffen züchten, zu Krampfkraken, lebenden Luftschiffen und allen möglichen anderen gefährlichen Bestien.
Im Zentrum der Ereignisse findet sich Alek wieder, der Sohn des Erzherzogs. Er flieht vor den Mördern seines Vaters. Durch Zufall trifft er mit Deryn Sharp zusammen, einem Mädchen das sich als Junge ausgibt, um in der Royal Airforce Dienst zu leisten. Er ist ein ›Dengler‹, sie eine ›Darwinistin‹. Er ist untergetaucht, sie verbirgt ein großes Geheimnis.
Zu Beginn des Abenteuers verschärft sich die Lage und der Einsatz erhöht sich. Die Frage lautet: ölst du deine Kriegsmaschinen, oder fütterst du sie?
Kurz: Steampunk-Phantastik satt, noch dazu als kurzweilig geschriebenes Abenteuer für Leser ab 10 Jahren aufwärts. Wobei mich überrascht hat, was Westerfeld und sein Verlag Zehnjährigen zutraut. Immerhin wird im Laufe des Buches ganz nebenbei die Evolutionstheorie und die Komplexität von Ökosystemen erklärt
Im Rhythmus von je zwei Kapiteln folgt das Buch mal Alek, mal Deryn (die sich als Junge Dylan nennt). Das Buch ist angenehm ballastfrei von langatmigen Schlenkern. Einen guten Eindruck vom Stil vermittelt die (englische) Leseprobe, vorgetragen von Alan ›Nightcrawler‹ Cummings. Gut die Hälfte besteht aus aktionsgeladenen Flucht- und Kampfszenen. Alek und seine kleine Crew versuchen von Balkan aus die neutrale Schweiz in einem 35 Tonnen schweren Wanderpanzer zu erreichen. Deryn ist, im Zuge einer Geheimmission, mit dem titelgebenden Luftwalfisch ›Leviathan‹ als Kabinenjunge von London unterwegs ins Osamnische Reich. Der Weltenbau ist glänzend gelungen. Fast schon wie selbstständige Charaktere erscheinen für mich als Leser Aleks Stormwalker und das majestätische ›Leviathan‹-Schiff.
Nicht zuletzt begeistern mich die vielen (meist) ganzseitigen Beistiftillustrationen und Vignetten von Keith Thompson (der auch für das »Arcane Codex«-Rollenspiel oder das Video-Spiel »Borderlands« erstaunliche Design-Arbeiten geleistet hat). Die auch im Buchtrailer verwendete ›monströse‹ Europakarte ziert derzeit als Desktopbild mein iBook. — Wirklich zu dumm, dass ich bis Oktober 2010 warten muss, um im zweiten Band »Behemoth« zu erfahren, wie die Reise weitergeht.
•••••
Gordon Dahlquist: »Die Glasbücher der Traumfresser«, oder: Drei Aussenseiter gegen okkultistische Weltverschwörer
 Eintrag No. 420 — Der bisher als Dramatiker und Filmemacher produktive New Yorker Gordon Dahlquist konnte mit »Die Glasbücher der Traumfresser« (»The Glass Books of the Dreameaters«) letztes Jahr einen veritablen Überraschungshit für sich verbuchen. Kaum veröffentlicht wurde dieser Roman zu einem begeisterten Tipp bei Freunden kurzweiliger und eleganter Alternativwelt-Romantik und Krimi-Phantastik und fluggs hatte Dahlquist einen lukrativen Fortsetzungs- und Verfilmungsvertrag in der Tasche.
Eintrag No. 420 — Der bisher als Dramatiker und Filmemacher produktive New Yorker Gordon Dahlquist konnte mit »Die Glasbücher der Traumfresser« (»The Glass Books of the Dreameaters«) letztes Jahr einen veritablen Überraschungshit für sich verbuchen. Kaum veröffentlicht wurde dieser Roman zu einem begeisterten Tipp bei Freunden kurzweiliger und eleganter Alternativwelt-Romantik und Krimi-Phantastik und fluggs hatte Dahlquist einen lukrativen Fortsetzungs- und Verfilmungsvertrag in der Tasche.
Kein Wunder, denk ich mir da, haben doch Autoren der Phantastikgenre-Gefilde in den letzten Jahren wieder vermehrt jüngere Zeitalter als die üblichen mythischen Vorzeiten oder aufgehübschten Mittelalterversionen als Material für wundersame, magiegetränkte Geschichten entdeckt.
So orientiert sich Dahlquist gekonnt an der Sprache, dem dramaturgischen Fluß und der Sensibilität von Klassikern des Kriminal-, Mystery- und Alternativweltfeldes. — Die schnelle Ettikettierung geht in etwa so: »Die Glasbücher…« ist eine hinreissend-elegante Räuberpistole, mit viel spannendem Geschleiche, Gekämpfe, Doppel- und Mehrfach-Intrigieren und einem aufreizenden Anteil Samt und Seide. Wer eine Schwäche für Jules Verne, H.G. Wells, Arthur Conan Doyle und Anthony Hope (»Gefangene von Zenda«) hegt, wird (so trau ich mich fast zu 100% garantieren) sich mit Wonne an diesem abwechslungsreichen Roman laben. Was magisch-historische KriminAlternativwelten angeht, erinnert mich das Buch zudem an den großartigen Randell Garrett und seine Die Lord Darcy-Geschichten; und es freut mich, in diesem Zusammenhang auch passenderweise auf das im Frühjahr 2008 bei Feder & Schwert erscheinende und im magischen München um 1860 angesiedelten Elfen-, Vampire-, Dämonen-Abenteuer »Das Obsidianherz« der von mir verehrten Ju Honisch empfehlend hinweisen zu können.
Zum Aufbau: Der klingt komplizierter, als er sich lesen läßt. Jedes der zehn Kapitel widmet sich mit auktorialer Erzählperspektive abwechselnd mal der Heldin, Miss Temple, mal einem der beiden Helden ›Cardinal Chag‹ und Dr. Svenson. Dabei kommt es immer wieder zu szenischen Überlappungen bzw. zeitlichen Sprüngen der sich über etwa zweieinhalb Tage erstreckenden Handlung. Dieser wunderbar altmodische Kunstgriff sorgt schon für fingernägelgefährdende Suspense. — Den verschleiernden Alternativweltcharakter des Weltenbaus bemerkt man meistens kaum, außer, man sucht z.B. den Namen der Metropole in der neben einigen ländlichen Adelssitzen die Geschichte angesiedelt ist. Die Stadt bleibt namenlos, aber der Autor gab in Interviews preis, dass die erfundene Metropole ein Amalgam aus dem London, Paris und Brüssel der fin de siècle-Epoche ist.
Zum Spaß: Am bezaubernsten fand ich den eleganten Stil des Romans, wobei ich nicht sagen kann, wie gut oder schlecht der plauderhafte Tonfall in der deutschen Version getroffen wurde. Wie es sich für die von ständehierarchischer Formalität geprägte Welt der vorletzten Jahrhundertwende gehört, gibt es für alles tradierte oder stillschweigende Anstandsregeln des Auftretens und Umgangs. Da kommt es schon mal vor, dass die Bösen den mit dem Rücken zur Wand stehenden Helden großmütig ‘nen Drink anbieten.
Das Abenteuer beginnt mit Miss Temple, einer jungen Dame vom fertigen Geld, Tochter eines karibischen Plantagenbetreibers, die zusammen mit Dienstmädchen und Anstandstante im komfortablen Hotel Boniface residiert, auf der Suche nach einem passenden Gemahl. Den dachte Miss Tempel mit Roger Bascombe, einem aufstrebenden Beamten des Außenministeriums, geangelt zu haben, doch auf einmal, noch dazu nur in Form eines vagen Briefes, bricht Roger jeglichen Kontakt ab. Um herauszufinden warum, macht sich Miss Tempel auf, Roger nachzuspionieren. Lehnt Roger sie einfach nur ab, weil er doch lieber allein leben möchte? Oder will sich Roger lieber auf seine Ministeriumskarriere konzentrieren und eine Frau wäre da für ihn nur hinderlicher Ballast? Oder hat Roger sich in eine andere Frau verknallt? Je nachdem, aus welchem Grund Roger sich von ihr getrennt hat, stünden Miss Temple nämlich andere Rollen im Gesellschaftsringelei der Salons, Teeparties und anderer öffentlichen Anlässe besser zu Gesicht. — Bei ihrer Hobbydetektivmission mischt sich Miss Tempel unter die im Zug anreisenden Gäste eines geheimen Maskenballs, wird in den Räumen eines großen Adelslandsitzes Zeuge einer beängstigenden Menschendressur-Vorführung, überrascht mehrere Damen beim erotischen Techtelmechtel mit einem Herren, stolpert über die Leiche eines Offiziers, und ehe das erste Kapitel vorbei ist und Miss Tempel in ihr Hotel zurückgekehrt ist, hat sie sich bereits mit den mörderischen Handlangern eines Verschwörunggeflechtes herumzuschlagen.
Die beiden männlichen Helden werden ebenfalls zuerst durch Neugierde und Mißtrauen in den Strudel der Vesrchwörungsmachenschaften gezogen. Im zweiten Kapitel folgt das Buch ›Cardinal Chang‹, tödlicher Meister des Rasiermesserkampfes, der seine durch Narben fernöstlich anmutenden Augen hinter einer runden Sonnenbrille verbirgt und einen roten Ledermantel sowie (tada!) einen Stockdegen trägt (daher der Spitz- und Deckname dieses aus der Arbeiterschicht stammenden freiberuflichen Auftragskillers- und Agenten, der sein Gemüt mit Lyriklektüre beruhigt). Irgendwer hat einen Offizier den Chang meucheln sollte bereits gekillt, und der Ordnung halber will Chang herausfinden wer. Chang klappert unterschiedlich gediegene Bordelle nach Infos ab, erfährt dabei, dass ihm selbst mehrere Parteien bereits auf der Spur sind, und platzt schließlich in den unterirdischen Forschungsräumlichkeiten des (fiktiven) Royal Institute of Science and Exploration mitten hinein in ein bizarres Experiment und das erste von vielen Handgemenge des Romans.
Als dritter im Bunde gerät Dr. Abelard Svenson, der Leibarzt des Macklenburgischen Prinzen, in das Garviationsfeld der finsteren Intrigen der geheimnisvollen Traumfresser-Cabale. Der Prinz, ein allen Genüßen zugewandter charakterschwacher Hallodri, hat sich eigentlich in das Alternativweltengland begeben, um die Tochter eines einflußreichen Lords zu heiraten. Doch der Prinz absentiert sich, bzw. wurde womöglich entführt, und auf der Suche nach ihm merkt der kettenrauchende Dr. Svenson bald, dass etwas faul ist im Staatsgefühe von Macklenburg.
 Zum Gehalt: Die zentrale phantastische Besonderheit des Romans ist der mirakulöse Rohstoff Indigo-Lehm, mit dessen Hilfe sich magische Glasbücher und -Karten schaffen lassen. In diesen Glasartefakten können Erinnerungen aufgezeichnet und wieder konsumiert werden (ganz ähnlich wie die Bewußtseins-Technik in SF-Filmen wie »Strange Days« und »Projekt Brainstorm«). Doch zum erweiteren Fundus der Indigo-Lehmalchemie gehören Wundheil- und Unsterblichkeits-Elexire, Mittel und Verfahren, um Frauen in willige Sexmarionetten zu verwandeln, oder um Menschen mittels gesprochener Programmcodes für geheime Missionen abzurichten. — Gewitzt finde ich dabei, dass Dahlquists Roman selbst in indigoblauer Aufmachung daherkommt, sich also augenzwinkend als Eintauch-Spaß und Miterleb-Achterbahnfahrt präsentiert (wenn auch nicht aus Glas). Ganz passend lautet ein zwiespältiger Cover-Spruch der englischen Ausgabe:
Zum Gehalt: Die zentrale phantastische Besonderheit des Romans ist der mirakulöse Rohstoff Indigo-Lehm, mit dessen Hilfe sich magische Glasbücher und -Karten schaffen lassen. In diesen Glasartefakten können Erinnerungen aufgezeichnet und wieder konsumiert werden (ganz ähnlich wie die Bewußtseins-Technik in SF-Filmen wie »Strange Days« und »Projekt Brainstorm«). Doch zum erweiteren Fundus der Indigo-Lehmalchemie gehören Wundheil- und Unsterblichkeits-Elexire, Mittel und Verfahren, um Frauen in willige Sexmarionetten zu verwandeln, oder um Menschen mittels gesprochener Programmcodes für geheime Missionen abzurichten. — Gewitzt finde ich dabei, dass Dahlquists Roman selbst in indigoblauer Aufmachung daherkommt, sich also augenzwinkend als Eintauch-Spaß und Miterleb-Achterbahnfahrt präsentiert (wenn auch nicht aus Glas). Ganz passend lautet ein zwiespältiger Cover-Spruch der englischen Ausgabe:
»Reading of an adventure is a much more respectable pursuit than having one.«
Oder in Moloübersetung:
»Es ist ein weitaus schicklicheres Unterfangen ein Abenteuer zu lesen, als selbst eines zu erleben.«
Ausser natürlich, man vereitelt, indem man ein Abenteuer besteht, die üblen Pläne von obscuranten Verschwörercliquen.
Ein Molochronik-Eintrag ohne Gemoser? Mitnichten, aber ich will ganz klein krtiteln. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lesern bin ich so gar nicht hingerissen vom deutschen Format. Die Idee, die zehn Kapitel gesondert zu binden und in einem Schmuckschuber anzubieten ist im Grunde ja eine famose Sache. Da gibts zehn plus eine Umschlagsfläche für edelstes Typo- und Retro-Design. Leider aber ist das Format meiner Ansicht nach zu klobig-groß geraten und auch der Preis wurde durch diese Extrawurst unnötig in die Höhe getrieben. Ich hoffe, mensch wird nicht zu lange warten müssen, bis es eine kostengünstigere einbändige Taschenbuchausgabe bei uns geben wird.
•••
»The Glass Books of the Dream Eaters«(2006); Penguin Paperback; 760 Seiten; ca. 10 €; ISBN: 978-0141-03465-2.
»Die Glasbücher der Traumfresseer«; Victorian Edition, Blanvalet 2007; Aus dem Amerikanischen von Bernhard Kempen; 896 Seiten; € 24,95; ISBN: 978-3-7645-0278-2.
•••
REZILINK-RUNDSCHAU
Für »SpiegelOnline« hat Mark Pitzke den Autor in einem New Yorker Kaffeehaus getroffen.
In der »Die Welt« stellt der Titel von Elmar Krekelers Artikel fest: »Dahlquist Orgien sind wilder als Kubriks«. Krekelers Bericht seines Besuches bei Dahlquist in New Yorks Stadtteil Hells Kitchen ist — find ich — bessser als der SpOn-Beitrag. Elmar bezeichnet das Buch völlig korrekt als Groschenheft für die gehobenen Stände. Unter der Teilüberschrift »Die Bahnbrechende Computerrevolution« zieht Dahlquist dort selbst eine Verbindung zwischen der Glasbuch- und Gläsener-Bürger-Metapher.
Peter Henning hat den Roman unter der Überschrift »Ballett der bösen Buben« in der »Die Zeit« besprochen und gibt ebenfalls Portraitbröckchen zum Autor zum Besten. Lustig fand ich die Info, dass…
…indes in diesem Buch nahezu unentwegt {gefochten wird}. Kein Wunder: Der Autor selbst übt regelmässig die Fechtkunst — mit selbstgebasteltem Degen …
»Brigitte« empfahl den Roman in der Bücher-Beilage anläßlich der Frankfurter Buchmesse 2007.
»Glaube Aktuell« greift auf den DPA-Artikel von Gisela Ostwald zurück.
Bernd Sperber lobt (trotz einer Abstriche) in seinem »Bücher Blog«:
die sprache des autors und seine fähigkeit, den leser auf eine grandiose art und weise in seine atmosphärisch dichte welt zu entführen, fand ich äußerst bemerkenswert. das ganze liest sich außerdem weg wie nix, letztendlich ist dies also der perfekte schmöker für triste herbstabende.
Jessebird jubelt für »Planet 9«:
Ich kann »Die Glasbücher der Traumfresser« jedem empfehlen, der einen wahrhaft historischen (aber nicht historisch wahrhaften) Roman lesen möchte, der nicht zimperlich ist was Blut & Tod angeht und der das viktorianische England mag.
Im Blog »Alltagswahn« widmet sich eine ›weibliche Anhängerin des totalen Chaos‹ dem Roman:
Am Anfang war es etwas verwirrend, doch man liest sich schnell in die Geschichte ein. Eine Fantasygeschichte mit nem Touch Sherlock Holmes und Erotik.
Ian R. MacLeod: »AETHER« oder: Vom melancholischem Leben im Takt der Maschinen
Eintrag No. 376
•••
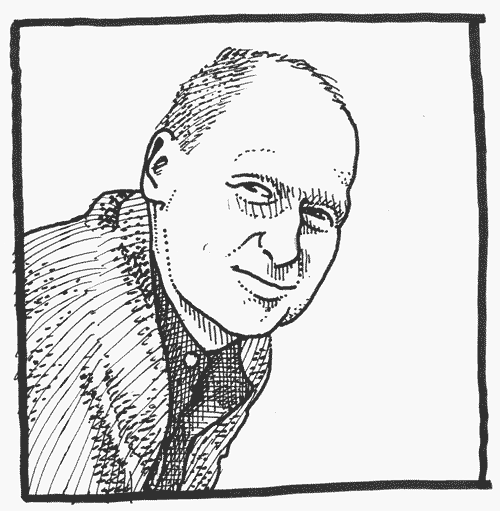 2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.
2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.
So beginnt »Aether« (The Light Ages) des aus Birmingham stammenden Ian R. MacLeod (1956). Dabei sei gleich davor gewarnt, daß dieser auktorial erzählte Rahmenhandlungsanfang erst nach dem Höhepunkt des Buches am Ende wieder geschlossen wird. Den Löwenanteil des Buches bildet die Icherzählerrückblende von Hochmeister Borrows.
—So Charles Dickens mit Fantasy und Steampunk halt ist allerdings ist ein reichlich vager ›in etwa so‹-Vergleich. Nur weil etwas in England und überwiegend in London spielt, sowie arme, reiche und einige kuriose Leute auftreten, ist etwas noch lange nicht so ähnlich wie Charles Dickens, der deutlich sprunghafter als MacLeod erzählt und zwischendurch auch immer wieder gern dick aufträgt, übertreibt oder abschweift. MacLeod selbst ›gesteht‹ in einem Interview[02], sich nu’ auch weniger an Dickens orientiert zu haben, sondern daß vielmehr Autoren wie D. H. Lawrence (für die Schilderung von Roberts Kindheit) oder Henry James (bei den Passagen über gesellschaftliche Zusammenkünfte) als bewusst gewählte ›Paten‹ dienten. Das zeugt dann Prosa, die sich an geduldigere Leser wendet, die mit dem Tonfall von ›klassischen‹ Edelfedern froh zu werden verstehen. Das soll nicht bedeuten, daß MacLeod verkopft schreibt, umständlich erzählt, oder sich gar zu angegilbten Sentimentalitäten hinreißen lässt.
Einige englischsprachige Rezensenten umschreiben den Roman ganz vorzüglich, indem sie sich den deutschen Begriff ›Bildungsroman‹ ausleihen. Immerhin wird eine spannende Lebensreise vom jungen zum alten Menschen ausgebreitet. Um so besser, wenn wie bei »Aether« die Lebensentwicklung des Helden viele Aspekte ihrer Zeit, ihrer Kultur, kurz: der Welt und Wirklichkeiten des Protagonisten streift, wenn er also als exemplarischer Repräsentativmensch plastisch erscheint. —Ich habe das bedrückende Leid der Armen geteilt, und an den Luxustafeln der Reichen gespeist, könnte ich Hochmeister Borrows übermütig in den Mund legen. Ian R. MacLeod alternative Aether-Welt bietet zwar genug von der Echtweltwirklichkeit abweichende Eigenschaften, daß sich in ihr spektakuläre Achterbahnfahrten veranstalten ließen oder übergroße Helden und Schurken auftreten könnten, aber der Autor hat mit seiner Alternativwelt anderes im Sinn, als große Spektakel aufzuführen.
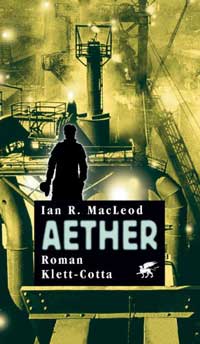 Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.
Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.
Dann dämmert dem jungen Robert langsam, daß mit seiner Mutter etwas nicht stimmt. Bei einem Arbeitsunfall vor vielen Jahren wurde sie mit Aether ›verseucht‹ und leidet seitdem an einer schleichend kulminierenden Veränderung zu einem Wechselbalg, einem wilden Aether-Geist. Diese beklemmenden Kindheitserlebnisse hab ich als originelle Variation des Jekyll & Hyde-Motivs gelesen. Wechselbälger, Trolle und andere Aethergeschädigte werden von den Gilden kassiert, mit schwarzen Kutschen und Wägen in geschlossene Anstalten gebracht, um ein tristes Dasein zu fristen und als Probanten der Aether-forschung zu nützen. Hauptsache, sie verschwinden aus den Augen der Öffentlichkeit. Ein Schicksal, dem Roberts Mutter mit dem tragischsten aller Mittel zu entkommen sucht.
Moment, ich will nicht[03] andeuten, daß »Aether« eine entmutigende Depri-Lektüre ist. MacLeod gönnt dem Leser schon auch längere Passagen mit idyllischen Szenen, z.B. wenn Robert den Märchengeschichten über das magische ›Arkadien‹ Einfell lauscht oder mit seiner Mutter einen Ausflug nordwärts unternimmt. Per Eisenbahn und zu Fuß suchen die beiden die aufgegebene Aethermine Redhouse auf und treffen dort zwei vom Aether Veränderte, die sich dem Zugriff durch die Gilden entziehen konnten: die alte Kräutermeisterin Summerton und Anna Winters, die etwa so alt wie Robert ist. Summerton und Anna sind jedoch keine hässlich-furchterregenden Monster, im Gegenteil wurden sie durch die seltsame Natur des Aethers in so etwas wie ›Lichtalben‹ verwandelt, die allerdings auf ihre Art ebenfalls nicht ganz geheuer sind.
Wieder nix mit einfacher Töpfchen-Kröpfchen-Verteilung von Gut und Böse, dafür ein atmosphärisch dichtes und glaubwürdiges Durcheinander von Abhängigkeiten, Widersprüchen, Faszinationen und Impressionen. So mag es zumindest ich.
Man erwartet von Robert, der Karriere seines Vater zu folgen und als Angehöriger der Niederen Gilde der Werkzeugmacher in der Aetherfabrik von Bracebridge zu arbeiten. Nun wäre kein Bildungsroman komplett ohne vertuschte Geheimnisse, und entsprechend stolpert auch Robert als Gildenlehrling über beunruhigende Spuren und Gerüchte aus der Vergangenheit, die mit dem Arbeitsunfall seiner Mutter zusammenhängen. Im Dritten der sechs Abteilungen des Romans flüchtet Robert aus der ihm zu engen Provinz nach London. Hier schließt er bald Freundschaft mit dem Taschendieb Saul, dem Sohn der Betreiberin eines Traumhauses, einer Art Bordell und Rauschgifthöhle, nur auch mit Aether-Drogen statt Opium. Saul und Robert engagieren sich für eine revolutionäre Bürgerbewegung, die gegen die Missstände der Gildenherrschaft antritt, und sie liefern bissige und beflügelnde Beiträge für die Zeitung ›Der Neue Morgen‹.
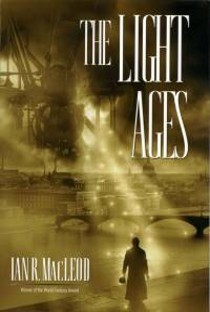 Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.
Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.
Wunderbar versetzt MacLeod die Leser in die ›Froschperpektive‹ Roberts, der erfreulicherweise kein flacher oder lascher Charakter ist, vielmehr eine plausible Mischung aus aufmüpfiger Eigenwilligkeit und naiver Kurzsichtigkeit. Schön ist es, mitgehen zu können, wenn Robert z.B. von quasi-marxistischer Kapitalismus-Kritik begeistert wird; oder mit ihm über die mannigfachen Besonderheiten der Aetherwelt zu staunen; oder sich mit ihm in eine junge Dame aus bester Gesellschaft zu verlieben. Auch wenn die Rahmenhandlung des alten Großmeisters einen gebrochenen Helden zeigt, der verzweifelt seinen Träumen nachspürt, und Roberts Lebensgeschichte einen tragischen Bogen spannt, schimmern immer wieder wundersame Hoffnungslichter im üppig-›realistischen‹ Weltenbau auf. Abgesehen von seinen unterhaltenden Qualitäten verführt »Aether« dazu, über die Begriffe Magie und Technik nachzudenken.
Was man als Magie und was als Technik betrachtet hängt entscheidend vom jeweiligen Wissensstand, bzw. Einweihungsgrad ab. Unsere Echtweltzivilisation blühte in den letzten Jahrhunderten durch die Perfektionierung des Einsatzes von fossilen Energielieferanten auf. Ist es Schicksal der Natur, oder hat sich die Menschheit damals freiwillig z.B. für den Verbrennungsmotor als Genius der Kultur entschieden? In MacLeods Welt gibt es Magie — Elektrizität und Automobile befinden sich noch im experimentellen Stadium — und dennoch nimmt die gesellschaftliche Entwicklung einen Verlauf, der unserer echten Welt mit ihrer bösen Moderne erstaunlich ähnlich ist. Anglo-phile Phantastikreisende werden diesen politischeren Ton sehr wahrscheinlich wiedererkennen, und man darf sich entsprechend freuen, wie gut sich Ian R. MacLeod einreiht zu den Herren Engländern, die vorzügliche, anspruchsvolle und verführerische London- und Königreich-Fantasia schreiben[04].
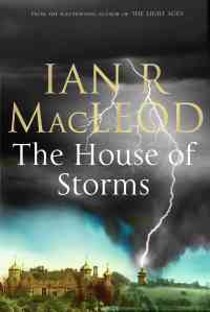 NACHTRAG, Mai 2007:
NACHTRAG, Mai 2007:
Es ist immer ein Glücksfall, wenn Übersetzungen ganz besonders gelingen, grad im sonst oftmals so schluderig gehandhabten Feld der Genre-Phantastik. Es hat mich also besonders gefreut, daß Klett-Cotta Barbara Slawig für die Übersetzung von MacLeods deutschem Debut gewonnen hat. Was ich seit Erscheinen von »Aether« aus dem Gerüchtedschungel erlauschen konnte, läßt mich bangen: »Aether« soll sich nicht so dolle verkauft haben, was ich sehr schade finde, denn dieses Buch bringt alles mit, um sowohl Fantasy/Steampunk-Genrespezialisten zu sättigen, als auch Leser zu erfreuen, die sich nicht speziell für Fantasy, aber eben für England, die Industrielle Revolution, einen gut geschriebenen Roman interessieren. Ich hoffe sehr, daß eine Taschenbuchauflage von »Aether« noch kommt und mit mehr Interesse aufgenommen wird, und ich bange darum, daß die quasi-Fortsertzung »House of Storms« (2005) dem deutschen Publikum noch gereicht wird. »House of Storms« spielt ca. 100 Jahre nach den Geschnehnissen von »Aether« im gleichen Weltenbau, und behandelt u.a. eine Queste um die Evolutionstheorie, einen Bürgerkrieg zwischen West- und Ostengland sowie herausragende Passagen aus der Sicht eines Wechselbalges. Ich persönlich fand diesen zweiten Roman aus der Aetherwelt noch besser, weil eleganter, abwechslungs- und auch äktschnreicher als seinen Vorgänger, und es wäre schade, wenn er hierzulande nur Gesprächsstoff für solche Leser bleibt, die ihre Lektüre auch englisch goutieren.
•••
[03] ERRATA: Dieses
nicht hat durch meine Schlamperei in der Druckfassung dieser Rezension gefehlt, was leider diesen Satz auf den Kopf gestellt hat. Hier also nun korrigiert. •••
Zurück
[04] Eine willkürliche Auswahl: Ian Sinclair, Michael Moorcock, Michael De Larrabetti, Peter Ackroyd, Clive Barker, Kim Newman, Glenn Duncan, Geoff Nicholson; sowie die hier ebenfalls besprochenen Herrn Gaiman und Miéville. •••
Zurück
Vorschau auf Molos Rezis in MAGIRA 2006 (mit Portraits)
Erstellt von molosovsky um 18:08
in
Literatur,
Magira Jahrbuch,
China Miéville,
Fantasy,
Jeff Vandermeer,
Tobias O. Meißner,
Weird Fiction,
Ian R. MacLeod,
Steampunk,
Neil Gaiman,
Phantastik
Eintrag No. 273
EDIT 23. Aug. 2006:: Um Links zu Portaitgroßansichten und den einzelnen Rezis ergänzt. Fehlerchen gemerzt, um Links zu Büchern ergänzt.
•••
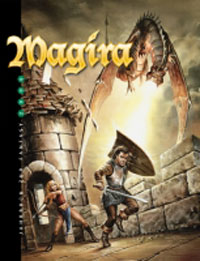 Mittlerweile ist »Magira – Jahrbuch zur Fantasy 2006« erschienen und die einzelnen Rezis (mit Anstandsverzögerung) auch in die Molochronik eingepflegt worden.
Mittlerweile ist »Magira – Jahrbuch zur Fantasy 2006« erschienen und die einzelnen Rezis (mit Anstandsverzögerung) auch in die Molochronik eingepflegt worden.
Nach meiner ›bösen‹ Rezi zu Tad Williams »Der Blumenkrieg« wollte ich (schon vor dem verständlichen Diss bei SF-Radio) diesmal auf gar keinen Fall von unangenehmen Lektüren berichten. Meckern kann ich zwar, aber es ist so öde. So gibts dieses Mal einen launischen Reisebericht über die seltsamen aber empfehlenswerten Bücher der Saison 2005/2006.
Die ganzen ca. 11.000 Worte sind wieder von Michael Scheuch und Herrman Ritter lektoriert worden (und Krischan Seipp durfte sich mit meinen Portrait-Illus herumschlagen). Hier findet der geneigte Leser das Introdubilo, die Überleitungs-Absätze.
Ich kann mich gar nicht genug bei den Genre-Kollegen und Genre-Freaks in den verschiedenen Foren die ich heimsuche bedanken. So manche Idee, Signatur, Ansichtssache hat mir beim Schreiben dieser launischen Empfehlungen geholfen.
•••
LAUNISCHE ABER AUFRICHTIGE EMPFEHLUBNGEN
VON SELTSAMEN & VERWIRRENDEN FANTASYBÜCHERN
DER PHANTASTIKSAISAON 2005/2006
»Ich sehe die Rezension als eine Art von Kinderkrankheiten an, die die neugeborenen Bücher mehr oder weniger befällt. Man hat Exempel, dass die gesündesten daran sterben, und die schwächlichen oft durch-kommen. Manche bekommen sie gar nicht. Man hat häufig versucht, ihnen durch Amulette von Vorrede und Dedikation vorzubeugen, oder sie gar durch eigene Urteile zu inokulieren, es hilft aber nicht immer.«
—Georg Christoph Lichtenberg, »Sudelheft J« (1718–1732)
—Was macht gute oder schlechte Phantastik aus? Wann sprießen wirklich neuartige Blüten im Garten der Fantasy und wann ist ›Fantasy‹ lediglich ’ne Karotte zum Erwartungsdirigieren und Treuekonditionieren von Konsumenteneseln? Wann wird an bestehende Traditionen erfrischend angeknüpft, und wann werden nur altbewährte Verführungstricks aufgefahren?
—Mensch Molo, lass doch den verkopften Quark und gib’ einfach Bescheid: ist ein Buch die Lappen, die ich dafür hinblätter wert, oder eben nich’? Überversimpelt gesagt, besteht im Beantworten solcher Fragen der Job eines Kritikers. Doch schaut man dazu am besten von einem fixen Standpunkt, z.B. als Torwächter auf die durchkommenden Bücherkarren aus den fraglichen Genregebieten, und lässt die Guten in die Stadtgemeinschaft passieren und weist die Unwürdigen ab; oder soll man versuchen, als Leuchtturmwärter den potentiellen Lesern Orientierungslicht zu spenden? Sicherlich sind solche statischeren Perspektiven auf Literatur und damit auch auf Teilgebiete wie Fantasy berechtigt und nützlich. Aber ich muss gestehen, dass ich mich dafür als zu skeptisch und sprunghaft einschätze, um auf brauchbare Art und Weise als Wache oder Leuchte zu dienen[01]. Ich will also im Folgenden versuchen, eine in ihrer Unaufgeräumtheit dennoch kurzweil-ige Sammelrezension anzubieten[02].
Aus den lebendigeren Gegenden des großen Kontinentes KONVENTIONA berichte ich, wie der geschickte Mythenimpressario Neil Gaiman, ein Konzert veranstaltet, indem er Spinnen Schöpfungslieder singen lässt, und wie Ian R. MacLeod mit Könnerschaft an gute alte europäische Prosatradition anknüpft, um vom ›Unbehagen in der beschleunigten Moderne‹ zu erzählen. Im verstreuten Inselreich AVANTGARDIEN wollte ich nicht versäumen zu erleben, wie China Miéville sein dreiteiliges ›gegen den Genre-Strich‹-Manöver mit rahmensprengender Vehemenz abschließt; und ich bin verblüfft vom artistischen Feinsinn Jeff Vandermeers, nachdem ich mich in seinem verführerischen, kompliziert-verspielten Narrationslabyrinth genüsslich verirrt habe.
Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da ›geb‹ ich lieber ›Zeitung‹ von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[03], dass
»Niemand dies Buch ohne Verstörung lesen können (wird)«,
hoffnungsvoll als Kauf- und Leseanreiz.
 Tobias O Meißner: »DAS PARADIES DER SCHWERTER« –oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt.
Tobias O Meißner: »DAS PARADIES DER SCHWERTER« –oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt.
Zur Rezi.
•••
Nach soviel wilden Blutstrudeln, Sprachbrechern und Metaphernriffen entlang der zerfledderten Küsten AVANTGARDISCHER Inseln, nun zu einem Autor, den ich seit Jahren als ›sicheren Hafen‹ zu schätzen weiß, weshalb er in meiner Lektüregeographie an den Gestaden KONVENTIONIAS gelegen ist.
 Neil Gaiman: »ANANSI BOYS« –oder: »Die spinnen, die Götter«.
Neil Gaiman: »ANANSI BOYS« –oder: »Die spinnen, die Götter«.
Zur Rezi.
•••
Wie überraschend und erfrischend der Einfluss von älterer oder auch neuerer Mainstreamschreibe für heutige Fantasy bzw. Phantastik sein kann, hat ja auch die vielgelobte Susanna Clarke mit ihrem voluminösen »Jonathan Strange & Mr. Norrell« vorgeführt[04]. Jetzt wäre es natürlich Blödsinn, wenn ich hier in einem Jahrbuch zur Fantasy Werke dafür lobte, dass sie Lesern von ›kanonischer Literatur‹ feine Fantasy-Ausflüge bereiten. Umgekehrt wird aber ein Schuh draus: Fantasy-Leser, die ihre Nase bisher gar nicht oder seltenst in alte Bücher gesteckt haben, können sich z.B. vom folgenden Titel anfixen lassen, öfter mal vermeintlich ›angestaubter‹ Literatur ‘ne Chance zu geben.
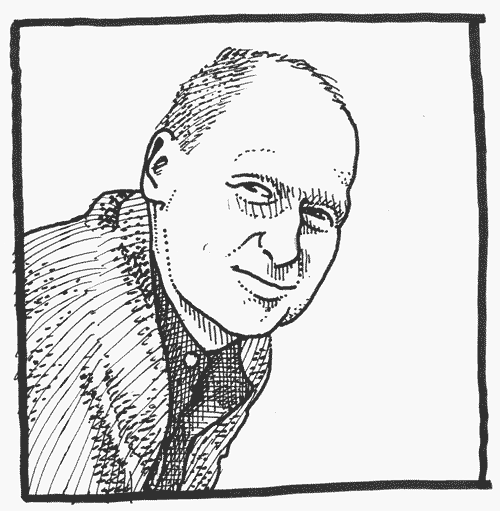 Ian R MacLeod: »AETHER« –oder: Vom melancholischen Leben im Takt der Maschinen.
Ian R MacLeod: »AETHER« –oder: Vom melancholischen Leben im Takt der Maschinen.
Zur Rezi.
•••
Ian R. MacLeod macht keinen Hehl daraus, als junger Mensch von linken Hoffnungen erfüllt gewesen zu sein. Es sei ihm gegönnt, dass er sich als gereifter und desillusionierterer Mensch einer eleganten Verquickung aus Zorn und Melancholie hingibt. Vom ältesten zum jüngsten Autor dieser Sammelrezi: Was kommt dabei heraus, wenn ein Geek mit heftigst lodernder ›Sozi-Inbrunst‹ auf diesen bedrückten Gemütslagen eine kräftige Portion handgreiflicher und spekulativer Äktschn aussäht?
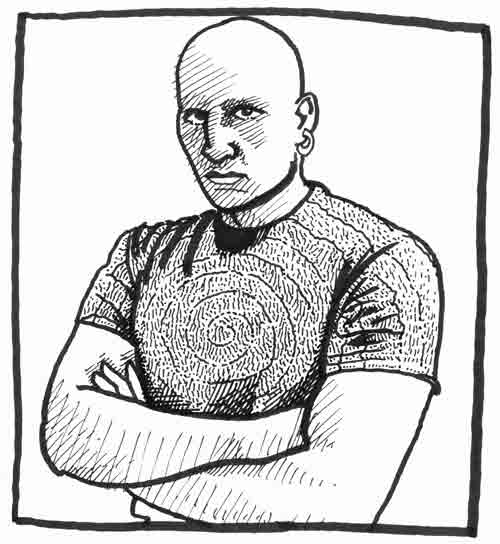 China Miéville: »DER EISERNE RAT« und Bas-Lag –oder: Wenn die ›Weird Fiction‹† revoluzzt.
China Miéville: »DER EISERNE RAT« und Bas-Lag –oder: Wenn die ›Weird Fiction‹† revoluzzt.
Zur Rezi.
•••
Nach dem bombastischen Ausflug in die konfliktreiche Globalisierungsgeschichte einer phantastischen Zweitschöpfungswelt schließe ich meinen Reisebericht nun mit einem thematisch nicht minder gegenwartsbezüglichen, bis auf Einschübsel meist indirekter Art gänzlich urbanem Erzählungspuzzle. Der nächste Autor ist auch so einer, der meint, dass man als Künstler sowohl seine art pour art-Haltung pflegen, und zugleich trotzdem zeitgenössisch auf der Höhe sein, und politisch-gesellschaftlich relevante Fiktionen von vergnüglicher Reife zustande bringen kann. Aber schon der Titel dürfte anklingen lassen, dass ›gnostischere‹ Fantasy auf einen zukommt.
 Jeff Vandermeer: »STADT DER HEILIGEN & VERRÜCKTEN« –oder: Kalmartentakel und Pilzsporen.
Jeff Vandermeer: »STADT DER HEILIGEN & VERRÜCKTEN« –oder: Kalmartentakel und Pilzsporen.
Zur Rezi.
•••
[01] —Vorsicht, nicht die Küste rempeln. •••
Zurück
[02] Darum wissend, dass ich selbst eine Virenschleuder für oben genannte ›Kinderkrankheiten‹ aus dem Reich der Meinungsschieberei bin. •••
Zurück
[04] Gwenda Bond stellt in ihrem Artikel für
»Fantasy Goes Literary«
(»Novels with supernatural elements are finding a new readership«)
für Publishers Weekly Einschätzungen von Verlagen und Agenten zu diesem Phänomen vor. ••• Zurück
 Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.
Eintrag No. 614 — Eingedenk meiner eigenen, in der Erschöpfung versackten Ersterfahrung mit Thomas Pynchon (1937) und seines Rufes, ein Autor extrem vertrackter Romane zu sein, bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist, »Gegen den Tag« zu verschlingen. Immerhin brechen sich an Pynchon, genauer gesagt seinem Werk (denn der Mensch Pynchon ist extrem medienscheu und entsprechend wenig greifbar, von Mythen und Kolportagen abgesehen), seit dem Erscheinen der fulminanten Phantasmagorie »Die Enden der Parabel« (Amerikanisch 1973 als »Gravities Rainbow«, deutsch 1981) die Diskurswellen über das, was man ›postmoderne‹ Literatur nennt. Für die einen hat sich Pynchon durch diesen abseitigen und ungestümen Roman, der mit Bananengemansche beginnt, und dann Raketen-Ballistik und Erektionen, Mathematik und Esoterik, Halluzinationen und Rausch vor dem Hintergrund der Kriegsjahre 1944/45 auffährt, als König der versponnenen Großfabulierer etabliert. Für die anderen ist dieser Roman ein Musterexempel verwirrender und sinnloser Geschmacks- & Planlosigkeitszumutungen. Bis dato bin auch ich noch nicht wirklich warm geworden mit »Die Enden der Parabel« und habe das Trumm nach einem Drittel erstmal beiseite gelegt, unter anderem weil mich beispielsweise ein seitenlanges Fäkaldelirium vor den Kopf gestoßen hat, bei dem eine Figur im Tagtraum einen Kloabfluss hinabgespült wird[01], aber vor allem, weil Pynchon hier den Kniff des fließenden Perspektiven- und Ebenenwechsels derart auf die Spitze treibt, dass ich allerweil auf nebenbei gemachte Notizen zurückgreifen musste, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Klarer Fall: ein Buch für mehrere freie Tage und dann heißt es, mit wenig Schlaf und mit Schmackes einfach durch. Immerhin gibt’s auch fetzige Erzphantastik nach meinem Gusto, zum Beispiel wenn ein Tagtraum äußerst munter schildert, wie eine Riesenamöbe London unsicher macht und wie man ihr vergeblich beizukommen trachtet.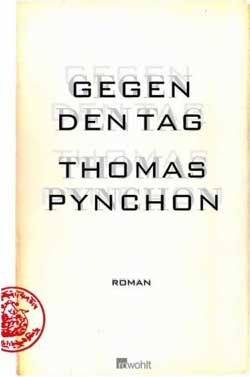 Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.
Einige Leserstimmen intonierten den vertrauten Klagegesang über den zerfaserten Handlungsverlauf von »Gegen den Tag«, vermissen einen klar ersichtlichen Hauptplot der einen bei der Stange hält. Zudem tummeln sich in dem dicken Ding etwa eineinhalb Dutzend Hauptfiguren und zig Neben- und Randfiguren, und die Pausen zwischen Absetzten und Wiederaufnehmen eines Hauptfigurenstranges können bei diesem Übertausendseiter schon mal hundert Seiten und länger sein. Mit der Erwartungshaltung »Ich will einen klar verständlichen Plot!« wird man hier sicher nicht froh, und ich verweise daher auf dessen ausgeprägten Panorama-Charakter. — Kurzer Geschichtsausflug: als Panorama wurden im 19. und 20. Jahrhundert jene begehbaren, mit allen Tricks der illusionserzeugenden Theatermalerei- und Kulissenkunst ausgestatteten 360°-Rauminsterllationen bezeichnet, in denen sich das wunderschausüchtige Publikum in den wuchernden Großstädten der ersten Welt vergnügen konnte. In solchen Panoramahäusern konnten zuhause gebliebene Ottonormalverbraucher sich einen Eindruck verschaffen von Eiswüstenein, neuweltlichen Pionierlandschaften, oder Schlachtengetümmel.[03] — Nun sind Romane zwar keine überdimensionierten Wimmelbilder, über die der Blick der Betrachter frei schweifen kann, denn Leser sind genötigt, sich linear von der ersten bis zur letzten Seite durchzufräsen. Jedoch ermuntern gelungene Romane dazu, nachdem man alles gelesen hat, die Gesamtschau im eigenen Kopf zu veranstalten. Einerseits ist die bildnerische Gesamtschau von »Gegen den Tag« episch, enorm detailreich, und die Art, wie die thematischen Felder und Spannungen kombiniert oder auf- und gegeneinander gewichtet sind, scheint mir vom technisch-mathemathischen Verständnis des gelernten Ingenieurs Pynchon geprägt zu sein. Der Zwang zum linearen Erlesen lässt es andererseits zu, dass man Romanen eine gewisse Verwandtschaft mit den musikalischen Künsten andichten kann, und Pynchon ist nun ein Musikfan, vor allem ein Jazzfan, aber statt klarer Entwicklung bekommt man virtuoses Improvisieren geboten, mit allem, was zu dieser Kunst gehört, vom blödelnden Variieren der Situationskomik bis hin zur meditativen Versenkung in Stimmungen.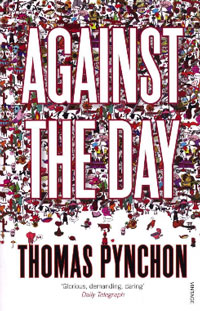 Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen:
Das größte phantastische Ereignis wird in »Gegen den Tag« von einer Katastrophe verursacht, die nur zu deutlich zeigt, was die tatsächlichen kosmischen Bedrohungen aus der Wirklichkeit für alle menschengemachten Pläne sind: Naturkatastrophen, hier der Meteoreinschlag Tungkuska vom 30. Juni 1908. Es folgt eine kurze Kostprobe der Kapriolen, die in Pynchons Welt dem Kosmosschlag auf den Percussionskörper Erde folgen: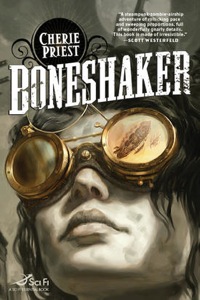
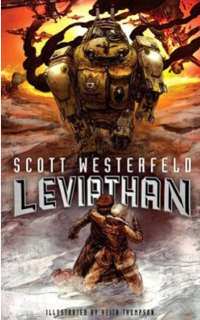


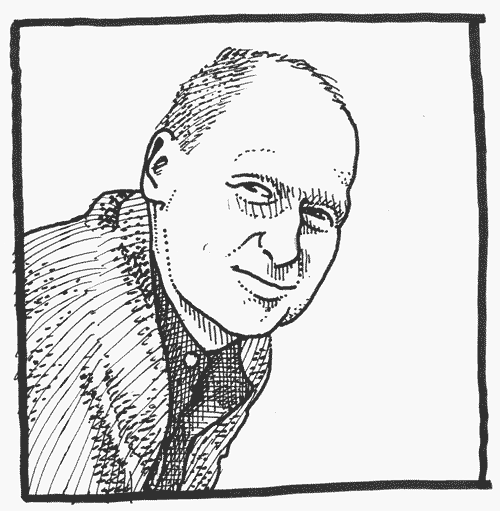
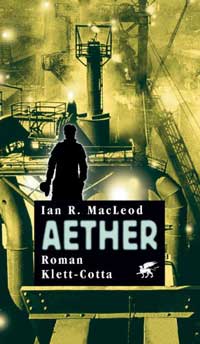
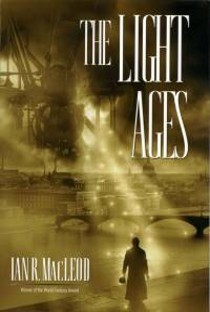 Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters
Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters