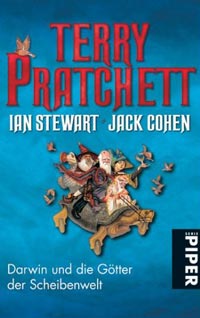Otto Kallscheuer: »Die Wissenschaft vom Lieben Gott«
Eintrag No. 353 — Was die für mich bisher und ansonsten vorzügliche Reihe »Die Andere Bibliothek« angeht, so dachte ich bis jüngst, dass es da weder Mittelmäßiges noch gar Schlechtes gäbe. Nun aber bin ich eines besseren belehrt worden, denn zur Jahreswende habe ich mir »Die Wissenschaft vom Lieben Gott« von Otto Kallscheuer (wenn auch nur als Taschenbuch) gegönnt.
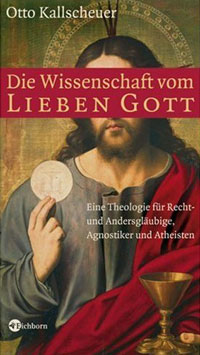 Vergnügt hat mich das Buch schon, auch und gerade indem es mich uffgeregt und genervt hat. Kallscheuer babbelt die meiste Zeit derart flappsig und kalauernd daher, dass ich mich frug, ob ich es hier mit einem (Möchtegern-)Komiker zu tun hab. Den glaubensverteidigenden Humorleistungen eines G. K. Chesterton kann Kallschauer jedoch nicht das Wasser reichen und so wirkt die Witzischkeit von »Die Wissenschaft von Lieben Gott« desöfteren mehr wie aufgesetztes Ornament, nicht wie tragende Struktur. Die besteht leider aus jenem (für mich Ungläubigen mal zutiefst unheimlich, mal putzig anmutendem) kirrem, sturem und treuherzigem Postulieren von Absolutismen, also ›Überdrübergehtnixmehr‹-ismen, welche unter dem exotisch und ehrwürdig klingenden Namen Theologie angeredet werden dürfen.
Vergnügt hat mich das Buch schon, auch und gerade indem es mich uffgeregt und genervt hat. Kallscheuer babbelt die meiste Zeit derart flappsig und kalauernd daher, dass ich mich frug, ob ich es hier mit einem (Möchtegern-)Komiker zu tun hab. Den glaubensverteidigenden Humorleistungen eines G. K. Chesterton kann Kallschauer jedoch nicht das Wasser reichen und so wirkt die Witzischkeit von »Die Wissenschaft von Lieben Gott« desöfteren mehr wie aufgesetztes Ornament, nicht wie tragende Struktur. Die besteht leider aus jenem (für mich Ungläubigen mal zutiefst unheimlich, mal putzig anmutendem) kirrem, sturem und treuherzigem Postulieren von Absolutismen, also ›Überdrübergehtnixmehr‹-ismen, welche unter dem exotisch und ehrwürdig klingenden Namen Theologie angeredet werden dürfen.
Theologie geht ja so: verleibe Dir möglichst viel von der Konkurrenz ein (antiker Philosophie, Heidentum, Volksaberglaube), steigere all das dann zum Besten, Größen, Herrlichsten, Mächtigsten usw. und wenn jemand dann auf die Fehler, Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten aufmerksam macht, redet man sich raus mit dem Hinweis, dass über GOtt zu reden oder ihm gar mit Vernunftargumenten beikommen zu wollen eh eine Knieschußaktion ist, weil unsere menschliche Sprache zu unvollkommen, unser menschlicher Verstand zu begrenzt, unsere menschliche Existenz zu beschränkt seien, um sprechend, denkend oder seiend IHM, DER DA IST wirklichend gerecht werden zu können. Nur wer wahrhaft glaubt, kann der Gande zuteil werden, irgendwie und ungefähr GOtt zu erfahren und SEINE HERRLICHKEIT ein izzi-bizzi-wenig aber mystisch zu schauen.
Wer sich ordentlich über die Geschichte theologischen Denkens informieren will, kann sich das Buch sparen, denn es bietet weder eine historische noch eine thematisch sinnvolle Aufbereitung des monotheistisch-theologischen Denkens und Glaubens. Vor allem aus den ersten zwei Dritteln kann man aber durchaus erfahren, aus welchen Legosteinchen der Glaube an einen absoluten persönlichen Eingott zusammengesteckt wurde.
Die Verstiegenheit des Buches fasst sich im letzten Absatz selbst ganz prächtig zusammen, wenn es heißt, dass die Globalisierung, also die ethisch-politische Vereinigung zu einem Königreich, ein Projekt Gottes sei, inklusive der wissenschaftlich-technischen Erforschung und Durchdringung der Welt. — Das ist richtig gruselig, denn durch das Buch zieht sich als ein roter Faden (oder als Achse des Westlich Guten™???) die Lobpreisung eines gewissen Bildes vom geistig-philosophischen Westen (für Kallscheuer eben die Essenz der drei Monotheismen Judentum, Christentum und Islam). Hiermit ist eine Denkart gemeint, bei der es noch EINE höhere Zielgerichtetheit, EINE teleologische Schöpferabsicht in der Welt und für uns Individuen, eben EINE Wahrheit gibt. Entsprechend hat das Buch nur Spott und Schimpf für antike und moderne Phantasmen-Vielfältigkeiten übrig (ganz nach dem Gebot: »Du sollst kein Trugbild haben neben mir«), grämt sich über die Popularität von fernöstlichem, weichgewaschen-christlichen und pokulturll-beliebigen Glauben. Diskurse die wahrhaft kritisch zu werden drohen sind Kallscheuer abhold.
 Zudem: Ulkige Fehler lassen sich finden. Kallscheuer zitiert zwar alle möglichen obskuren Katholen mit Inbrunst, aber aus dem ägyptischen, einen Falkenkopf tragenden Gott Horus macht er einen ›Stiergott‹ (S. 161), und aus Hergé, dem Schöpfer von Tim & Struppi, wird ›Hervé‹ (S. 386).
Zudem: Ulkige Fehler lassen sich finden. Kallscheuer zitiert zwar alle möglichen obskuren Katholen mit Inbrunst, aber aus dem ägyptischen, einen Falkenkopf tragenden Gott Horus macht er einen ›Stiergott‹ (S. 161), und aus Hergé, dem Schöpfer von Tim & Struppi, wird ›Hervé‹ (S. 386).
Das Buch bietet auch Lobenswertes: da ist als erstes der dialogische Aufbau des Textes zu nennen, welcher im Großen und Ganzen für eine lockere Lesbarkeit sorgt (ein paar Kapitel gehen trotzdem wegen ihrer eintönigen »GOtt ist groß«-Formelhaftigkeit schwer runter); dann ist der Spott und die Schimpfe, die Kallscheuer den ganz engsternigen (Un-)Glaubensgenossen angedeien läßt, erfrischend zu lesen, und so genoß ich die verbalen Kopfnüsse und Brennesseln gegenüber Kreationisten, Wohlfühl-Esotrikern und Bequemlichkeits-Atheisten; und drittens amüsiert das Buch streckenweise mit seinen begeisterten Science Fiction- und Fantasy-Einlagen, wenn zum Beispiel quantentheoretische Multiversum-Spekulationen, oder freakige Jesutien-SF über den Omegapunkt der Evolution referiert werden.
Am meisten auf den Wecker gegangen ist mir allerdings die Art, wie Kallscheuer sich selbst in seinem Dialog immer wieder das Wort verbietet, ja geradezu anherrscht, nur bis hier und nicht weiter zu spekulieren, zu fragen, und also das Maul zu halten:
»Lassen wir das! Das wäre schon wieder eine andere Debatte {…} Ihre Frage ist ja sinnvoll, aber hier muß ich die Notbremse ziehen {…} Darum lassen wir hier die Finger davon, mon cher {…} Halt! Zu diesem Punkt entziehe ich Ihnen (und mir) das Wort {…}«
Nene, von einem guten Sachbuch erwarte ich anderes.
•••
Otto Kallscheuer: »Die Wissenschaft vom Lieben Gott. Eine Theologie für Recht- und Andersgläubige, Agnostiker und Atheisten« 486 Seiten, XVIII Kapitel; Die Andere Bibliothek, 2005 (gebunden), ISBN: 978-3-821-84561-6; — Piper, 2008 (Taschenbuch) ISBN: 978-3-492-25221-8
Tom Shippey: »J. R. R. Tolkien – Autor des Jahrhunderts«
Eintrag, No. 529
•••

Der vorherrschende literarische Modus des zwanzigsten Jahrhunderts war der des Phantastischen.
Mit diesem prächtigen Satz eröffnet Tom Shippey (*1943) seine große Führung durch das Schaffen und die Gedankenwelt des Mittelerdemeisters. Zugestanden: meine Begeisterung für Tolkiens Werk hält sich in Grenzen, aber das mindert nicht meine Faszination für diesen schrullig-konservativen Kreativ-Revolutionär der Phantastik. Trotz der Bedenken die mich zu vielen Aspekten von Tolkiens Fantasy umtreiben, teile ich die empörte Verdutzung der Phantastophilen über die ignorante Ablehnung und das zickige Unverständnis, mit der sich das ›literarische Establishment‹ größtenteils dem Papa Hobbit nähert[01].
Andererseits finde ich es genauso beunruhigend, wie Teile des Mikromilieus der Genre-Phantastikfans Tolkien unbekümmert nach jeweiliger Lust und Laune zurechtbiegen. Zugestanden: sich mit eigener Interpretation und Aneignung für ein Werk zu begeistern, oder simpel gesagt: für sich zu entdecken, schafft neue Perspektiven auf dieses Werk (auch für andere Leser, wenn man sich austauscht), aber dennoch bleibt es eine wichtige Orientierungsmarke, wenn man Schwammigkeitsriffe und Wischiwaschistrudel zu meiden trachtet, was denn ein Autor mit seinem Werk beabsichtig hat. Auf meinen Warnschildern an der Tolkien-Interprationsgrenze zum Unsinn stünde z.B. »Pfeiffenkraut ist kein Mittelerde-Marihuana!« und »Tolkien ist kein Pionier neuheidnischer Popular-Spiritualität!«.
Nun bietet Tom Shippey als einer der angesehensten, lebenden Tolkien-Experten mit seinem Buch angenehm verständliche Erläuterungen zum Mittelerdewerk[02]. Ein besonderer Glücksfall, denn nicht nur wandelt Shippey als Gelehrter für angelsächsische Literatur auf den gleichen Pfaden wie sein Vorgänger Tolkien, darüber hinaus ist Shippey selbst Herausgeber von Phantastik und (unter dem Pseudonym John Holm) auch ein Fabulierer. Er blickt also sowohl aus der Vogelperspektive akademischer Gelehrsamkeit, als auch aus der Froschperspektive schriftstellerischen Erzählens auf die Thematik. Skeptisch-bockige Verächter und überbegeisterte Zurechtdeuter können die Bröselig- oder Festigkeit ihrer Vorurteile anhand dieses Sachbuchs prüfen.
Der Hauptteil des Buches gliedert sich (weitestgehend chronologisch) in sechs Kapitel. Alles beginnt mit der eintönigen Korrigiererei von Studentenarbeiten, einer leeren Blattrückseite und einem gelangweilten John Reul Roland der gedankenlos einen Satz hinkritzelt, und ich meine natürlich: Alles beginnt mit dem »Loch in der Erde in dem einst ein Hobbit lebte«. Woher kommt das Wort »Hobbit«, und was soll man von anachronistischen Vokabeln wie »komfortabel«, »Tabaksdose«, »Postzustelldienst« und »Pfiff einer Lokomotive« in »Der Kleine Hobbit« halten? Hier ein Beispiel für Shippeys willkommenes Orientierungsgeschick:
Ein Autor, der eine Erzählung vor dem Hintergrund einer fernen Zeit darstellt, wird oft finden, dass die Kluft zwischen dieser Zeit und dem Bewusstsein des modernen Lebens allzu groß ist, um sich leicht überbrücken zu lassen; und folglich wird dann in den historischen Rahmen eine Gestalt von wesentlich modernerer Haltung und Empfindungsweise eingeschleust, die den Leser in seinen Reaktionen anleitet und ihm hilft, sich vorzustellen, ›wie es wäre‹, dabei zu sein.«
[03]Bilbo, dieser bequeme Mittelschichtbürger der viktorianisch-edwardischen Epoche, dient als »Spiegelteleskop in eine fremde Welt«[04], und fühlt sich entsprechend Fehl am Platze in dem archaisch-heroischen Reich von Mittelerde. Wortklaubereien behagen nicht jedem, aber wer eben von Tolkien diesbezüglich infiziert wurde, wird bereits in diesem ersten Kapitel reichhaltig verköstigt, mit Interessantem zu Begriffen wie Baggins (altes Nordenglisch für Brotzeit), oder »burglar« und »bourgeois« (der eine bricht in Burgen ein, der andere wohnt darin). Aufregend fand ich zum Beispiel auch, wie Shippey zeigt, dass die Schlacht der Fünf Heere im Grunde viele Wendungen des Ersten Weltkrieges in eine Pfeil und Bogen-Szenerie versetzt. Da organisiert Bard wie ein Infanterie-Offizier die kollektive Abwehr, da wird bis zum letzten Pfeil gekämpft (statt bis zur letzten Kugel) und werden Stellung gehalten, und Shippey resümiert diese Schlacht entsprechend:
Zwar ist der Sieg am Ende einem einzelnen und seiner von den Ahnen ererbten Waffe zu verdanken, doch liegt der Nachdruck der Schilderungen auf dem kollektiven Handeln, auf Planung und Organisation – mit einem Wort, auf Disziplin.
[05]Mit Spekulationen über den Zusammenhang von alten Wörtern für Höhlenbewohner (Holbytla), Hasen und Hobbits schließt Shippey das erste Kapitel ab, und verdeutlicht dabei, dass Tolkien daran gelegen war, eine Brücke zwischen Moderne und Vergangenheit zu bauen, und wie gut ihm das mit den Hobbits geglückt ist.
Als Herzstück des Buches folgen nun drei Kapitel über »Der Herr der Ringe« (desweiteren der Knappheit wegen HDR abgekürzt). Da (verständlicherweise) wohl kein deutscher Verlag auf absehbare Zeit (wenn überhaupt jemals) das Risiko und die ungeheuere Anstrengung wagen wird, die komplette dreizehnbändige »HISTORY OF MIDDLE-EARTH« zu übersetzen, sind diese Kapitel für alle, die sich hierzulande tiefer mit dem wichtigsten (wenn auch bei Weitem nicht einzigsten) Keimtext der heutigen Fantasy auseinandersetzen wollen, ein wunderbare Speisung, ein ausführlicher Ersatz für den editierten Nachlass. Zuerst widmet sich Shippey Tolkiens Tastversuchen um Struktur und Handlungsplan von HDR. Es ist eine verwickelte Queste für sich, wie sich Tolkien von Dezember 1937 an, Welle um Welle, lange Zeit planlos, mehrmals immer wieder von Vorne beginnend, langsam bis zur 1954/55 veröffentlichten Endfassung durchwurschtelte. Mit seiner Autopsie des Rats von Elrond (dieser unübersichtlichen Vorstandssitzung) verdeutlicht Shippey, dass dieses Kapitel in zweifacher Hinsicht einen bedeutenden Wendepunkt bezeichnet: erstens für Tolkien selbst, der bei seiner Arbeit an diesem Abschnitt endlich klare Sicht auf die großen tragenden Handlungssäulen seiner Wortkathetrale erlangte; zweitens als Wegscheide der Handlung, die mit der Mission der Ringzerstörung nun ein klares Ziel bekommen hat. Selbst für mich als Tolkienskeptiker ist es ein unterhaltsamer Unterricht, wie Shippey die ungeheuerlich unkonventionelle Komplexität von Tolkiens Schöpfung am Beispiel dieses Kapitels erläutert. In den beiden nächsten Kapiteln über die ideologischen und dann die mythologischen Dimensionen von HDR, legt Shippey die großen Themen aus, die Tolkien umtrieben. So zum Beispiel die quälende Menschheitsfrage nach dem Ursprung des Bösen, und warum es so viel Leid und Schmerz in der Welt gibt. Wie kann Gott das gewollt haben? Shippey zeigt, dass Tolkien sich dieser erzphilosophischen Probleme und Prüfungen des Glaubens annimmt, indem er zwei christliche Vorstellungen des Bösen, die ihn beschäftigt haben, gegenüberstellt: Erstens die orthodoxe Auffassung z.B. eines frühchristlichen Denkers wie Boethius, derzufolge das Böse keine eigenständige Wesenheit besitzt, nicht wirklich selbst etwas schaffen kann und nur durch die Abwesenheit des Guten Gestalt annimmt; zweitens das Gebäude des manichäischen Dualismus, demzufolge das Böse durchaus eine eigenständige dunkle Macht, und das Erdenrund ein Schlachtfeld des ewigen Kampfes zwischen Licht und Finsternis ist. Im Detail findet sich dieser Gegensatz z.B. in der Widersprüchlichkeit des Meisterringes wieder. Ist Saurons Über-Gadget ein psychischer Verstärker für unbewusste Ängste und egoistische Regungen? Oder ist der Ring selbst ein Charakter mit eigenem Willen? Auch als Nichtchrist kann einem dieses Beispiel Respekt für den Künstler Tolkien einflößen, wie er mittels dieses unentschiedenen Gegensatzes die zweifache Bitte um Schutz vor inneren und äußeren Versuchungen des Vater Unser-Gebets verarbeitet[06]. Beim Aufdröseln der mythologischen Dimension von HDR kommt Shippey schließlich auf zwei Vermittlungsambitonen Tolkiens zu sprechen. Einerseits war Tolkiens Anliegen, Verständnisbrücken zu errichten, zwischen christlichem Glauben und vorchristlicher heroischer Literatur (der sich J. R. R. und seine Inkling-Freunde, wie wir heute sagen würden, als Fans gewidmet haben), und andererseits zwischen christlichem Glauben und der nachchristlichen Gegenwartswelt (als welche der von den Schrecknissen der Moderne Traumatisierte seine Zeit empfand). Sozusagen locker nebenher liest sich das alles aber auch wie eine kleine (englische) Literatur- und Ideengeschichte, wenn Beziehungen zwischen Tolkiens Werk und solchen Klassikern wie Milton, Shakespeare und natürlich immer wieder »Beowulf« und die nordischen Sagas geknüpft werden.
 Mit den beiden letzten Kapiteln leistet Shippey entsprechende Klärung zum »Silmarillion« und den kleineren Schriften Tolkiens. Da ich hoffentlich bereits genug Beispiele der klugen Beschäftigung Shippeys mit den Eingeweiden von Tolkiens Weltenbau angeführt habe, möchte ich das Augenmerk der geneigten Leser nun lieber auf die Einleitung und den Epilog von Shippeys Schatzkiste von einem Buch lenken. Diese beiden Teile sind nicht nur für Leser von Interesse, die ihre Sicht auf Tolkien schärfen möchten, sondern schildern anregend den merkwürdigen literaturkritischen Diskurs zu Tolkien und Phantastik. Shippey geht den Argumenten der Kritiker Tolkiens und dem überraschenden Erfolg vor allem von HDR auf den Grund, mit (wie ich finde) einer erfrischenden Portion streitbarer Plausibilität. Die Begeisterung des Publikums für Mittelerde wird drastisch kontrastiert durch die Ausgrenzung der Mehrheit der Gärtner der so genannten ernsthaften Literaturzirkel. Ein Exempel für die gespaltene Zunge der Kritik liefert Shippey z.B. mit Philip Toynbee, der 1961 in einem Artikel für die »Times« schrieb, dass die Kriterien, die ein guter Schriftsteller zu erfüllen habe, sein sollen:
Mit den beiden letzten Kapiteln leistet Shippey entsprechende Klärung zum »Silmarillion« und den kleineren Schriften Tolkiens. Da ich hoffentlich bereits genug Beispiele der klugen Beschäftigung Shippeys mit den Eingeweiden von Tolkiens Weltenbau angeführt habe, möchte ich das Augenmerk der geneigten Leser nun lieber auf die Einleitung und den Epilog von Shippeys Schatzkiste von einem Buch lenken. Diese beiden Teile sind nicht nur für Leser von Interesse, die ihre Sicht auf Tolkien schärfen möchten, sondern schildern anregend den merkwürdigen literaturkritischen Diskurs zu Tolkien und Phantastik. Shippey geht den Argumenten der Kritiker Tolkiens und dem überraschenden Erfolg vor allem von HDR auf den Grund, mit (wie ich finde) einer erfrischenden Portion streitbarer Plausibilität. Die Begeisterung des Publikums für Mittelerde wird drastisch kontrastiert durch die Ausgrenzung der Mehrheit der Gärtner der so genannten ernsthaften Literaturzirkel. Ein Exempel für die gespaltene Zunge der Kritik liefert Shippey z.B. mit Philip Toynbee, der 1961 in einem Artikel für die »Times« schrieb, dass die Kriterien, die ein guter Schriftsteller zu erfüllen habe, sein sollen:
- ein Privatmann zu sein, der sich nicht ums Publikum schert;
- er solle über alles schreiben und damit relevant machen können;
- er solle ein Artefakt schaffen, dass zuvörderst ihn selbst zufriedenstellt;
- und schließlich soll dieses Werk dann bei seinem Erscheinen schockierend, verblüffend und etwas für das Bewusstsein der Öffentlichkeit Unerwartetes sein.
Und dann tadelt dieser Toynbee im selben Jahr Tolkien, und war sich sicher, dass dessen Bewunderer ihre Mittelerde-Aktien bald wieder loswerden wollen, weil der ganze »Irrsinn« bereits der Gnade des Vergessens anheimfällt[07]. Shippey findet es kümmerlich, dass es Autoren wie James Joyce oder T.S. Eliot nicht angekreidet wurde und wird, dass sie ihre klar erkennbar modernen Werke mit Motiven alter Mythen und Sagen angereichert haben, genau dies aber gern gegen Tolkien angeführt wird. Und am ärgerlichsten: diese Ressentiments werden kaum jemals ordentlich begründet, und so vermutet Shippey, dass die damaligen Vorurteile der zumeist linksorientierten, protestantischen Literatur-Cliquen aus besserem Hause, gegenüber dem aus einfacheren Verhältnissen stammenden Katholen Tolkien für diese Betriebsblindheit verantwortlich waren, und sich diese Rhetorik gut eingeschliffen bis heute erhalten hat.
Wenn die Phantastik als Ganzes angegriffen wird, stelle auch ich Tolkien-Skeptiker mich beherzt auf die Seite des verständigen, aber alles andere als oberflächlichen Fürsprechers des Mittelerde-Meisters Shippey. Immerhin kann auch einer, der Tolkiens Werk für doof hält, die eigenen Argumente an so einem klugen Kenner wie Shippey schärfen. Nur zu gern habe ich mich von der Shippey-Lektüre zu »Hausaufgaben« anstiften lassen: z.B. mal mit Boetheus-Lektüre anzufangen und die Kurzgeschichten von Tolkien auf Englisch anzuschaffen und neuzulesen. — Abschließend möchte ich noch ganz unaufgeregt einem Wunsch Ausdruck verleihen: Eine günstige Taschenbuchausgabe von »J. R. R. Tolkien – Autor des Jahrhunderts« wäre sehr fein (und wenn’s noch’n büschen dauert bis dahin), denn immerhin kostet die gebundene Ausgabe 25,- € und es wäre schön, wenn ein verführerischer Taschenbuchpreis von ca. 12,– € weitere Leserkreise verführte, sich einmal »ernsthaft« mit dieser prominenten Zweitwelteschöpfung auseinanderzusetzen. Aber selbst wenn so eine Taschenbuchausgabe nicht zustande kommen sollte, ist es schön zu wissen, dass Klett-Cotta auch Shippeys »Der Weg nach Mittelerde« im Herbst 2007 auf Deutsch zugänglich machen wird. Ich freue mich schon darauf.
•••
•••
ANMERKUNGEN:
[01] Hier zum Sich-gruseln die ersten Zeilen des exemplarisch zickigen und unverständigen Eintrags in Frank Schäfers »Kultbücher« (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2000, S. 81ff):
Ein riesiger, stofflich ausufernder, immerhin dreibändiger Schmarrn der erst 1969 ins Deutsche übersetzt wurde, was einigermaßen erstaunlich ist, denn der notorische Nachkriegs-Eskapismus wäre mit diesem atavistischen {gemeint ist vulgo: »rückständigen«, womöglich sogar »zurückgebliebenen« – Molo} Pseudo-Mathos doch eigentlich auch recht gut bedient gewesen. So erlößte jene Romantrilogie die meisten deutschen Traumtänzer und Schwarmgeister erst in den 70er und 80er Jahren (im Gefolge des Fantasy-Booms) aus ihrer Realitätsstarre und schickte sie auf eine weite Reise nach »Mittel-Erde«.
••• Zurück
[02] Shippey ist mir schon bei den Dokumentationen der Jackson’schen
»Special Extended Edition« von
»Der Herr der Ringe« angenehm aufgefallen. – Ich gestehe freimütig: Tom macht als leidenschaftlicher Experte bei diesen Dokus auf mich einen herzerfrischend sympathischen Eindruck. Vom Team des ganzen Verfilmungszirkus traue ich nur den beiden Künstlern John Howe und Alan Lee, sowie Christopher Lee zu, eine mit Shippey vergleichbare sinnfällige Schau auf Tolkiens Schaffen zu haben. •••
Zurück
[06] »Führe uns nicht in Versuchung / und erlöse uns von dem Bösen.« •••
Zurück
[07] Knuffig auch Hermann Hesses Urteil 1922 über E. A. Poe:
Die ganze ihm nachfolgende Literatur des Grauens und der Phantastik wird rasch wieder untergehen.
»Schriften zur Literatur« ••• Zurück
Max Brooks: »Weltkrieg Z. Eine mündliche Geschichte des Zombiekrieges«
Eintrag No. 528
•••
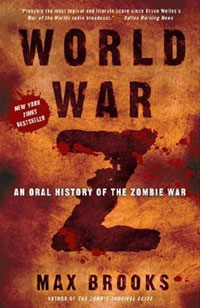 Manche Medienwerke sind bewundernswert, weil sie sehr gut gemacht sind. Ein Gemälde kann inhaltlich fad sein, und doch bereiten Komposition und Farbhandhabung Genuss. Ein Film kann mau dahin dümpeln, aber die Kameraarbeit, oder die Musik oder die Darstellungskunst eines Schauspielers vermögen zu beeindrucken. Ein Buch mag nur eine belanglose, flache Geschichte erzählen, jedoch versteht es die Sprache uns zu fesseln.
Manche Medienwerke sind bewundernswert, weil sie sehr gut gemacht sind. Ein Gemälde kann inhaltlich fad sein, und doch bereiten Komposition und Farbhandhabung Genuss. Ein Film kann mau dahin dümpeln, aber die Kameraarbeit, oder die Musik oder die Darstellungskunst eines Schauspielers vermögen zu beeindrucken. Ein Buch mag nur eine belanglose, flache Geschichte erzählen, jedoch versteht es die Sprache uns zu fesseln.
Umgekehrt gibt es Werke, die zuallererst durch eine brillante, umfassende, neue Perspektiven eröffnende Idee auffallen. Der Amerikaner Max Brooks (1972) hat es mit seinem »World War Z – An Oral History of the Zombie War« vollbracht, mich dementsprechend umzuhauen, meinen respektvollen Neid und somit meine Begeisterung zu entfachen, indem er die in den letzten Jahren schier unübersichtlich angewachsene Epidemie von Zombiestoffen um ein grenzgeniales Meisterstück bereicherte.
Wermutstropfen und Grund zu Uffregung über hiesige Lektorat- und/oder Vermarktungsentscheidungen: Der deutsche Titel, »Wer länger lebt, ist später tot – Operation Zombie«, mit dem der Goldmann-Verlag das Buch bei uns in die Läden schickt, legt irrigerweise nahe, dass man es zuvörderst mit einem locker-schwarzhumorigen Schmunzel-Witzebuch zu tun hat. Auch wenn Humor in Max Brooks Zombie-Buch durchaus hie und da durchschimmert (kein Wunder, ist er doch der Sohn von Mel Brooks und Anne Banecroft), handelt es sich dabei doch mehr um bitter-galligen Humor.
Zombies: diese herzig-schaurigen Mob-Monster haben sich etwa mit dem Beginn des neuen Milleniums wunderbar zu einer Großmetapher für Spannungen und Probleme der so genannten Globalisierung gemausert. Wir erinnern uns: die ›klassischen‹ Zombies ab den Fünfzigern/Sechzigern waren ziemlich träge und ließen sich prima als phantastische Horror-Illustration für willenlose Konsumenten- und Konformationsträgheit deuten.
Die moderne Zombies seit der Jahrtausendwende aber rennen geschwind den lebenden Hirnträgern nach (wie im Remake von »Dawn of the Dead«, in »28 Days Later«), und entwickeln sogar Ansätze von Kooperation und Deduktion (wie in »Land of the Dead«). Verschiedentlich wurden diese flinkeren, wütenden Zombies durchaus einleuchtend als Metapher für ebenso zornige Globalisierungskritiker gedeutet. Jedoch, finde ich, liegt darin eine interessante Doppel- wenn nicht Vieldeutigkeit, denn Zombies können eben für alles mögliche stehen: willenlose Hinterherläufer (»Keiner will denken, aber alle wollen Menschenfleisch fressen. Ich auch.«), wütende Rebellen (»Wir sind die ehemaligen Konsummondkälber die wegen schlechter Arthaltung jetzt mit Tollwutgeifer zurückbeißen«), entmenschlichte Egoisten (»Schießt ruhig. Hauptsache, ich krieg Menschenfleisch«) und und und.
Zwar bleiben die Zombies bei Max Brooks dem klassischen Zombiebild treu, aber seine dolle Idee, mit der er dem Genre enorm viel Neues abgewinnt, wiegt das locker auf (wobei ich zweifele, dass es bei Brooks’ Buch überhaupt einen gröberen Makel gibt, den es wett zu machen gilt). Normalerweise spielt die große, nation-, kontinent- oder weltweite Untoten-Pandemie eine dekorative Rolle im Hintergrund von Zombiegeschichten. Üblicherweise begleitet eine solche Geschichte über einen kurzen Zeitraum eine Handvoll Menschen, wie die sich eher schlecht als recht in einer Welt durchschlagen, -ballern, und -schnetzeln, in der plötzlich die Toten mit großem Hunger herumwackeln.
 Brooks erklärt im Vorwort von »World War Z«, dass er nach dem großen Zombiekrieg von den Vereinten Nationen beauftragt wurde, einen Bericht über selbigen zu schreiben. Allerdings haben seine Vorgesetzten gemosert, sein Manuskript enthielte zu viel »menschelnde Anteile«, man wolle nur die harten, kalten Fakten, die Zahlen. Mitnichten wolle man es aber Brooks verbieten, das Material seiner Interviews in einem eigenen Buch zu verarbeiten. Dieses Buch halten wir Leser nun in Händen. Brooks nimmt sich selbst zurück und präsentiert uns in 58 Studs Terkel-artigen Interviewtranskripten[01] eine ungewöhnlich facettenreiche Geschichte des weltweiten Zombiekrieges.
Brooks erklärt im Vorwort von »World War Z«, dass er nach dem großen Zombiekrieg von den Vereinten Nationen beauftragt wurde, einen Bericht über selbigen zu schreiben. Allerdings haben seine Vorgesetzten gemosert, sein Manuskript enthielte zu viel »menschelnde Anteile«, man wolle nur die harten, kalten Fakten, die Zahlen. Mitnichten wolle man es aber Brooks verbieten, das Material seiner Interviews in einem eigenen Buch zu verarbeiten. Dieses Buch halten wir Leser nun in Händen. Brooks nimmt sich selbst zurück und präsentiert uns in 58 Studs Terkel-artigen Interviewtranskripten[01] eine ungewöhnlich facettenreiche Geschichte des weltweiten Zombiekrieges.
Auch ohne Zombies böte Brooks Buch genug Grusel, denn es scheut sich nicht, konkrete Mißstände zu beschreiben, die auf enthemmtem Nutzen des globalen Handels- und Kommunikationsnetzwerkes gründen. So hat die Zombieseuche markanterweise ihren Ursprung irgendwo im Herzen Chinas. (Regelmäßig trachten Apokalyptiker danach, uns Erstweltbürgern heiligen Schrecken vor einem gedankenlosen »Weiter so!« unseres Zivilisationsstandarts einzuflößen, wenn wir uns der schrecklichen Konsequenzen gewahr werden sollen, dass die lebenstragenden Qualitäten von Mutter Erde schnell gänzlich erschöpft würden, sollten die Menschenmassen Chinas fortfahren mit ihrem Anliegen, unseren Konsum- und Verschwendungslebensstil nachzuahmen.) Die ersten Untoten steigen aus den Wassern eines Stauseegebietes, einem jener künstlichen Fortschrittsgewässer, die den wachsenden Energiebedarf Chinas sichern sollen. Die Chinesen halten die Zombies, wie die gegen sie gerichteten Säuberungsaktionen, natürlich erstmal fatalerweise streng geheim. Auch im weiteren Verlauf des Romanes ist Kritik an bisherigen Praktiken der materiellen und informellen Ressourcehandhabung ein Dauerthema. Die Schattenseiten einer entgrenzten und unzureichend überwachten Logistik schildert ein bald folgendes Interview, in dem ein Assistenz-Arzt erzählt, wie auf der anderen Seite der Welt, in Rio, ein tiefgefrorenes, chinesisches Zombievirus-tragendes Spenderherz (für einen riechen Österreicher über eine Schwarzmarkt-Connection aufgestöbert), für den ersten Zombie in Brasilien sorgt.
Freilich wäre es überspannte Verlobudelung zu behaupten, dass jedes der 58 Interviews eine Gemme für sich ist. Aber richtige Nieten gibt es keine, ja nicht mal seichtes Mittelmaß. Zu den Höhepunkten zählt aber sicherlich die eine kleine Reihe an Gespräche mit dem US-Army-Veteran Todd Wainio, der verschiedene Phasen des vieljährigen Überlebenskampfes gegen die Zombies mit seinen Berichten anschaulich schildert: vom desaströsen Versagen der noch unerfahrenen Streitkräfte beim ersten Kontakt mit einem womöglich millionenköpfigen Zombieschwarm, der sich von New York aus ins amerikanische Landesinnere bewegt, über seine Beurteilung der einige Jahre später erheblich verbesserten Taktik der Antizombiekampfverbände, bis hin zum zähen Wiedererschließen beim langsamen Säubern der aufgegebenen Städte. — Atemlos habe ich die Erlebnisse des als Jungen von der Hiroshimabombe geblendeten Japaners Sensei Tomonaga Ijiro gelesen. Alleine schafft er es trotz seiner Blindheit mittels Bewahrung eines kühlen Kopfes und Vertrauens in die Naturgötter eines Naturschutzgebietes zu überleben. Wahrhaft un-glaub-lich.
Sicher ist, dass Brooks für alle Horror- und Zombiefans exquisite Schock- und Gruselpassagen bietet. Erstaunlich jedoch, dass die typischen Gruseleien eigentlich recht rar (wenn auch geschickt) gesetzt sind. Im Laufe des Buches tritt deutlicher eine andere Art von Grauen in den Vordergrund, die Konfrontation mit den von Brooks vorgeführten menschlichen Abgründen, sowohl individueller wie institutioneller Art. Zum Beispiel, wenn in seinem Arktis-Exil ein gerissener Geschäftemacher zu Worte kommt, der die Furcht vor den Zombies ausnutzte um mit wirkungslosen Impfstoffen noch schnell Geld zu scheffeln bevor alles zusammenbrach; oder wenn die Sträflingssoldaten russischer Zombiesäuberungstrupps die unmenschlichen Disziplinierungstyrannei in ihren Lagern schildern. — »World War Z« gelingt es, dass sich im Hintergrund ein Grauen zusammenballt, wenn so manche dunkle Ahnung und Stimmung beschworen wird, wie es zuginge, (oder in absehbarer Zeit zugehen wird), wenn die zivilisatorischen Polster und Zügel verschwinden, und unzählige Menschenmassen sich wegen virulent ausbreitender Fanatismen, knapper werdenden Rohstoffen und rapide schrumpfenden Überlebensräumen, panisch gegenseitig an die Gurgel gehen.
Kurzum: Ein vielseitig unterhaltsamer Zombietitel, der wegen seiner Sensibilität für gesellschaftliche Probleme und gerade durch sein Augenmerk ›menschlichen Faktor‹ auch für Nicht-Zombiefreunde empfehlenswert ist. Ein wundervolles Beispiel dafür, wie man mit phantastischen Großmetaphern spielerisch und zugleich engagiert über die tatsächliche Welt sprechen kann.
•••
ANMERKUNGEN:
[01] Studs Terkel (1912-2008) erwarb sich als Gesprächspartner in unzähligen Interviews den Ruf (ab 1952 fürs Radio, dann auch in Buchform), der Mann zu sein der Amerika interviewte. Als Pionier der »Oral History« veröffentlichte er Gespräche, überwiegend mit »einfachen Menschen« zu Themen wie Jazzmusik, den Zweiten Weltkrieg, alltäglichen Rassismus, die »Great Depression«, Grenzerfahrungen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen. •••
Zurück
•••
Dietmar Dath: »Die Abschaffung der Arten« und eine schöne Unterscheidung
Eintrag No. 525 — Auf der Website zu seinem neuem Buch »Die Abschaffung der Arten« bekommt man ein ausführliches Interview mit dem Autoren Dietmar Dath geboten. Unter anderem führt er dort eine, wie ich finde, sehr verführerische Unterscheidung der drei großen Schubladen des Phantastischen, SF, Fantasy, Horror vor.
{W}as ist das denn eigentlich, Fantasy, im Gegensatz zu den beiden anderen Untergattungen der heutigen Phantastik, Horror und Science Fiction? Fantasy ist diejenige Literatur, die sich mit den Gesetzen, Konsequenzen und Implikationen des magischen Denkens beschäftigt. Das magische Denken — Analogien, Totem, Tabu, Fetisch, Übernatürliches etc.
Im Gegensatz zu den Literaturen, die sich mit dem magischen Denken beschäftigen, steht…
…das wissenschaftliche — Induktion, Deduktion, Hypothesenbildung, Occams Rasierklinge etc. pp.
Dem entsprechend erläuert Dath desweiteren:
Fantasy beschäftigt sich mit Offenbarungen; Science Fiction damit, etwas auf anstrengendere Art herausfinden und anwenden zu müssen. Also nicht: Fantasy ist das Unmögliche, Science Fiction das Mögliche. Sondern: Fantasy will Erkenntnis-Effekte als Überwältigung durch das Nichtverstehbare, Science Fiction will dieselben Effekte als Beeindrucktsein von (durchaus manchmal gewaltigen) Arbeitsergebnissen. Gemeinsam haben die beiden Gattungen allerdings miteinander (und mit dem Horror, in dem es um das auf viszerale [= lat. ›Eingeweide‹ — A.v.Molo] Wirkungen berechnete Erschüttern und manchmal Wiedererrichten von stabilen sozialen, sexuellen und sonstigen Ordnungen geht, weswegen Horrorelemente sowohl in SF wie in Fantasy Platz haben, da sich dieses Problem sowohl magisch wie wissenschaftlich betrachten läßt), daß sie versuchen, vollständige Welten zu suggerieren (nicht »zu erschaffen«, das geht ja nicht, das sagt man nur manchmal als größenwahnsinniges Kürzel so daher).
Auch zum immer noch unermüdlich vorgebrachten Eskapismusvorwurf, mit der man die Phantastik gerne ins Abseits zu stellen trachtet, hat Dietmar Dath eine vorzügliche Replik parat:
Ich fand sehr nett, wie sich der große Wahnsinnige
John C. Wright in der Widmung zu seiner soeben erschienenen Fortsetzung von
A.E. Van Vogts Null-A-Geschichten bei Van Vogt bedankt hat: Dessen Welten, so Wright, seien in Wrights Kindheit diejenigen gewesen, die ihn, den lesenden Jungen, gern empfangen hätten, wenn er sich wieder mal von der andern, der empirischen sozialen Welt verstoßen gefühlt habe. Das ist, entgegen der beliebten Eskapismusschimpfe von Sozialpädagogen und anderen Wirklichkeitsdressurreitern, eine völlig legitime, im Gelingensfall sogar hoch ehrenwerte Leistung phantastischer Literatur oder Kunst. Ich meine, im Ernst, Kinder: Das könnte denen so passen, daß man ihre Scheißwirklichkeit nicht nur nicht verändern können soll, sondern noch nicht einmal das Recht zugestanden kriegt, sich mal eine Weile mit was ganz anderem zu befassen, um nicht komplett abzustumpfen.
NACHTRAG vom Samstag, den 28. Okt. ‘08:
 Nun habe ich den Dietmar Dath endlich mal gesehen, bzw. gehört. Ist ja immer so eine Sache, die einem bei Zweifelsfällen weiterhilft, wenn man (also ich) nicht immer durchblickt, wie ein Autor (eben Dath) etwas meint. Ich tue mir ja zugegebenerweise oftmals schwer damit zu unterscheiden, wann jemand die Wahrheit sagt, und wann er es ernst meint.
Nun habe ich den Dietmar Dath endlich mal gesehen, bzw. gehört. Ist ja immer so eine Sache, die einem bei Zweifelsfällen weiterhilft, wenn man (also ich) nicht immer durchblickt, wie ein Autor (eben Dath) etwas meint. Ich tue mir ja zugegebenerweise oftmals schwer damit zu unterscheiden, wann jemand die Wahrheit sagt, und wann er es ernst meint.
Nun also weiß ich, das Dath so ein ganz schnell Sprechender ist. Leider leider hat er sich die meines Erachtens schwächste Stelle aus »Die Abschaffung der Arten« augesucht, um dem Buchpreispublikum im Literaturhaus zu Frankfurts Schöner Aussicht eine Kostprobe zu bieten.
Bei dem Buch wird ja viel durcheinandergemischt (und der Collageästhetetik nähere ich mich ja erstmal mit einem wohlwollendem Vorurteil, zumal das Buch ja gleich zu Beginn mit einem Motto von Lord Julius aus »Cerebus« aufwartet.). Das liest sich über weite Strecken wie ein Konversationsroman mit Tieren. Ziemlich lustig, wenn z.B. Kunstgalerie-Wichtigtuerei-Gesülze veräppelt wird, oder auch, wenn Dath mittels dem Jounglieren aller möglichen dollen SF-Ideen (oder sollte ich ›Spinnereien‹ sagen?) über die Doofheit der Gegenwart lästert. Immerhin wird als der rote Faden Buches die brenzlige Frage angeboten ›warum den Menschen passiert ist, was ihnen passiert ist‹.
Langweilig und arg verstelzt geriet Daths Roman — tragischerweise ausgerechnet — wenn er anfängt über Liebe und Sex zu schreiben. Da gelingt ihm leider nur alle paar Absätze mal ein mitreissender, nichtpeinlicher Satz (Romeo & Julia wird bemüht, um den selbstgenügsamen Dual-Narzismus eines ehemals männlichen, nun weiblichen Schwanenwesens zu schildern, dass sich in zwei Leiber aufteilen kann, bei Mondlicht! im Bombenkraterteich der Ruine der Uni Princton!).
Es zeichnet sich für mich als Tendenz ab: Als Thesenschleuder und anregender Ideenbäcker ist Dath, wie immer eigentlich, echt ein Genuß. Aber leider krankt seine Erzählerei an Nervigkeit. — Extremst daneben finde ich Daths begeisterte Hillfslosigkeit, wenn seine tierischen Zukunftsbewohner sich die Namen von SF-Autoren aufsagen, und welche dollen Dinge die in ihren Büchern diagnostiziert, vorhergesehen haben.
Ach ja: in Richtung (Schutz)Umschlaggestalter des Suhrkampverlages. Das Cover ist total in Hose gegangen! Hat höchstens Chancen auf den Preis des langweiligsten Covers des Quartals.
Ich gebe bescheid wenn ich mit dem Buch fertig bin (ich bin derzeit auf Seite 319 von 552).
•••
Dietmar Dath: »Die Abschaffung der Arten«; 552 Seiten (122 Kapitel gebündelt in XVIII Abschnitten unterteilt in Vier Sätze), mit Tiervirgnetten von Daniela Burger; Suhrkamp 2008 (gebunden); ISBN: 978-3-518-42021-8
Nick Harkaway: »The Gone-Away World«, oder: Ninjas, wandernde Städte nach dem großen Bumm und eine seltsame Freundschaft
Eintrag No. 521
•••
 Nick Harkaway (1972 geborener Sohn von John le Carre) hat mit »Die gelöschte Welt« einen Debutroman hingelegt, der vollends meinem Verlangen nach kunterbunt-unterhaltsamer ›Anspruchs‹-Literatur gerecht wird. Zuerst aufgefallen ist mir die Sprache. Harkwaways Prosa suhlt sich mit Wonne in den vokabularischen Möglichkeiten, welche dem Englischen zuhanden sind (und ich bin sehr gespannt, wie die deutsche Übersetzung klingen wird), vermischt genussvoll hohe und niedere Ausdruckniveaus verschiedenster Milieus (mit besonderer Parodieaufmerksamkeit für Multi-Corperate-, Militär- und Studentenkneipen-Slang) und zuweilen durchquert man absatzlange Satzgeflechte, die sich durch exquisite Fizzelfreude auszeichnen.
Nick Harkaway (1972 geborener Sohn von John le Carre) hat mit »Die gelöschte Welt« einen Debutroman hingelegt, der vollends meinem Verlangen nach kunterbunt-unterhaltsamer ›Anspruchs‹-Literatur gerecht wird. Zuerst aufgefallen ist mir die Sprache. Harkwaways Prosa suhlt sich mit Wonne in den vokabularischen Möglichkeiten, welche dem Englischen zuhanden sind (und ich bin sehr gespannt, wie die deutsche Übersetzung klingen wird), vermischt genussvoll hohe und niedere Ausdruckniveaus verschiedenster Milieus (mit besonderer Parodieaufmerksamkeit für Multi-Corperate-, Militär- und Studentenkneipen-Slang) und zuweilen durchquert man absatzlange Satzgeflechte, die sich durch exquisite Fizzelfreude auszeichnen.
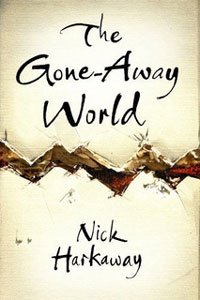 Zur Szenerie: alles beginnt in einer an »Mad Max« oder »Fallout« erinnernden Restwelt damit, dass nach einer Explosion der Strom ausfällt, während der Erzähler und seine Kumpels und Kumpelinnen von der »Haulage & HazMat Emergency Civil Freebooting Company of Exmoor County« Billard in der »Namenlosen Bar« spielen. Irgend jemanden ist es gelungen, mit einem Sabotage-Akt die »Jorgmund Pipe«, das größte und wichtigste Objekt der noch bestehenden Welt empfindlich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Welt wie wir sie kennen ist nämlich, pardauz!, vor einigen Jahren bei einem Nicht-Krieg durch den Einsatz einer neuen, seltsamen Sorte Bomben verschwunden. Die wenigen Überlebenden haben sich zurückgezogen in den schmalen Streifen der »lebenstauglichen Zone«, welche sich an das mächtige Jorgmund Rohr schmiegt. Aus diesem Rohr wird eine mysteriöse Substanz versprüht, welche die monstergebärende Unwirklichkeit auf Abstand hält. Und eben dieses Jorgmund Rohr steht nun in Flammen. Der Erzähler und seine Freunde sind Veteranen des »Un-Krieges«, nach dessen Ende sie wegen unseliger Entwicklungen während der Wiederaufbau-Anstrengungen desertierten. Nun sollen sie als freie Söldner und Transportunternehmer mit einem Haufen dicker Sprengladungen per Vakuumeffekt den Großbrand löschen, um die Welt zu retten. Soweit die Infos des ersten Kapitels, die reich garniert werden mit Abschweifungen beispielsweise zu von Schweinen angetriebenen Notstromgeneratoren und zu den unterschiedlichen Entmenschlichungsgraden von administrativen Schnöseln.[01]
Zur Szenerie: alles beginnt in einer an »Mad Max« oder »Fallout« erinnernden Restwelt damit, dass nach einer Explosion der Strom ausfällt, während der Erzähler und seine Kumpels und Kumpelinnen von der »Haulage & HazMat Emergency Civil Freebooting Company of Exmoor County« Billard in der »Namenlosen Bar« spielen. Irgend jemanden ist es gelungen, mit einem Sabotage-Akt die »Jorgmund Pipe«, das größte und wichtigste Objekt der noch bestehenden Welt empfindlich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Welt wie wir sie kennen ist nämlich, pardauz!, vor einigen Jahren bei einem Nicht-Krieg durch den Einsatz einer neuen, seltsamen Sorte Bomben verschwunden. Die wenigen Überlebenden haben sich zurückgezogen in den schmalen Streifen der »lebenstauglichen Zone«, welche sich an das mächtige Jorgmund Rohr schmiegt. Aus diesem Rohr wird eine mysteriöse Substanz versprüht, welche die monstergebärende Unwirklichkeit auf Abstand hält. Und eben dieses Jorgmund Rohr steht nun in Flammen. Der Erzähler und seine Freunde sind Veteranen des »Un-Krieges«, nach dessen Ende sie wegen unseliger Entwicklungen während der Wiederaufbau-Anstrengungen desertierten. Nun sollen sie als freie Söldner und Transportunternehmer mit einem Haufen dicker Sprengladungen per Vakuumeffekt den Großbrand löschen, um die Welt zu retten. Soweit die Infos des ersten Kapitels, die reich garniert werden mit Abschweifungen beispielsweise zu von Schweinen angetriebenen Notstromgeneratoren und zu den unterschiedlichen Entmenschlichungsgraden von administrativen Schnöseln.[01]
In einer sich über mehrere Kapitel erstreckenden Rückblende berichtet dann der Erzähler von seiner Kindheit: wie er vom Spielplatz weg vom gleichalterigen Gonzo William Lubitsch und seiner Familie adoptiert wurde; wie die beiden Jungs mit viel Hingabe und Talent Kampfsportkünste lernten (wobei Gonzo sich der harten, der Erzähler sich der weichen Schule widmet). Haarsträubende Erzähl-Umwege legen die Historie des »Hauses des Stimmenlosen Drachen« von Meister Wu dar und seiner obskuren Feinde, der Ninjas der »Uhrwerk Zeiger Gesellschaft«. — Der Amateur-Kampfsportler Harkaway ist (zurecht wie ich meine) stolz darauf, einen anspruchsvollen Roman mit Ninjas geschrieben zu haben. Entsprechend bietet »Die gelöschte Welt« atemberaubend inszenierte Kämpfe. Da wird vorgeführt, wie gefährlich Tupperware in den Händen eines einfallsreichen Kampfmeisters werden kann, oder wie selbst ein älteres Ehepaar mit Pheromonen und afrikanischen Bienen einem Pulg gutausgebildeter Meuchelmörder beizukommen vermögen. — Desweiteren geht’s mit Studentenabenteuern (sprich: Kneipenszenen, angeschickerte Politdiskussionen & Beziehungswirren), Anti-Terror-Razzien, Folterverhören durch quasi-staaliche Sicherheitsorgane, und schließlich landen der Erzähler und Gonzo bei der Agentenausbildung des Projekt Albumen, wo sie nicht nur Auto-Kampfsportunterricht erhalten, sondern sich auch die Entwicklungslabore für die Unbombe befinden.
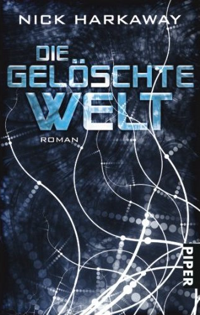 Die im ersten Viertel des Buches hervortretenden politischen Wirren konzentrieren sich in einer Abschweifung wirtschaftliche Begehrlichkeiten auf globaler Bühne, wenn Harkaway über das Hickhack um das fiktive Land Addeh Katir (irgendwo an den Ostausläufern des Himalajas gelegen) sehr trefflich über die finstereren Machenschaften des neoliberalen Großkapitalwahnsinns und fatal-hirnloser internationaler Gierdiplomatie fabuliert. In dieser Fremde geraten der Erzähler und sein Kumpel Gonzo schließlich in die Nicht-Kriegswirren um Addeh Katir, und hier, etwa zur Halbzeit, beginnt sich der Roman endgültig zu einem überwältigenden Pandämonium zu entfalten, wenn wir lernen die Go Away-Bomben zu lieben und das kosmische Grauen aus dem freigesetzten, wankelmütigen »Zeugs«-Gewaber und dem Gestobe menschlicher Träume und Ängste steigt. Durch Go Away-Bombon beraubt man Materie und Wesen ihrer sie in Gestalt haltenden Information und verwandelt sie damit in »Stuff«. Die nichteinkalkulierte Knieschußfolge ist, dass sich dieses »Zeugs« und alles was mit ihm in Kontakt kommt planlos neue Informationen aus der Noospähre[02] zuzelt und dadurch in alles möglich Vorstellbare verwandeln kann.
Die im ersten Viertel des Buches hervortretenden politischen Wirren konzentrieren sich in einer Abschweifung wirtschaftliche Begehrlichkeiten auf globaler Bühne, wenn Harkaway über das Hickhack um das fiktive Land Addeh Katir (irgendwo an den Ostausläufern des Himalajas gelegen) sehr trefflich über die finstereren Machenschaften des neoliberalen Großkapitalwahnsinns und fatal-hirnloser internationaler Gierdiplomatie fabuliert. In dieser Fremde geraten der Erzähler und sein Kumpel Gonzo schließlich in die Nicht-Kriegswirren um Addeh Katir, und hier, etwa zur Halbzeit, beginnt sich der Roman endgültig zu einem überwältigenden Pandämonium zu entfalten, wenn wir lernen die Go Away-Bomben zu lieben und das kosmische Grauen aus dem freigesetzten, wankelmütigen »Zeugs«-Gewaber und dem Gestobe menschlicher Träume und Ängste steigt. Durch Go Away-Bombon beraubt man Materie und Wesen ihrer sie in Gestalt haltenden Information und verwandelt sie damit in »Stuff«. Die nichteinkalkulierte Knieschußfolge ist, dass sich dieses »Zeugs« und alles was mit ihm in Kontakt kommt planlos neue Informationen aus der Noospähre[02] zuzelt und dadurch in alles möglich Vorstellbare verwandeln kann.
Die zweite Hälfte des Romanes schildert die Ereignisse nach dem Un-Krieg, wenn die Reste der überlebenden Menschheit improvisierend mit Hilfe der zugänglichen technischen Großmitteln der zur Unwirklichkeit gewordenen Erde Überlebenszonen abtrotzt, kurz: das besagte Jorgmundrohr wird errichtet. Das lässt die dabei gebildete Jormundfirma zum alleinigen unheimlichen Weltherrscher der wenigen Komfortzonen alten Stils aufsteigen, und wahrhaft erschreckend sind die Grundlagen ihres Erfolges. — Nach der Rettungsaktion, zu welcher man im ersten Kapitel aufbrach, wird der Erzähler von seinen Kumpanen getrennt und er bricht auf zu einer Queste, um die dunklen Geheimnisse der Jorgmundfirma zu enthüllen, aber auch, um die Rätsel seiner zweifelhaften Freundschaft mit Gonzo Lubitsch und schließlich die trügerische Natur seiner eigenen Existenz zu ergründen.
Durch all diesen quirligen Garn zieht sich auch ein frech-zarter romantischer Faden der verhäkelt ist mit Elisabeth, der Adoptivtochter von Meister Wu. Hier ist auch eine interessante Argumentationsebene eingebettet, in der ergründet wird, was kraftmeierische Helden eigentlich liebeswürdig macht. Zudem ziehe und werfe ich meinen Hut johlend vor Begeisterung, immer wenn Harkaway einen anarchistisch-ulkigen Trupp Pantomimen auftreten lässt, über seine Idee und Schilderung eines Zirkus von Aussteigern, die sich Egalität halber alle K. nennen; wegen Zaher Bey, Pirat und Widerstandskämpfers von Addeh Katir; sowie wegen einem mit Safran handelndem, extrawortgewaltigem, dauerstreitendem Ehepaar. Die amüsanten Auftritte all dieser Figuren, und die stets gegenwärtige Schlagfertigkeit der Gedanken des namenlos bleibenden Erzählers ließen mich willig mit Milde über die zwei, drei dreisteren Hau Ruck-Kniffe des Handlungsverlaufes hinwegsehen, welche das ›In die Irre führen der Leser‹-Spiel des Romanes zumutet. Wer derartige Herausforderungen einzugehen gewillt ist, dem wird anhand dieses
Fantasyromans für Leute, die normalerweise Fantasy scheuen
[03]vorgeführt, wie vorzüglich produktiv sich reißerische Äktschn, relevante Satire, kosmisches Grauen und spekulierende Fabulierlust miteinander verschränken lassen.
(P.S.: Die Umschlaggestaltung der UK-Ausgabe ist perfekt. Hier geht es zu einer kleinen Flickr-Dokumentation der Entwicklungsgeschichte des Covers.)
•••
ANMERKUNG:
[01] Hier als Beispiel für Harkaways Systemsatire eine Zusammendampfung seiner Schreibtischhengst-Klassifizierung:
Typ M bis E: wirkliche Menschen die kreischend der seelenverschlingenden professionellen Beamtenpersona entkommen wollen;
Typ D: kecker Möchtegern-Zahlmeister mit verkümmerter Menschlichkeit;
Typ C: glucksender Lakai des entmenschlichenden Systems;
Typ B: herzlose bürokratische Maschine;
Typ A: wäre eine Person, die derart umfassend von den Mechanismen des Systems für das er oder sie arbeitet aufgesogen wurde, dass die Person aufgehört hätte eine eigenständige Wesenheit zu sein. •••
Zurück
[02] Noosphäre (in etwa:
›Welt der Gedanken‹) ist ursprünglich die Wortschöpfung eines heilsgeschichtlich überspannten Jesuiten aus den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts, entsprechend theo- und teleologisch aufgebrezelt als Phase des kollektiven Menschengeistes auf dem Weg zum Omegapunkt, das heißt, dem am Jüngsten Tage wiedererscheinenden Christus. Die weltlich-mildere, heute gebräuchlichere Bedeutung bezeichnet mit Noosphäre schlicht die Welt der Ideen und denkbaren Gedanken. •••
Zurück
[02] So Harkaway selbst in einem Interview über seinen Roman. Man darf das auch lesen als Empfehlung des Romanes für
»Fantasyfreunde, die die Schnauze voll von Formel-Fantasy haben«. Wobei das Wort
›Fantasy‹ sich hier als
›Phantastik‹ sinnvoller begreifen lässt, und weniger als
›Fantasy‹ im Sinne von
›aufgewärmte Mittelalterromantisierung mit Offenbarungsglasur‹. •••
Zurück
•••
Austin Grossman: »Soon I Will Be Invincible«, oder »Dr. Impossible schlägt zurück«
Eintrag No. 519 — Kurze Meldung zu einem Buch, das ich Ende letzter Woche bei meinem Frankfurter Lieblingsbuchladen »Readers Corner« am Eschenheimer Turm entdeckt habe.
Typische Comic-Stoffe in Prosa zu erzählen ist ja eine spezielle Genre-Phantastik-Kunst für sich. Gibt nicht so viele Autoren, von denen ich sagen kann, dass sie sowohl die entsprechenden Schreibkniffe souverän beherrschen als auch die notwendige Extraportion wahnwitziger Einfälle dazu mitbringen (beispielsweise Kim Newman mit seinen »Anno Dracula«- und »Demon Download«-Bänden, Neil Gaiman mit »American Gods« und »Anansi Boys«, Stephen Fry mit »Der Sterne Tennisbälle« und Hugh Laurie mit »Der Waffenhändler«). Der aus der Computerspiele-Branche kommende Amerikaner Austin Grossman legt mit »Soon I Will Be Invincible« ein beeindruckendes und kurzweiliges Debut hin. Auf grad mal 280 Seiten reißt er ein munter geschriebenes Superhelden-Abenteuer vom Zaun, für das man als Comic viele viele Einzelheftchen zusammenstellen müßte. Dabei folgt er mit großem Geschickt der Tradition von Marvell und DC; versteht es mit Können, die ernsten und berührenden Untertöne anklingen zu lassen, durch welche sich die besseren Superhelden-Comics auszeichnen; nimmt aber auch beherzt die typischen Macken und Formeln dieses sehr amerikanischen, mittlerweile aber globalen Genres aufs Korn.
Kurz: die perfekte Lektüre für alle, die gerne mal eine richtig gute, umfangreiche Superhelden-Geschichte als Prosa lesen wollen.
Kapitelweise abwechselnd erzählen zwei Figuren. Zum einen die neue im Team der Guten, der weibliche Robocob Fatal (Andreas Eschbachs »Der letzte seiner Art« … duck dich und nimm dies!!!). Aber den Anfang macht der im Sondergefängnis einsitzende Doctor Impossible, ein Erzbösewicht der schon x Mal scheiterte, die Weltherrschaft an sich zu reissen. So klingt der Beginn in meiner schnellen Übersetzung:
Am heutigen Morgen befinden sich eintausendsechshundertachtundsechzig außergewöhnliche, überbegabte oder auf andere Art mit Superkräften gesegnete Personen auf dem Planeten Erde. Einhundertundsechsundzwanzig von ihnen führen ein normales Leben als Zivilisten. Achtunddreissig sind in Forschungseinrichtungen des Verdeitigungsministeriums oder entsprechender Institute des Auslands untergebracht. Zweihundertundsechsundzwanzig sind Wasserbewohner, angewiesen auf ein Leben in den Ozeanen. Neunundzwanzig sind strikt ortsgebunden — mächtige Bäume und Genii Loci, wie die Große Sphinx oder die Pyramiden von Gize. Funfundzwanzig sind mikroskopisch (einschließlich der Infintisimalen Sieben). Drei sind Hunde; vier sind Katzen; einer ein Vogel. Sechs bestehen aus Gas. Einer ist ein sich bewegendes elektrisches Phänomen, mehr eine Wettererscheinung als eine Person. Siebenundsiebzig sind außerirdische Besucher. Achtunddreissig gelten als verschollen. Einundvierzig sind aus dem Zusammenhang der Realität herausgerissen worden, ständige Emigranten in alternativen Wirklichkeiten und abgezweigten Zeitströmen der Erde.
Sechshundertundachtundsiebzig nutzen ihre Kräfte um Verbrechen zu bekämpfen, während vierhundertundeinundvierzig sie einsetzten um Verbrechen zu begehen. Vierundvierzig sind gegenwärtig in speziellen Sicherheitseinrichtungen für außergewöhnliche Kriminelle eingesperrt. Es ist beachtenswert, dass ungewöhnlich viele von diesen Letztgenannten einen IQ von 300 und höher haben — achtzehn, um genau zu sein. Einschließlich mir selbst.
Die irre doll gestaltete Flash-Site zum Roman bietet ausführlicher viele der Hintergrundinfos, die knapper auch als Anhang des Buches dienen (Auszüge aus der Metahuman-Datenbank und eine Chronologie). Als besonderes Zuckerl bietet die Taschenbuchausgabe von Penguin auch wunderschöne Illustrationen des Zeichners Bryan Hitch.
21. März. 2009, EDIT:
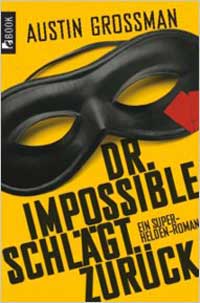 Der Roman ist nun, wie tkl freundlicherweise bescheid gibt, auch auf Deutsch erschienen. Anders als tkl finde ich die Umschlaggestaltung gar nicht schlecht, sondern sogar ganz okey. Nicht super, aber eben auch nicht schlimm. — Ungewöhnlich, dass »Dr. Impossible…« bereits im Oktober 2008 als eBook auf Deutsch erschienen ist (un dich habs verpennt), und jetzt im Mai 2009 als Taschenbuch folgt (und bald auch latürnlich als gekürztes 4-CD-Hörbuch, gelesen von Ralf Schmitz & Annette Frier).
Der Roman ist nun, wie tkl freundlicherweise bescheid gibt, auch auf Deutsch erschienen. Anders als tkl finde ich die Umschlaggestaltung gar nicht schlecht, sondern sogar ganz okey. Nicht super, aber eben auch nicht schlimm. — Ungewöhnlich, dass »Dr. Impossible…« bereits im Oktober 2008 als eBook auf Deutsch erschienen ist (un dich habs verpennt), und jetzt im Mai 2009 als Taschenbuch folgt (und bald auch latürnlich als gekürztes 4-CD-Hörbuch, gelesen von Ralf Schmitz & Annette Frier).
Übersetzt hat den Roman Jürgen Langowski. Ich bin gespannt. Die Leseprobe läst mich ein wenig zittern, denn da finden sich in dem ersten Absatz schon einige komische Verrenkungen, die mir eine Spur zu umständlich dünken (trau ich mich mal als Just-For-Fun-Übersetzer zu kritteln); Lösungen wie ›Verteidigungsministerium oder dessen ausländischen Äquivalenten‹ und ›Spezialgefängnissen für verstärkte Kriminelle‹.
Noch gespannter bin ich freilich, wie Langowski den von mir überaus hoch geschätzten Nick Harkaway und dessen »The Gone-Away World« gemeistert hat (die Übersetzung soll im Herbst 2009 bei Piper-Taschenbuch erscheinen).
•••
Austin Grossman:
»Soon I Will Be Invincible« (2007), 3 Teile, 21 Kapitel, 287 Seiten, Penguin Paperback 2008; ISBN: 978-0-141-03077-7.
Deutsch: »Dr. Impossible schlägt zurück«; aus dem Amerikanischen übertragen von Jürgen Langowski; 400 Seiten; Droemer/Knauer (eBook 2008) Taschenbuch 2009; ISBN: 978-3-426-50045-3.
Alan Campbell: »Scar Night«, oder: Rumgehänge in Deepgate
Eintrag No. 518 — Schluß mit der unseligen Sendepause hier und rein ins Abenteuer mit noch schneller und noch schlampiger hingerotzten Beiträgen. Heute, passend zur Saison, gibt’s was über meine Sommerlektüren. Dreimal hatte ich Glück in den letzten Wochen (ich hoffe, die fälligen knappen Empfehlungen hier bald nachreichen zu können), aber nun der vierte Griff ging daneben. Gegenwärtig ist meine Leselust sogar versandet, etwa nach zwei Dritteln des ersten Bandes der im Werden befindlichen »Kettenwelt«-Trilogie. Eine mächtig heruntergekommene Dunkelfantasy-Höllenwelt ist da der Phantasie des Schotten Alan Campbell, einem der Schöpfer des edlen Computerspielekunstwerkes »Grand Theft Auto«, als Debut entsprungen.
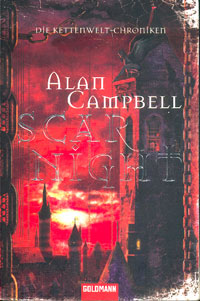 Obwohl ich eine Abneigung für Serienwerke hege, habe ich mir diesenTitel angeschafft, weil ich durchaus neugierig bin, was die Fantasy-Moden der jünstvergangenen Jahre so bieten. In den letzten etwa 24 Monaten habe ich schon in einigen anderen Eröffnungsbänden neuer, oftmals als innovativ gepriesener Fantasy-Reihen geschmökert, pausiere aber bei allen etwa mittig, nicht etwa, weil all diese Werke mau sind, sondern weil ich schnell mal bei geeigneten Ruhephasen einer Geschichte ein Buch länger zur Seite lege. So warten beispielsweise Bücher von R. Scott Bakker (»The Darkness That Comes Before«), Steven Erikson (»Gardens Of The Moon«) und George R. R. Martin (»A Game Of Thrones«) noch darauf, dass ich mich mit ihnen zu Ende vergnüge. Bei Campbell bin ich allerdings dieser Tage schwer am hadern, ob ich dessen Trum überhaupt noch fertig lese.
Obwohl ich eine Abneigung für Serienwerke hege, habe ich mir diesenTitel angeschafft, weil ich durchaus neugierig bin, was die Fantasy-Moden der jünstvergangenen Jahre so bieten. In den letzten etwa 24 Monaten habe ich schon in einigen anderen Eröffnungsbänden neuer, oftmals als innovativ gepriesener Fantasy-Reihen geschmökert, pausiere aber bei allen etwa mittig, nicht etwa, weil all diese Werke mau sind, sondern weil ich schnell mal bei geeigneten Ruhephasen einer Geschichte ein Buch länger zur Seite lege. So warten beispielsweise Bücher von R. Scott Bakker (»The Darkness That Comes Before«), Steven Erikson (»Gardens Of The Moon«) und George R. R. Martin (»A Game Of Thrones«) noch darauf, dass ich mich mit ihnen zu Ende vergnüge. Bei Campbell bin ich allerdings dieser Tage schwer am hadern, ob ich dessen Trum überhaupt noch fertig lese.
Andererseits habe ich entegegen meiner sonstigen Gewohnheiten bei »Scar Night« mal zur deutschen Übersetzung gegriffen habe, und, mannomann, das Radebrech des Buches dient mir bei masochistisch-ermatteten Anwandlungen als willkommen kreislaufanregende Gemüts-Raspel. — Ahhh, wie munternachend der Schmerz doch ist! Die Pein versichert mir, dass ich noch lebe und noch nicht geschmolzen bin bei den äquatorialen Temperaturen!! Hosianna, ich leide!!! — Diese etwas perverse Lesehaltung fügt sich, wie ich meine, ganz gut zu einem mit entsprechendem Passions-Trash vollgestopftem Düsterszenario.
Im Moment bin ich bis zum Ende des zweiten der drei Teile der insgesamt 607-Seiten-Strecke des ersten Bandes gedümpelt (Teil 1: Lügen, Kap. 1-10; Teil 2: Mord, Kap. 11-22; Teil 3: Krieg, Kap. 23-33). Ich kann lediglich berichten, wie für mich der Einstieg in die Kettenwelt-Chroniken war, und was in den ersten beiden Akten bisher aufgefahren wurde. — Mit dem Einstieg wird gleich klar, dass hier der ganz große, episch-kriegerische Rahmen aufgespannt wird. Im achtseitigen Prolog beobachtet ein Priesterfuzzi sorgenvoll, zig Tempel-Assassinen einen Turm bestürmen, weil darin ein weiblicher Engel auf Remmidemmi-Amokkurs wütet. Die Szene endet, ohne dass man groß Schlau aus der Situation wird. Schnitt und Zwischentitel: ›Zweitausend Jahre später.‹ — Pflichtgemäß setzt das erste Kapitel nun sachte (sprich: fad) an, mit dem jugendlich-unschuldigen Protagonist Dill, seines Zeichens ein Erzengel, letzter in langen Linie von heiligen Tempeldienern. Ums kurz zu machen: die Art, wie Dill als Treuherzi aus dem Turmzimmer durch die allerseits verrostete, verdreckte und von Efeu überrankte Stadt Deepgate tüdelt, nervt. Da hilft es auch nix, dass er Mitgefühl für Schnecken hat, oder dass er mit seinem Erzengelschwert vor dem Spiegel coole Posen übt. Überhaupt: der Roman wird erdrückt von zu vielem gewollt Coolem, was um so misslicher erscheint, da man mit Campbells meist platter Schreibe ein Metaphern-Bullshitbingo de luxe spielen kann. Ob das schon im Original so ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich wurde durch die Übersetzung von Jean Paul Ziller dieses Übel aber eher noch intensiviert, beispielsweise wenn Figuren sich statt ›fester‹ eben ›härter‹ abstoßen. Sicher bin ich mir in meinem Urteil, dass die Schmerz-, Verfalls- und Düsternis-Athmo des Buches sich so gar nicht mit den immer wieder eingestreuten (sarkastisch-zynischen) Witzelein verträgt. »Scar Night« wäre ein sehr respektable Leisrtung, wenn es ein Teenager geschrieben hätte. Tatsächlich dürften Teenager (ob tatsächliche oder solche im Geiste) auch die Hauptzielgruppe dieses Titels sein. — Bleibt mir nur, einzugestehen, dass mein innerer Teenager zwar durchaus mit einigen Themen und Athmos sympatisiert, aber letztendlich enttäuscht wurde vom fehlenden erzählerisch-sprachlichen Raffinesse und den sich auf fatale Art ergänzende, nämlich sich gegenseitig schwächenden Stimmungs-Strömungen des Buches.
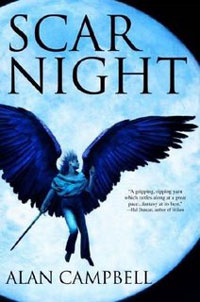 Wie dem auch sei. In Teil 1, wird mir erstmal die an Ketten über einem Abgrund hängende Stadt Deepgate vorgestellt. (Notiz: Entweder es liegt an meiner Blödheit, dass ich die Erklärung überlesen habe, oder es wird wirklich nicht klar dargestellt, woran die Ketten oben befestigt sind.) Da wimmelt es von Stadtteilnamen, die mal aufdringlich sprechend mal nichtssagend sind. Eine Figur, Mr. Nettle, einen hühnenhaften Lumpensammler, begleite ich als Leser ein zähes Kapitel lang, wie er den Leichnam seiner von einem Unbekannten ermoderten Tochter zum Tempel trägt (inklusive Klischee-Begegnungen mit kriminellem Gesindel, darunter »…ein schwerer Karl, mit dem Gesicht eines Taschendiebes«, blinden Bettlern und gerissenen Blumenverkäufern). — Die Toten von Deepgate werden nämlich durch die Tempelmanschaft zeremoniell in den Abgrund gekippt. Das erklärt sich mit dem geschichtlichen Hintergrund der herumhängenden Stadt: Vor tausenden von Jahren fand ein Himmelskrieg statt, bei dem einige Erzengel unter der Führung von Ulcis gegen die Himmels- und Muttergöttin Aylen revoluzzten, jedoch unterlagen. Seitdem warten die gefallenen Engel in der Abgrundstadt Deep und lassen sich von den darüber baumelnden Bewohnern Deepgates verehren. Das Manegement dafür liegt bei der Kirche, geleitet von einem alten Prespyter (über den dauernd gesagt werden muss, dass er alt, senil und zerbrechlich wirkt, oder zumindest, dass er diesem Eindruck absichtlich Vorschub leistet). Ziemlch bald wird geklärt, dass die Kirche mit ihrem imperial-militärischem Apperat alles andere als eine heilsbringende, gütige Herrschaft ausübt. Es wimmelt nur so von bratzig gerüsteten heiligen Kriegern, Tempelwachen, und oben schon angesprochenem ›Rückgrad‹ der schlagenden Kirche, dem Assassinenorden der ›Spine‹. Unten in Deep warten die gefallenen Engel der Zeit ihrer Rache entgegen und sammeln fleißig die Seelen der Runtergekippten für ihr Heer, oben dezimieren die Unterdrückertruppen von Deepgate von Luftschiffen aus mit Giftgas, Brandbomben und Viren die umliegenden primitiven Stämme.
Wie dem auch sei. In Teil 1, wird mir erstmal die an Ketten über einem Abgrund hängende Stadt Deepgate vorgestellt. (Notiz: Entweder es liegt an meiner Blödheit, dass ich die Erklärung überlesen habe, oder es wird wirklich nicht klar dargestellt, woran die Ketten oben befestigt sind.) Da wimmelt es von Stadtteilnamen, die mal aufdringlich sprechend mal nichtssagend sind. Eine Figur, Mr. Nettle, einen hühnenhaften Lumpensammler, begleite ich als Leser ein zähes Kapitel lang, wie er den Leichnam seiner von einem Unbekannten ermoderten Tochter zum Tempel trägt (inklusive Klischee-Begegnungen mit kriminellem Gesindel, darunter »…ein schwerer Karl, mit dem Gesicht eines Taschendiebes«, blinden Bettlern und gerissenen Blumenverkäufern). — Die Toten von Deepgate werden nämlich durch die Tempelmanschaft zeremoniell in den Abgrund gekippt. Das erklärt sich mit dem geschichtlichen Hintergrund der herumhängenden Stadt: Vor tausenden von Jahren fand ein Himmelskrieg statt, bei dem einige Erzengel unter der Führung von Ulcis gegen die Himmels- und Muttergöttin Aylen revoluzzten, jedoch unterlagen. Seitdem warten die gefallenen Engel in der Abgrundstadt Deep und lassen sich von den darüber baumelnden Bewohnern Deepgates verehren. Das Manegement dafür liegt bei der Kirche, geleitet von einem alten Prespyter (über den dauernd gesagt werden muss, dass er alt, senil und zerbrechlich wirkt, oder zumindest, dass er diesem Eindruck absichtlich Vorschub leistet). Ziemlch bald wird geklärt, dass die Kirche mit ihrem imperial-militärischem Apperat alles andere als eine heilsbringende, gütige Herrschaft ausübt. Es wimmelt nur so von bratzig gerüsteten heiligen Kriegern, Tempelwachen, und oben schon angesprochenem ›Rückgrad‹ der schlagenden Kirche, dem Assassinenorden der ›Spine‹. Unten in Deep warten die gefallenen Engel der Zeit ihrer Rache entgegen und sammeln fleißig die Seelen der Runtergekippten für ihr Heer, oben dezimieren die Unterdrückertruppen von Deepgate von Luftschiffen aus mit Giftgas, Brandbomben und Viren die umliegenden primitiven Stämme.
Mr. Nettle bleibt der einzige Charakter aus dem einfachen Volk (das sonst nur in Form kurz angerissener, oberflächlicher Figuren als Lückenfüler auftritt), und so muss er alleine alles an Wut auf das Regime und Armutsleiden des im Schmutz darbenden Pöbels zum Ausdruck bringen, was nötig wäre, um die Deepgate-Stadt mit Glaubwürdigkeit zu erfüllen (und natürlich reicht sein Part dazu bei Weitem nicht). — Ansonsten treten neben dem harmlosen Dill und dem alten Presbyter Sypes noch öfter auf:
- Dessen neue Tutorin Rachel, ein kämpfendes Teenager-Mädel aus besserem Hause, dass sich so sehr wünscht durch eine Abhärtungszeremonie zur einer vollwärtigen Spine gemacht zu werden, damit sie, ach, nicht mehr so viel fühlen muss und ganz emotionslose Killermaschine sein darf;
- der fette, bequem-gutmütige Fogwill Crumb, Schlattenschamis des Presbyters;
- Alexander Devon, der oberste Alchemist und Giftmischer von Deepgate, der als eigentlich ganz charismatisch und gewitzt dargestellt wird, wenn er nicht A) wegen Dauerkontermination durch und Selbstversuche mit seinem Handwerkszeug unter schmerzenden und irre machenden Wunden, Schwären und Pusteln leiden würde und B) nicht über dem durch ebensolche malefizische Arbeitstätigkeiten verursachten frühen Verscheidens seiner geliebten Frau wahnsinnig geworden wäre;
- sowie die im Prolog bereits herumwütende Engel-Vampirin Carnival (natürlich im sexy Lederzeug-Dress, und ganzköfper-vernarbt wegen aus Gewissenspein selbstzugefügten Wunden), die sich als monatliche Mörderin ihren Blutzoll aus Deepgates Bevölkerung pickt.
Uff. Je mehr ich hier mich abstrample den Düsterquark von »Scar Night« auseinanderzuklamüsern, desto mehr macht sich Unwiligkeit in mir breit. Statt noch weiter Gefahl zu laufen, die spärlichen Überraschungen und Lichtblicke des Buches zu verraten, schließe ich lieber mit einem kleinem Reigen an stilistisch-sprachlichen Beknacktheiten.
- Seite 12: …klirrte der Stahl: scharfe, wütende Hiebe, wie von einem erfahrenen Metzger, der Fleisch hackt.
- Seite 14: …Schreien aus Schmerz und Angst…
- Seite 19: Verwitterte Türme neigten sich über düstere Hinterhöfe im Bewußtsein ihres beiderseitigen Verfalls.
- Seite 49: Sie {die Schläge} waren so schnell wie das Züngeln der Flammen bei einem Inferno.
- Seite 57: Dill fiel plötzlich ein, dass er nackt war.
- Seite 60: Doch plötzlich fiel es {= warum jemand so blass ist} Dill ein.
- Seite 62: Plötzlich erinnerte sich Dill, woher er ihren Namen kannte.
- Seite 65: …das Wirrwarr kein System dahinter erkennen ließ…
- Seite 66: Es war ein Wirrwarr aus Metall …
- Seite 95: Ganze Heerscharen von Köchen…. Siehe S. 117.
- Seite 103: Das Licht der Fackel ergroß sich über den Boden und brachte den Geruch nach Stroh und Tieren mit sich.
- Seite 103: …führte die Pferde mit peinlicher Aufmerksamkeit…
- Seite 106: …als der Seelenkäfig mit einem respektlos-dumpfen Aufschlag zum Stehen kam.
- Seite 109: Irgendwo in der Ferne schlug der Hammer eines Schmiedes eiserne Noten an.
- Seite 110: …seine Schritte hallten wider wie ein langsamer metallischer Herzschlag.
- Seite 110: …während sein Zorn immer noch wie eine unsichtbare Wolke über ihm schwebte.
- Seite 111: …wo ihre Hufe wie Peitschenhiebe in der Stille widerhallten.
- Seite 117: …ganze Heerscharen von Arbeitern…. Siehe S. 95.
- Seite 118: …ein sonderbares metallisches Seufzen vom Wind…
- Seite 121: …spürte, dass etwas nicht in Ordnung war … ein Gefühl von Grauen … bis er plötzlich, ohne zu wissen warum, zu laufen begann.
- Seite 124: Und plötzlich war er frei.
- Seite 125: Plötzlich bemerkte Dill, dass das raue Atmen aufgehört hatte.
- Seite 144: Speere von Sonnenlicht schossen durch die drohenden Gewitterwolken am niedrigen westlichen Himmel.
Und das sind nur die bei schnellem Lesen gefundenen Stellen aus dem ersten der drei Teile des Buches. — Allen, die sich nach wirklich neuartiger und faszinierender Dark-Fantasy sehnen, sei von »Scar Night« meinerseits dringlich abgeraten. Wer aber glaubt, durchaus Vergnügen an allzumerklich schlechten Büchern und unsäglich zusammengestoppeltem Finsternislulu haben zu können, möge den Griff zu diesem Titel ruhig riskieren. Ich habe gewarnt.
•••
Sergeij Lukianenko: Die »Wächter«-Tetralogie, oder: Von den Einen, den Anderen und den ganz Anderen
Eintrag No. 509
 »Russisch würd' ich genre können«, ist das erste was mir zu Sergeij Lukianenko (*1968) einfällt[01]. Der Mann mit der Schmauchpfeife ist in Russland ein Star der Phantastik. Und er ist ein extrem fleißiger Bursche. Ich kann kein Russisch, Englisch bringt nix, denn in UK/USA hinkt man hinter dem deutschen Veröffentlichungsstand sogar hinterher. Wir, das gute alte Europa (Russland und Moskau einfach mal brüderlich voll-eingemeindet), sind hipper als die Amis. Tja, so schaut’s halt aus, wenn die einstmals in Russland so exotisch-bezaubernde westliche Medienvielfalt mit zwanzig Jahren Verzögerung der Reifung und Mutation aus dem Osten zurückreflektiert wird. Nun hat »Wächter der Nacht« den typisch westlichen Medienindustrieverwertungsweg genommen: die Bücher waren ein Hit, eine Filmtrio wurde konzipiert und der erste Teil ließ nicht nur im Reich des Bären die Kassen klingeln, sondern fand weltweit sein Horror-Fantasy-Publikum. Dennoch, wenn man den ersten »WÄCHTER«-Film mit seinem westlichen Nächstverwandten »Underworld« vergleicht, findet man alle Vorurteile bestätigt: der unter amerikanischer Leitung hergestellte »Underworld« bietet poliertes Design selbst dort, wo’s schmuddelig und grindig wirken soll; die Hauptfiguren bewegen athletisch-lässig ihre knackigen, fitten Körper und gucken mit Kosmetikwerbung tauglichen Gesichtern vom Bildschirm; und die Unterschiede zwischen gewöhnlich und futuristisch/historisch werden stärker übertrieben. Bei den Russen herrscht eine verschwitztere, kaputtere und natürlich auch versoffenere Grundstimmung; die Oberfläche wirkt gewöhnlich-authentischer, auch detailfreudiger, und ich anders als bei »Underworld« hatte ich nicht das Gefühl, dass die Haar- und Make Up-Stylisten gleich ins Bild hetzen, um eine widerspenstige Locke oder eine rebellische Pore zu disziplinieren. In »Underworld« bewohnen Vampire schmucke alte Villen, in der »WÄCHTER«-Tetra schuften Vampire in ‘ner Großmetzgerei und wohnen in einem ziemlich unedlen Gemeindewohnklotz, kurz: verzwickte Plattenbauromantik statt edlem Goth-Lifestyle-Schickimicki. Als Film finde ich sowas wie »Underworld« (oder den noch weitaus beknackt-gekünstelteren »Van Helsing«) ganz vergnüglich, aber als Prosa … ich weiß nicht.
»Russisch würd' ich genre können«, ist das erste was mir zu Sergeij Lukianenko (*1968) einfällt[01]. Der Mann mit der Schmauchpfeife ist in Russland ein Star der Phantastik. Und er ist ein extrem fleißiger Bursche. Ich kann kein Russisch, Englisch bringt nix, denn in UK/USA hinkt man hinter dem deutschen Veröffentlichungsstand sogar hinterher. Wir, das gute alte Europa (Russland und Moskau einfach mal brüderlich voll-eingemeindet), sind hipper als die Amis. Tja, so schaut’s halt aus, wenn die einstmals in Russland so exotisch-bezaubernde westliche Medienvielfalt mit zwanzig Jahren Verzögerung der Reifung und Mutation aus dem Osten zurückreflektiert wird. Nun hat »Wächter der Nacht« den typisch westlichen Medienindustrieverwertungsweg genommen: die Bücher waren ein Hit, eine Filmtrio wurde konzipiert und der erste Teil ließ nicht nur im Reich des Bären die Kassen klingeln, sondern fand weltweit sein Horror-Fantasy-Publikum. Dennoch, wenn man den ersten »WÄCHTER«-Film mit seinem westlichen Nächstverwandten »Underworld« vergleicht, findet man alle Vorurteile bestätigt: der unter amerikanischer Leitung hergestellte »Underworld« bietet poliertes Design selbst dort, wo’s schmuddelig und grindig wirken soll; die Hauptfiguren bewegen athletisch-lässig ihre knackigen, fitten Körper und gucken mit Kosmetikwerbung tauglichen Gesichtern vom Bildschirm; und die Unterschiede zwischen gewöhnlich und futuristisch/historisch werden stärker übertrieben. Bei den Russen herrscht eine verschwitztere, kaputtere und natürlich auch versoffenere Grundstimmung; die Oberfläche wirkt gewöhnlich-authentischer, auch detailfreudiger, und ich anders als bei »Underworld« hatte ich nicht das Gefühl, dass die Haar- und Make Up-Stylisten gleich ins Bild hetzen, um eine widerspenstige Locke oder eine rebellische Pore zu disziplinieren. In »Underworld« bewohnen Vampire schmucke alte Villen, in der »WÄCHTER«-Tetra schuften Vampire in ‘ner Großmetzgerei und wohnen in einem ziemlich unedlen Gemeindewohnklotz, kurz: verzwickte Plattenbauromantik statt edlem Goth-Lifestyle-Schickimicki. Als Film finde ich sowas wie »Underworld« (oder den noch weitaus beknackt-gekünstelteren »Van Helsing«) ganz vergnüglich, aber als Prosa … ich weiß nicht.
Der Weltenbau der »WÄCHTER«-Tetra ist erstmal alles andere als rasend originell: es gibt Magie und die funktioniert mittels des ›Zwielichts‹, einer mehrschichtigen Anderswelt, die sich durch den eigenen Schatten betreten und verlassen lässt. Jedoch: Nur ›Die Anderen‹ können in das Zwielicht wechseln[02], und es wird lange nicht erklärt, was genau die magischen Anderen von gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Bei seinem ersten Aufenthalt im Zwielicht, muss sich der frisch initiierte Andere zwischen Licht oder Dunkel entscheiden: ob er mehr Engel (Gutmensch) oder mehr Dämon (Egoarsch) sein will, und man kann sich dazu entschließen, dem Ruf einer Wache zu folgen. Diese Wachen gibt es aufgrund des ›Großen Vertrages‹, denn vor langer Zeit hatten sowohl die lichten wie die dunklen Anderen genug vom ewigen Heckmeck um die Schicksalshoheit, und diesen Waffenstillstand vereinbart. Damit ist alles beieinander für den seit über tausend Jahren schwärenden kalten Krieg zwischen den einen und den anderen, kompletto mit entsprechendem lästigen Bürokratie- und Vertragsklauselkram, klandestinen oder detektivischen Missionen und Intrigen, die manchmal so verwickelt sind, dass sich die Parteien intern zuweilen selbst austricksen müssen, um den Gegner an der Nase herumzuführen.
Noch bevor der eigentliche Haupttext beginnt, passiert man eingangs der vier Bücher erstmal Bürokratensprech. In Band 1 heißt es:
Der vorliegende Text ist für die Sache des Lichts / des Dunkels dienlich und zur Verbreitung zugelassen. Die Nachtwache / Die Tagwache.
wobei sich dieses Pfortensprüchlein im Fortlauf der Reihe jedesmal leicht wandelt[03], ein deutlicher Zaunpfahlwink, dass Lukianenko nicht im Traum daran denkt, sich in der »WÄCHTER«-Reihe gänzlich auf eine der beiden Seite zu stellen. Das zunehmende Verwischen der vermeintlich klaren Grenzen zwischen Gut und Böse trägt gehörig zum Charme der Bücher bei, vor allem weil man als Leser diese Verkomplizierung durch die Augen des erfrischend gewöhnlichen Ottonormal-Lichten Anton Gorodezki erlebt (der bis auf Abwechslungssprengsel als Ich-Erzähler dient).
Der formale Aufbau ist übersichtlich. Jeder Band enthält drei (mehr oder weniger) in sich abgeschlossene Geschichten[04] , die mit (meist auktorial erzählten) Stimmungs-Prologen beginnen und in 5 bis 8 Kapitel unterteilt sind. Das Jahr, in dem die Bücher auf Russisch zuerst erschienen ist auch das Jahr der jeweiligen Handlung.
 Zu Beginn des ersten Bandes »Wächter der Nacht« (1998) lernen wir Anton als den Hausprogrammierer der Nachtwache kennen. Er ist schon einige Jahre dabei, die Kollegen schätzen ihn als netten Kerl, aber als lichter Magier ist er keine große Wumme. Auffällig unumwunden erinnert die Einteilung der Fertigkeiten der Anderen an Rollenspiel-Erfahrungslevels, und Anton dümpelt zu Beginn im Mittelfeld. In der Eröffnungsgeschichte »Das eigene Schicksal« ist Anton als einsamer Fahnder unterwegs, um Vampire dingfest zu machen, die sich ohne ordnungsgemäße Lizenz über Menschen hermachen. Vampire (ebenso wie Werwölfe automatisch Dunkle) brauchen Blut für ihre Untotenexistenz und damit alles seine Ordnung hat, werden die Lizenzen zum Anknabbern oder Hoppsnehmen von Menschen durch die Lichten der Nachtwache gewährt (oder man greift als Langzahn halt auf Viehzeug und Blutkonserven zurück). Anton ist ein wenig durch den Wind, denn um sich auf die Wellenlänge der gesuchten Vampire einzustimmen, muss er Blut trinken, das er sich mit Hilfe einer im gleichen Plattenbau wohnenden Vampirfamilie besorgt. Ein erster kleiner Höhepunkt für mich, wie Anton sich an seine Bestürzung als frisch eingeweihter Lichter erinnert, als er feststellte, dass seine Nachbarn Vampire sind. Immerhin ist der Teenager Kostja ihm sympathisch, aber Anton kann sich der klaren Frontstellung Lichte vs. Dunkle nicht auf Dauer entziehen, und die Wiedersprüche zwischen Antons Kaderdisziplin als Nachtwachensoldat und der persönlichen Verbundenheit mit seinen Vampirnachbarn spannen sich als großer Bogen durch alle vier Bücher. Bei seiner Suche nach den wildernden Vampiren beobachtet Anton in der Moskauer U-Bahn eine junge Frau, über der (für Andere dank magischem Zwielichtblick zu sehen) ein schwarzer Wirbelsturm tobt, was bedeutet, dass jemand die unbekannte Schönheit, Swetlana, schröcklich heftig verflucht hat. So ein Fluch will sich früher oder später entladen, und der Unglückswirbel über Swetas Kopf ist so ungeheuerlich mächtig, dass bei seinem Ausbruch mindestens ganz Moskau, wenn nicht sogar mehr den Bach runtergehen würde. Und weil Lukianenko ein gut gerüttelt Durcheinander mehrerer Strängen als eine Tugend der »WÄCHTER«-Bücher pflegt, gibt’s als drittes Handlungselement das Gezerre um Igor, einen Jungen mit dem Zeug zum Anderen, denn (!): Eine Prophezeiung macht unter den Anderen die Runde, in der vom Ende des Waffenstillstandes die Rede ist, weil ein außerordentlicher Anderer, ein kommender Messias durch seine Entscheidung für Licht oder Dunkel den Konflikt ein- für allemal für eine der beiden Seiten entscheiden wird. Der junge Igor könnte vielleicht dieser Andere sein. — In der zweiten Geschichte »Der eigene Kreis« wird das Motiv des Wilderers umgekehrt: diesmal ist ein unbekannter Lichter unterwegs der ohne Genehmigung Dunkle killt. Egal welche Art von magischen Eingriff die Lichten oder Dunklen wirken, die Gegenseite hat das Recht zu einer gleichstarken Aktion (und wiederum an Spiele erinnert die haarkleine Gradeinteilung von Zauberspruchstärken, mit der die Balance verrechnet wird). Nach der ersten Geschichte steht Anton im Ruf, ein Lichter mit schmutziger Weste zu sein, und wird der Morde an den Dunklen verdächtigt. Zur Tarnung tauschen zur Wildererhatz er und Olga (die Geliebte von Antons Nachtwachenchef Geser) die Körper. Willkommener Anlass für Gender Studies zum schmunzeln. Zudem erfährt man bröckchenweise mehr über den »WÄCHTER«-Weltenbau. Die groben Verstöße werden von einer dritten magischen Gruppe geahndet, der (Tada!) ›Inquisition‹. — In der dritten Erzählung »Im eigenen Saft« erholt sich Anton größtenteils auf dem Land. Grillparty, Mukke, herzhaft Essen und ordentlich dem Wodka frönen sind angesagt, und ich war überaus begeistert: vom Themen- und Stimmungswechsel, von der hemdsärmelig deftigen und grad deshalb einnehmend menschlichen Art und Weise, wie die Lichten mit ihren Problemen ringen, sich über ihre Existenz als Andere und die Bürden des Wachendienstes beklagen, ihre Ängste und Zweifel aussprechen, sich gegenseitig Mut machen.
Zu Beginn des ersten Bandes »Wächter der Nacht« (1998) lernen wir Anton als den Hausprogrammierer der Nachtwache kennen. Er ist schon einige Jahre dabei, die Kollegen schätzen ihn als netten Kerl, aber als lichter Magier ist er keine große Wumme. Auffällig unumwunden erinnert die Einteilung der Fertigkeiten der Anderen an Rollenspiel-Erfahrungslevels, und Anton dümpelt zu Beginn im Mittelfeld. In der Eröffnungsgeschichte »Das eigene Schicksal« ist Anton als einsamer Fahnder unterwegs, um Vampire dingfest zu machen, die sich ohne ordnungsgemäße Lizenz über Menschen hermachen. Vampire (ebenso wie Werwölfe automatisch Dunkle) brauchen Blut für ihre Untotenexistenz und damit alles seine Ordnung hat, werden die Lizenzen zum Anknabbern oder Hoppsnehmen von Menschen durch die Lichten der Nachtwache gewährt (oder man greift als Langzahn halt auf Viehzeug und Blutkonserven zurück). Anton ist ein wenig durch den Wind, denn um sich auf die Wellenlänge der gesuchten Vampire einzustimmen, muss er Blut trinken, das er sich mit Hilfe einer im gleichen Plattenbau wohnenden Vampirfamilie besorgt. Ein erster kleiner Höhepunkt für mich, wie Anton sich an seine Bestürzung als frisch eingeweihter Lichter erinnert, als er feststellte, dass seine Nachbarn Vampire sind. Immerhin ist der Teenager Kostja ihm sympathisch, aber Anton kann sich der klaren Frontstellung Lichte vs. Dunkle nicht auf Dauer entziehen, und die Wiedersprüche zwischen Antons Kaderdisziplin als Nachtwachensoldat und der persönlichen Verbundenheit mit seinen Vampirnachbarn spannen sich als großer Bogen durch alle vier Bücher. Bei seiner Suche nach den wildernden Vampiren beobachtet Anton in der Moskauer U-Bahn eine junge Frau, über der (für Andere dank magischem Zwielichtblick zu sehen) ein schwarzer Wirbelsturm tobt, was bedeutet, dass jemand die unbekannte Schönheit, Swetlana, schröcklich heftig verflucht hat. So ein Fluch will sich früher oder später entladen, und der Unglückswirbel über Swetas Kopf ist so ungeheuerlich mächtig, dass bei seinem Ausbruch mindestens ganz Moskau, wenn nicht sogar mehr den Bach runtergehen würde. Und weil Lukianenko ein gut gerüttelt Durcheinander mehrerer Strängen als eine Tugend der »WÄCHTER«-Bücher pflegt, gibt’s als drittes Handlungselement das Gezerre um Igor, einen Jungen mit dem Zeug zum Anderen, denn (!): Eine Prophezeiung macht unter den Anderen die Runde, in der vom Ende des Waffenstillstandes die Rede ist, weil ein außerordentlicher Anderer, ein kommender Messias durch seine Entscheidung für Licht oder Dunkel den Konflikt ein- für allemal für eine der beiden Seiten entscheiden wird. Der junge Igor könnte vielleicht dieser Andere sein. — In der zweiten Geschichte »Der eigene Kreis« wird das Motiv des Wilderers umgekehrt: diesmal ist ein unbekannter Lichter unterwegs der ohne Genehmigung Dunkle killt. Egal welche Art von magischen Eingriff die Lichten oder Dunklen wirken, die Gegenseite hat das Recht zu einer gleichstarken Aktion (und wiederum an Spiele erinnert die haarkleine Gradeinteilung von Zauberspruchstärken, mit der die Balance verrechnet wird). Nach der ersten Geschichte steht Anton im Ruf, ein Lichter mit schmutziger Weste zu sein, und wird der Morde an den Dunklen verdächtigt. Zur Tarnung tauschen zur Wildererhatz er und Olga (die Geliebte von Antons Nachtwachenchef Geser) die Körper. Willkommener Anlass für Gender Studies zum schmunzeln. Zudem erfährt man bröckchenweise mehr über den »WÄCHTER«-Weltenbau. Die groben Verstöße werden von einer dritten magischen Gruppe geahndet, der (Tada!) ›Inquisition‹. — In der dritten Erzählung »Im eigenen Saft« erholt sich Anton größtenteils auf dem Land. Grillparty, Mukke, herzhaft Essen und ordentlich dem Wodka frönen sind angesagt, und ich war überaus begeistert: vom Themen- und Stimmungswechsel, von der hemdsärmelig deftigen und grad deshalb einnehmend menschlichen Art und Weise, wie die Lichten mit ihren Problemen ringen, sich über ihre Existenz als Andere und die Bürden des Wachendienstes beklagen, ihre Ängste und Zweifel aussprechen, sich gegenseitig Mut machen.
 »Wächter des Tages« (2000) ist was die Erzählstimmen betrifft die Ausnahme der Reihe. In »Zutritt für Unbefugte erlaubt« hören wir die Stimme der rangmäßigen Gegenspielerin Antons, Alissa, einer dunklen Hexe. Bei dem Kampf um die (Nicht-)Festnahme einer illegal ihre finsteren Magiedienstleistungen anbietenden unregistrierten Hexe, verausgabt Alissa ihre magischen Energien und wird zur Regeneration krimwärts in ein Ferienkamp für Jugendliche geschickt. Dunkle, passend zu ihrer egoistischen Einstellungen vom Recht des Stärkeren, tun sich leichter mit dem Zauberkrafttanken, denn sie nähren sich von schlechten Stimmungen, von Zorn, Hass, Neid und Missgunst der Normalen und intensivieren diese Regungen. Lichte dagegen – die für Uneigenützigkeit und Gemeinwohl fechten – stehlen den Menschen die selteneren Gefühle der Freude, des Glücks und der Liebe. Geschwächt merkt Alissa nicht, dass ihr Hedonismus sie in eine unheilvolle Romanze schlittern lässt (es kommt sogar zu einer milden Pornoszene). — »Fremd unter Anderen« stellt eine neue Besonderheit des Lukianenko’schen Weltenbaus vor, den ›Zwielicht-Spiegel‹. Damit ist ein Ausgleich stiftender Anderer gemeint, den das Zwielicht bei eklatanten Kräfteungleichgewicht zwischen Licht und Dunkel hervorbringt. Höchst beklemmend fand ich es, der Icherzählerstimme des Spiegels Witali zu folgen, der sein Gedächtnis einbüßt hat, als er sich in einem kraftstrotzenden Dunklen verwandelt, und nicht begreift wie ihm geschieht. — Auktoial (also nicht von einer Ich-Stimme, sondern neutral) wird »Eine andere Kraft« erzählt. Nach zwei Geschichten, die auf persönlichere Weise vom intim-psychodynamischen Wechselspiel zwischen Licht und Dunkel berichteten, folgt als Abschluss des zweiten Bandes ein Äktschnhöhepunkt von »Die Hard«-Güte am Flughafen, komplett mit vierköpfiger finnischer dunkler Diebesbande, die eines der brazigsten Artefakte aus einem Sicherheitsdepot der Inquisition geklaut hat: die Kralle des Fafnirs. Ja ganz recht, laut Hintergrund der »WÄCHTER«-Welt war Fafnir ein mächtiger frühmittelalterlicher Anderer.
»Wächter des Tages« (2000) ist was die Erzählstimmen betrifft die Ausnahme der Reihe. In »Zutritt für Unbefugte erlaubt« hören wir die Stimme der rangmäßigen Gegenspielerin Antons, Alissa, einer dunklen Hexe. Bei dem Kampf um die (Nicht-)Festnahme einer illegal ihre finsteren Magiedienstleistungen anbietenden unregistrierten Hexe, verausgabt Alissa ihre magischen Energien und wird zur Regeneration krimwärts in ein Ferienkamp für Jugendliche geschickt. Dunkle, passend zu ihrer egoistischen Einstellungen vom Recht des Stärkeren, tun sich leichter mit dem Zauberkrafttanken, denn sie nähren sich von schlechten Stimmungen, von Zorn, Hass, Neid und Missgunst der Normalen und intensivieren diese Regungen. Lichte dagegen – die für Uneigenützigkeit und Gemeinwohl fechten – stehlen den Menschen die selteneren Gefühle der Freude, des Glücks und der Liebe. Geschwächt merkt Alissa nicht, dass ihr Hedonismus sie in eine unheilvolle Romanze schlittern lässt (es kommt sogar zu einer milden Pornoszene). — »Fremd unter Anderen« stellt eine neue Besonderheit des Lukianenko’schen Weltenbaus vor, den ›Zwielicht-Spiegel‹. Damit ist ein Ausgleich stiftender Anderer gemeint, den das Zwielicht bei eklatanten Kräfteungleichgewicht zwischen Licht und Dunkel hervorbringt. Höchst beklemmend fand ich es, der Icherzählerstimme des Spiegels Witali zu folgen, der sein Gedächtnis einbüßt hat, als er sich in einem kraftstrotzenden Dunklen verwandelt, und nicht begreift wie ihm geschieht. — Auktoial (also nicht von einer Ich-Stimme, sondern neutral) wird »Eine andere Kraft« erzählt. Nach zwei Geschichten, die auf persönlichere Weise vom intim-psychodynamischen Wechselspiel zwischen Licht und Dunkel berichteten, folgt als Abschluss des zweiten Bandes ein Äktschnhöhepunkt von »Die Hard«-Güte am Flughafen, komplett mit vierköpfiger finnischer dunkler Diebesbande, die eines der brazigsten Artefakte aus einem Sicherheitsdepot der Inquisition geklaut hat: die Kralle des Fafnirs. Ja ganz recht, laut Hintergrund der »WÄCHTER«-Welt war Fafnir ein mächtiger frühmittelalterlicher Anderer.
Die zweite Hälfte der Reihe bestreitet dann Anton als Erzähler. Die ersten beiden Bücher zeigten das Spielbrett und die wichtigsten Regeln, nun werden die Detektiv- und Agentenmissionen Antons persönlicher, er steigt zu immer höheren Magier- und Nachtwachengraden auf, und aus dem Eigenbrötler wird durch seine Verbindung mit Swetlana ein Familienmensch und schließlich ein hingebungsvoller Vater[05].
 Mit Beginn von »Wächter des Zwielichts« (2003) rückt der spannungsgeladene Unterschied zwischen Anderen und Normalen in den Vordergrund. Tag- und Nachtwache geben sich gleichermaßen beunruhigt, als sie erfahren, dass ein unbekannter Lichter es wagt, mittels eines als Märchenlegende geltenden Zauberspruchs einen normalen Menschen zu einem Anderen verwandeln zu wollen. Also quartiert sich Anton in »Niemandszeit« als verdeckter Ermittler in einer Wohnanlage für Neureiche ein. — »Niemandsraum« erzählt vom winterlichen Landurlaub Antons und Swetlanas. Nahebei haben ein einige Werwölfe ein paar Kinder im Wald gejagt, aber einer nette unbekannte Hexe mit erstaunlicher Macht hat sie gerettet (die Kinder, nicht die Wölfe). Glanzpartien dieser Geschichte sind Antons Besuch bei der Hexe, wenn diese buchstäblich ihre weibliche Verführungszauberkünste gegen den Ermittler anwendet, und der Zauberkampf-Showdown auf einem Schlachtfeld des zweiten Weltkrieges. — »Niemandskraft« glänzt wieder als flottes Äktschnstück, das mich an James Bond-Situationen erinnerte, inklusive Tätersuche im Zug auf der Fahrt östlich durch den russischen Kontinent, Atombomben als letztes schreckliches letztes Mittel für die Guten, und Showdown im Weltraumbahnhof[06] (WARNUNG: Spoilerfußnote).
Mit Beginn von »Wächter des Zwielichts« (2003) rückt der spannungsgeladene Unterschied zwischen Anderen und Normalen in den Vordergrund. Tag- und Nachtwache geben sich gleichermaßen beunruhigt, als sie erfahren, dass ein unbekannter Lichter es wagt, mittels eines als Märchenlegende geltenden Zauberspruchs einen normalen Menschen zu einem Anderen verwandeln zu wollen. Also quartiert sich Anton in »Niemandszeit« als verdeckter Ermittler in einer Wohnanlage für Neureiche ein. — »Niemandsraum« erzählt vom winterlichen Landurlaub Antons und Swetlanas. Nahebei haben ein einige Werwölfe ein paar Kinder im Wald gejagt, aber einer nette unbekannte Hexe mit erstaunlicher Macht hat sie gerettet (die Kinder, nicht die Wölfe). Glanzpartien dieser Geschichte sind Antons Besuch bei der Hexe, wenn diese buchstäblich ihre weibliche Verführungszauberkünste gegen den Ermittler anwendet, und der Zauberkampf-Showdown auf einem Schlachtfeld des zweiten Weltkrieges. — »Niemandskraft« glänzt wieder als flottes Äktschnstück, das mich an James Bond-Situationen erinnerte, inklusive Tätersuche im Zug auf der Fahrt östlich durch den russischen Kontinent, Atombomben als letztes schreckliches letztes Mittel für die Guten, und Showdown im Weltraumbahnhof[06] (WARNUNG: Spoilerfußnote).
 Im Abschlussband »Wächter der Ewigkeit« (2006) ist Anton dann als Hoher Lichter größtenteils in der Fremde unterwegs. In »Die gemeinsame Sache« soll er einen wildernden Vampir in Edinburgh aufspüren, und macht dabei unangenehme Bekanntschaft mit einem Untergrundkommando abtrünniger Lichter und Dunkler (und ihrer normalsterblichen Helfer), die das allerallermächtigste Artefakt wo’s überhaupt gibt stibitzen wollen: Merlins ›Kranz der Schöpfung‹[07]. — In »Der gemeinsame Feind« recherchiert Anton dann in Samarkand auf einem Schlachtfeld des Krieges der Dunklen gegen die Lichten aus Zeiten, als es noch keinen Großen Vertrag gab, und staunt nicht schlecht, wie locker Tag- und Nachtwachen in der abgelegenen Provinz einander tolerieren. — Das große Finale, »Das gemeinsame Schicksal«, spielt dann wieder zwischen Moskau und Edinburgh und hier erst werden die letzten Rätsel der Zwielicht-Zwiebelschalen entblättert.
Im Abschlussband »Wächter der Ewigkeit« (2006) ist Anton dann als Hoher Lichter größtenteils in der Fremde unterwegs. In »Die gemeinsame Sache« soll er einen wildernden Vampir in Edinburgh aufspüren, und macht dabei unangenehme Bekanntschaft mit einem Untergrundkommando abtrünniger Lichter und Dunkler (und ihrer normalsterblichen Helfer), die das allerallermächtigste Artefakt wo’s überhaupt gibt stibitzen wollen: Merlins ›Kranz der Schöpfung‹[07]. — In »Der gemeinsame Feind« recherchiert Anton dann in Samarkand auf einem Schlachtfeld des Krieges der Dunklen gegen die Lichten aus Zeiten, als es noch keinen Großen Vertrag gab, und staunt nicht schlecht, wie locker Tag- und Nachtwachen in der abgelegenen Provinz einander tolerieren. — Das große Finale, »Das gemeinsame Schicksal«, spielt dann wieder zwischen Moskau und Edinburgh und hier erst werden die letzten Rätsel der Zwielicht-Zwiebelschalen entblättert.
Auffällig und erfrischend fand ich Lukianenkos Aufmerksamkeit für die Oberflächen von Popkultur und globalisierter Konsumgesellschaft. Am deutlichsten führt dies Anton mit seinem MD-Player vor, von dessen Zufallsmodus er sich gern überraschen, inspirieren oder trösten lässt. Schade, dass es noch keine Sammlung der in den »WÄCHTER«-Büchern vorkommenden Mukke gibt, bzw. dass man sich als mit russischer Pop- und Rockmusik Unvertrauter recken und strecken muss, um herauszubekommen, was für einen Musikstil genau Anton gerade hört. Auch die ein oder andere erklärende Fußnote hätte meines Erachtens nicht geschadet. Wenn es in einem Lied heißt[08] …
Du kannst Dich nicht mehr in die Büsche schlagen | Wenn dich der Schuss aus der Lupara fällt
… wäre es schon nett, wenn man als Hilfestellung ausdeutet, dass mit Lupara (Wolfstöter) eine abgesägte Flinte gemeint ist, und nur wenige werden ohne Recherche wohl verstehen, was gemeint ist, wenn Lukianenko mit Namen um sich wirft[09]:
Du bist unterwegs. Unternimmst deine eigene kleine Queste, in dir steckt etwas von Frodo und etwas von Paganel, dann noch ein Tröpfchen Robinson und ein ganz klein wenig von Radischtschnew.
Gut möglich allerdings, dass ich mit diesem Wunsch lediglich typische Allgemeinbildungslücken eines Wessis entblöße. Aber abgesehen von solchen kleinen Rätselstellen, war es eine Wonne, wie und wozu Lukianenko z.B. Auto- und Klamottenmarken, Essen und Getränke, Filme und Popikonen erwähnt.
Vor allem die beiden ersten »WÄCHTER«-Bände greifen merklich die Milleniumshysterie auf, und die durch radikalisierte Ideologien hochgeschaukelten Spannungen zwischen Apokalyptikern und Integrierten. Lukianenko lässt durch seine immer wieder über Gott und die Welt diskutierenden Figuren seine Skepsis gegenüber linken wie rechten Weltbildvernageltheiten raushängen, sorgt sich über die tatsächlich von statten gehenden Großkonflikte, die alle, die Einen, die Anderen und auch die ganz Anderen ins Chaos zu reißen drohen. Normalerweise erwärme ich mich kaum für Gutmenschenlulu, aber Dank der im richtigen Maße rotzigen Schreibe Lukianenkos, reich gewürzt mit tollen Magie-Spezialeffekten und -Kämpfen stimme ich gerne in das Resümee der »WÄCHTER«-Tetra ein, dass ich mit einem Lied umschreiben kann, mit dem schon die Beatles den Blaumiesen Angst einjagten: »All You Need Is Love« … (dann klappt’s auch mit dem Zwielicht).
•••
Alle vier Bände wurden aus dem Russischen übersetzt von Christiane Pöhlmann (mit Hilfe von Erik Simon der einige Liedverse übertrug).
- »Wächter der Nacht« (1998); 528 Seiten; Heyne 2005; ISBN: 978-3-453-53080-5;
- »Wächter des Tages« (2000) zusammen mit Wladimir Wassilijew; 528 Seiten; Heyne 2006; ISBN: 978-3-453-53200-7;
- »Wächter des Zwielichts« (2003); 480 Seiten; Heyne 2006; ISBN: 978-3-453-53198-7;
- »Wächter der Ewigkeit« (2006); 448 Seiten; Heyne 2007; ISBN: 978-3-453-52255-8.
•••
ANMERKUNGEN:
[2] Tja, wem fällt es schon leicht
»über seinen eigenen Schatten zu springen«?•••
Zurück
[3] Band 2:
»Der vorliegende Text ist … abträglich und nicht zur Verbreitung zugelassen«;
Band 3:
»Der vorliegende Text ist … belanglos«;
Band 4:
»Der vorliegende Text ist … akzeptabel«.•••
Zurück
[4] Vergleichbar mit dem Plott einer ca. 60-minütigen TV-Serienfolge, einer Konsolen/PC-Spiele-Mission, oder einem etwa drei Hefte langen US-Comichandlungsbogens. •••
Zurück
[5] Soweit ich von meiner bescheidenen Warte aus überblicke, ist ›echtes‹ familiäres Gemenschel (im Gegensatz zu den Aristokraten-Soaps der ›High Fantasy‹) in der Nicht-Kinder-&-Jugendbuch-Genrefantasy noch etwas ziemliches Seltenes. Aber wen wunderts: haben doch auch auf dem Krimifeld erst mit z.B. Donna Leons Commisario Brunetti und seiner Familienrasselbande entsprechend gewöhnliche Aspekte mit Erfolg ihren Weg ins Genre gefunden. — Meiner Meinung nach ist es ist höchste Zeit, daß solche »banalen« Herausforderungen auch in der Genre-Phantastik vermehrt zur Sprache kommen. Immerhin ist Drachen erschlagen oder die Welt retten Kleinkram im Vergleich zu der Megaqueste Familie. •••
Zurück
[6] Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen aber war für mich in diesem Fall das Scheitern des Bösewichts, denn das von ihm so rigoros verfolgte Endziel portraitiert jugendlichen Idealismus so tragisch-packend, dass dem Teenager in mir zum harten Los des romantischen Weltverbesserers ein paar Tränen über die Wängelchen kullerten. •••
Zurück
[7] Damit man ein Gefühl für den oben erwähnten Prophezeihungs-Plot bekommt: In der »
WÄCHTER«-Welt war Merlin, wie Jesus auch, ein Messias. Viele halten Merlin für den
›Größen Aller Anderen‹, den die Welt je sah. Und: er gehört zu den wenigen Anderen, die ihre Gesinnung geändert haben. •••
Zurück
[9] Band 3, S. 461. Wem Frodo und Robinson nix sagt, sollte eigentlich gar nicht
»Magira« oder mein Blog hier lesen dürfen (
streng guck). Aber wegen Paganel (Figur aus Jules Vernes
»Die Kinder das Kapitän Grant«) und Radischtschnew (russischer Schriftsteller und Philosoph) mußte ich im Infoozean gründeln, um mir ein genaues Bild davon machen zu können, was Lukianenko meint. •••
Zurück
Hal Duncan »The Book of All Hours 1: Vellum«, oder: Die Mythen-Jukebox voll aufgedreht
•••
 Eintrag No. 483 — Nicht vollends von der Hand zu weisen ist der Vorwurf, dass mit dem Schotten Hal Duncan (1971) ein junger Autor auf die Erzählbühne tritt, der sich geradezu versessen nach der ganz irre großen Bedeutung streckt und dabei die Gemütslaken von schamhafteren, zurückhaltenderen Lesern unflätig mit seinen Hirnwichsereien voll sudelt. Wer sich also nicht bekleckern lassen will, möge einen großen Bogen um »Vellum« machen. — Aber den Unentschlossenen und Neugierigen möchte ich folgendes zu bedenken geben (und die nach ästhetischen Exzessen Suchenden können’s als Empfehlung nehmen): stilistisches und ästhetisches Hirnwichsen ist eine sooo schändliche Sache nicht. Immerhin: wie soll und kann Literatur die Herausforderungen durch den Weltensturm an Verunsicherung, dem Scharaden- und Ränkespiel mit interessenstützender Großraumphantastik der Echtwelt begegnen, wenn nicht zum Beispiel mit einer schon ins Unanständige gesteigerten Fabulations- und Mythenmixmanie?
Eintrag No. 483 — Nicht vollends von der Hand zu weisen ist der Vorwurf, dass mit dem Schotten Hal Duncan (1971) ein junger Autor auf die Erzählbühne tritt, der sich geradezu versessen nach der ganz irre großen Bedeutung streckt und dabei die Gemütslaken von schamhafteren, zurückhaltenderen Lesern unflätig mit seinen Hirnwichsereien voll sudelt. Wer sich also nicht bekleckern lassen will, möge einen großen Bogen um »Vellum« machen. — Aber den Unentschlossenen und Neugierigen möchte ich folgendes zu bedenken geben (und die nach ästhetischen Exzessen Suchenden können’s als Empfehlung nehmen): stilistisches und ästhetisches Hirnwichsen ist eine sooo schändliche Sache nicht. Immerhin: wie soll und kann Literatur die Herausforderungen durch den Weltensturm an Verunsicherung, dem Scharaden- und Ränkespiel mit interessenstützender Großraumphantastik der Echtwelt begegnen, wenn nicht zum Beispiel mit einer schon ins Unanständige gesteigerten Fabulations- und Mythenmixmanie?
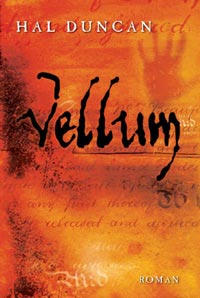 Worum geht’s? Tja, puh, äh, diese Frage überfordert mich ein wenig, denn eine Handlung im üblichen Sinne (eine Geschichte wird von A nach Z erzählt) aus dem heftigen Mythen-Shake und dem fortwährenden Randomwechsel der Zeiten- und Welten-Jukebox herauszulesen, ist nicht so einfach, oh nein. Auf jeden Fall aber kann ich sagen, dass mich der Stil und die in »Vellum« zusammengeschmissenen Themen überwiegend bezaubern. Vom Gebaren her kommt Hal Duncans Roman für mich daher, als ob ein zum rotzig-romantischen Goth-Punk mutiertes »Finnegans Wake«[01] sich ‘ne Acid-Pappe geschmissen hat, um anschließend mörderheftig im Darkroom mit Grant Morrisons Comichelden aus »The Invisibles«[02] zu knutschten, wovon es sich dann erholt, indem es abwechselnd beim Wasserpfeifenblubbern chillt bzw. zu lebhafter Musik abzappelt. — Mit typographischen Besonderheiten, mal links, mal mittig, mal rechts stehende Zwischenüberschriften, werden verschiedene Wirklichkeits-Verfassungen gekennzeichnet, ebenso wie mit dem Wechsel zwischen zwei verschiedenen Serif-Schriftgestaltungen des Fließtextes. In der zweiten Hälfte von »Vellum« kommt es anhand in einer beeindruckenden SF/Cyberpunk-Szenerie auch zu informationstechnologischen Spielereien, die mit kurzen sans serif-Einschüben darstellen, wie sich ein Schwarm mit künstlicher Intelligenz gesegneter Nanopartikel, so genannte Bitmites, durch die verschiedenen Schizoschichten einer Anarchoterroristenpsyche zu hacken versucht.
Worum geht’s? Tja, puh, äh, diese Frage überfordert mich ein wenig, denn eine Handlung im üblichen Sinne (eine Geschichte wird von A nach Z erzählt) aus dem heftigen Mythen-Shake und dem fortwährenden Randomwechsel der Zeiten- und Welten-Jukebox herauszulesen, ist nicht so einfach, oh nein. Auf jeden Fall aber kann ich sagen, dass mich der Stil und die in »Vellum« zusammengeschmissenen Themen überwiegend bezaubern. Vom Gebaren her kommt Hal Duncans Roman für mich daher, als ob ein zum rotzig-romantischen Goth-Punk mutiertes »Finnegans Wake«[01] sich ‘ne Acid-Pappe geschmissen hat, um anschließend mörderheftig im Darkroom mit Grant Morrisons Comichelden aus »The Invisibles«[02] zu knutschten, wovon es sich dann erholt, indem es abwechselnd beim Wasserpfeifenblubbern chillt bzw. zu lebhafter Musik abzappelt. — Mit typographischen Besonderheiten, mal links, mal mittig, mal rechts stehende Zwischenüberschriften, werden verschiedene Wirklichkeits-Verfassungen gekennzeichnet, ebenso wie mit dem Wechsel zwischen zwei verschiedenen Serif-Schriftgestaltungen des Fließtextes. In der zweiten Hälfte von »Vellum« kommt es anhand in einer beeindruckenden SF/Cyberpunk-Szenerie auch zu informationstechnologischen Spielereien, die mit kurzen sans serif-Einschüben darstellen, wie sich ein Schwarm mit künstlicher Intelligenz gesegneter Nanopartikel, so genannte Bitmites, durch die verschiedenen Schizoschichten einer Anarchoterroristenpsyche zu hacken versucht.
Los geht alles mit einer brennenden Welt-Karte. Vereinfachend gesagt prallen Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftswelten aufeinander im großen Kampf ums Dasein. Das zentrale Phantastikelement sind die ›Unkin‹, sprich: engel-/dämonenhafte Wesen die es druffhaben, mit dem ›Cant‹[03] die Wirklichkeit zu formen. Außerdem werden höllische Tattoo- und Blutmagie sowie himmlische Chakra-Wummen und KI-Nano-Schwärme eingesetzt. Auf der einen Seite steht die Herrschaft der Erzengel, das Imperium, die Faschos, die kapitalistischen Unterdrücker; auf der anderen Seite die rebellischen Dämonen, die Anarchisten und Freiheitskämpfer, die Arbeiterbewegung. Das Ganze wird recht ungestüm durch Zeiten und Welten springend erzählt, von Babylons Inanna-, und Griechenlands Prometheusmythos, über verschiedenste historische Konflikte (Erster Weltkrieg, Spanischer Bürgerkrieg, Irlandaufstand, Irakkrieg, Terrorismus in der nahen Zukunft) bis hin zu Andersweltgebieten, durch welche die Flüchtlinge eines die Wirklichkeit verschlingenden Sturms zigeunern. Verstrickt in diesen Himmel-, Fegefeuer- und Höllestrudel finden sich drei Studikumpels und ein Mädel und ihr überirdischer Sohn wieder, deren Wege sich quer durch die Dimensionen im so genannten ›Vellum‹ kreuzen. Das Vellum ist die Welt als Buch, GOttes ultimative Gebrauchsanleitung für die Realität, das alle wahren Namen enthält, mit denen sich der besagte ›Cant‹ zwecks Wirklichkeits-Kontrolle bewerkstelligen lässt. Dieses ›Ewige Stundenbuch‹ löst sich aufgrund der unerhörten Eingriffe und Trinkereien der Konfliktparteien auf, beziehungsweise verwandelt sich drastisch, dort wo die entsprechend bratzigen Engel und Dämonen durchlatschen und aufeinandertreffen. Nur hat noch keine der Figuren einen wirklichen Plan davon, was eigentlich los ist; sie irren durch die Vellum-Welt(en), umflirrt von Traumfetzenwirbeln, Erinnerungen und Visionen, unterwegs auf Expeditionen um die älteste Kultur der Menschheit zu finden, in Irrenhäusern darbend, in Schlachtfeldgräben kauernd, in Pubs mümmelnd und in Hotelzimmern grübelnd.
 Zwei Dinge dünken mir bei »Vellum«, im Guten, bemerkenswert. Erstens der gewollt rand- und bandlose Umgang mit Genregrenzen, wenn mythische und utopische Register wechseln, wenn sich klar verortbare Genre-Stimmungen, wie beispielsweise Kriegs- und Spionageabenteuer, mit vom magischen Realismus bekannter doppelbödigen Stimmungspoesie verquickt. Da lässt sich nicht auseinanderklamüsern wie die mythische Archaik aufhört, in modernen Horror übergeht und die fetzige Cyperpunk-SF beginnt, denn gemäß der alles ihren Weltenbrandstrudel ziehenden Logik gemäß ist hier alles stets im Übergang und ein Vor- oder Nachecho seines gewandelten Selbst. Sprachlich versteht sich Duncan zuallermeist vorzüglich darauf, Punk-Jargon mit sakralem Mythenton zu kreuzen, zwischen legendengesättgtem Fantasygeraune und Science Fiction-typischen Gadgetsprech zu wechseln, auf abgefahrene Traumbildcharaden Schilderungen von realistischen Echtweltszenen folgen zu lassen. Zweitens, und das geht mit eben ausgeführten Stil- und Genremix prächtig Hand in Hand, beziehungsweise ist eine Folge davon, meistert Hal Duncan erzählend ein Desorientungshütchenspiel mit den fundamentalen Wirklichkeitskathegorien Ort, Zeit und Identität. »Nix ist fix« scheint das Buch mir als Leser einflüstern zu wollen, und nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass Mich-treiben-lassen ohne Orientierung von diesem Durcheinander von mir gefordert wird, traten um so deutlicher die starken Gefühle der Figuren und die spezifischen Orts- und Zeitstimmungen (ob historisch oder andersweltlich) als eigentlich bestimmende Motive hervor. Da kommt dann unter anderem zur Sprache: Der Schmerz derer, die Verfolgung, Ausgrenzung und Folterung erleiden (oder zufügen), oder deren geistiger Halt durch den Verlust des/der Geliebten zerrissen wurde; der rebellische Trotz derer, die dem Schöpfer- und Ordnungszwang der selbstgerechten Positivisten ein trotziges Nein entgegenstellen; die schamgepeinigte Einsamkeit der Verräter und Feiglinge; das Erschrecken von Liebenden über die Mächtigkeit ihrer eigenen Leidenschaft.
Zwei Dinge dünken mir bei »Vellum«, im Guten, bemerkenswert. Erstens der gewollt rand- und bandlose Umgang mit Genregrenzen, wenn mythische und utopische Register wechseln, wenn sich klar verortbare Genre-Stimmungen, wie beispielsweise Kriegs- und Spionageabenteuer, mit vom magischen Realismus bekannter doppelbödigen Stimmungspoesie verquickt. Da lässt sich nicht auseinanderklamüsern wie die mythische Archaik aufhört, in modernen Horror übergeht und die fetzige Cyperpunk-SF beginnt, denn gemäß der alles ihren Weltenbrandstrudel ziehenden Logik gemäß ist hier alles stets im Übergang und ein Vor- oder Nachecho seines gewandelten Selbst. Sprachlich versteht sich Duncan zuallermeist vorzüglich darauf, Punk-Jargon mit sakralem Mythenton zu kreuzen, zwischen legendengesättgtem Fantasygeraune und Science Fiction-typischen Gadgetsprech zu wechseln, auf abgefahrene Traumbildcharaden Schilderungen von realistischen Echtweltszenen folgen zu lassen. Zweitens, und das geht mit eben ausgeführten Stil- und Genremix prächtig Hand in Hand, beziehungsweise ist eine Folge davon, meistert Hal Duncan erzählend ein Desorientungshütchenspiel mit den fundamentalen Wirklichkeitskathegorien Ort, Zeit und Identität. »Nix ist fix« scheint das Buch mir als Leser einflüstern zu wollen, und nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass Mich-treiben-lassen ohne Orientierung von diesem Durcheinander von mir gefordert wird, traten um so deutlicher die starken Gefühle der Figuren und die spezifischen Orts- und Zeitstimmungen (ob historisch oder andersweltlich) als eigentlich bestimmende Motive hervor. Da kommt dann unter anderem zur Sprache: Der Schmerz derer, die Verfolgung, Ausgrenzung und Folterung erleiden (oder zufügen), oder deren geistiger Halt durch den Verlust des/der Geliebten zerrissen wurde; der rebellische Trotz derer, die dem Schöpfer- und Ordnungszwang der selbstgerechten Positivisten ein trotziges Nein entgegenstellen; die schamgepeinigte Einsamkeit der Verräter und Feiglinge; das Erschrecken von Liebenden über die Mächtigkeit ihrer eigenen Leidenschaft.
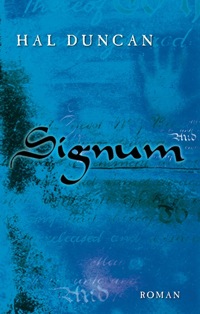 Ich will nicht verhehlen, dass »Vellum« mir streckenweise auch gehörig auf die Nerven ging, vor allen mit seinen lyrisch-idyllischen Passagen, wenn wenig los ist, aber sich viel angeschmachtet oder weltschmerzlich gelitten wird, oder auch, wenn liturgisch-rituelle Partituren zu schematisch absolviert wird. Aber das ist nun mal der Preis, den man entrichten muss beim Lesen eines Buch, dass sich intensiv und mit zum Teil aktionsreicher Wonne auf alle möglichen Extreme einlässt, Orientierungs-Sicherheiten gewollt meidet, Grenzen zwischen Welten, Zeiten, zwischen Ich und Du, Innen und Außen mit Schmackes missachtet. Immerhin dauernd die Nervpassagen nie lange, da das Buch in hunderte kurze Tracks unterteilt ist. Anders gestimmte Leser werden vielleicht gerade die rrrromantischen Schmachtpassagen der in verschiedensten Weibchen/Männchen-, Männchen/Männchen-Kombinationen der Liebenden zu schätzen wissen, oder begeistert die formelhaften Schritte der Ereignis-Abfolge von altbekannten Mythen genießen (vor allem wenn man diese Mythen eben noch nicht durch das Selberlesen der klassischen Quellen kennt). — Leider habe ich den zweiten Band »Ink« nicht mehr rechtzeitig mit der gebotenen Sorgfalt zu Ende lesen können, um hier zu berichten, wohin die Reise mit Hal Duncans wildgewordener Mythen-Jukebox führt, und ob sich diese Reise letztendlich lohnt oder nicht. Nachdem ich aber bei »Vellum« die größere Mühe aufbringen musste, weil ich den Roman beim ersten Mal auf Englisch las, werde ich mich bei »Ink« (Deutsch »Signum«) zurücklehnen und gleich die höchster Bewunderung würdige Übertragung von Hannes Riffel genießen.
Ich will nicht verhehlen, dass »Vellum« mir streckenweise auch gehörig auf die Nerven ging, vor allen mit seinen lyrisch-idyllischen Passagen, wenn wenig los ist, aber sich viel angeschmachtet oder weltschmerzlich gelitten wird, oder auch, wenn liturgisch-rituelle Partituren zu schematisch absolviert wird. Aber das ist nun mal der Preis, den man entrichten muss beim Lesen eines Buch, dass sich intensiv und mit zum Teil aktionsreicher Wonne auf alle möglichen Extreme einlässt, Orientierungs-Sicherheiten gewollt meidet, Grenzen zwischen Welten, Zeiten, zwischen Ich und Du, Innen und Außen mit Schmackes missachtet. Immerhin dauernd die Nervpassagen nie lange, da das Buch in hunderte kurze Tracks unterteilt ist. Anders gestimmte Leser werden vielleicht gerade die rrrromantischen Schmachtpassagen der in verschiedensten Weibchen/Männchen-, Männchen/Männchen-Kombinationen der Liebenden zu schätzen wissen, oder begeistert die formelhaften Schritte der Ereignis-Abfolge von altbekannten Mythen genießen (vor allem wenn man diese Mythen eben noch nicht durch das Selberlesen der klassischen Quellen kennt). — Leider habe ich den zweiten Band »Ink« nicht mehr rechtzeitig mit der gebotenen Sorgfalt zu Ende lesen können, um hier zu berichten, wohin die Reise mit Hal Duncans wildgewordener Mythen-Jukebox führt, und ob sich diese Reise letztendlich lohnt oder nicht. Nachdem ich aber bei »Vellum« die größere Mühe aufbringen musste, weil ich den Roman beim ersten Mal auf Englisch las, werde ich mich bei »Ink« (Deutsch »Signum«) zurücklehnen und gleich die höchster Bewunderung würdige Übertragung von Hannes Riffel genießen.
•••
ANMERKUNG:
[01] »Finnegans Wake« (1939) ist das letzte Werk des Erzexzentrikers James Joyce. Darin wird der Traum eines Kneipenbesitzers erzählt, und das ganze dicke Buch ist in einer viele Sprachen zusammenmischenden Brabbelsprache verfasst, die Figuren wechseln ihre Identität und Gestalt und entsprechend vieldeutig interpretierbar ist das Ganze. Eigentlich ist dieses Buch nicht ernsthaft lesbar, es sei denn, man trinkt vorher und dabei ordentlich und lässt sich das ganze von einer entsprechend angeschickerten Person vorlesen, die des mit irischem Dialekt gefärbten Englisch mächtig ist. — Der lockere Vergleich scheint mir zulässig, weil auch Duncan in »Vellum« mit der mehrsinnigen Vielstimmigkeit von Sprache hantiert. So lauten die Titel der beiden Großabschnitte des Buches
»The Lost Deus of Sumer« (Die verlorenen Götter/Tage des Sommers/der Sumerer) und
»Evenfall Leaves« (Fall der Herbstblätter / Abschied vom Ort Evenfall), und der Übersetzer Hannes Riffel hatte sich in seiner exzellenten Übertragung zu entscheiden und destillierte diese sprachliche Schlieren zu
»Sommertage« und
»Herbstdämmerung«. •••
Zurück
[01] »The Invisibles« (erschienen 1994 bis 2000) ist ein 59 Kapitel starkes Comic, das von Grant Morrisson geschrieben (bei uns wohl bekanntesten durch seinen Batman-Band mit Dave McKean: »Arkham Asylum«) und verschiedenen Künstlern gezeichnet wurde. Darin wird der Kampf einer Guerilla-Zelle des Invisible College gegen finstere Schreckensmächte geschildert. Die Invisibles gehen dabei mit Zeitreisen, verschiedensten Magietraditionen bis hin zu Meditation und Tantra, sowie Wummen, Bomben und Kampfsportkünsten gegen die überdimensionalen Archons vor, welche bereits weite Teile der Menschheit ohne deren Kenntnisnahme versklaven konnten. Verschwörungs-Popkultur, psycho-spekulative SF und moderne Szene-Esoterik finden sich hier zu einem verspielten und äktschenreichen Abenteuer zusammen. — Erscheint seit 2008 endlich auch auf Deutsch Panini DC/Vertigo. Bisher sind von den fünf geplanten Monstereditions-Bänden erschienen: Band 1 »Revolution gefällig«; Band 2 »Ordnung und Entropie«. •••
Zurück
[03] Ein Wort, das im Englischen irgendwo im durch die Begriffe
›Fachsprache‹,
›Gaunersprache‹ und
›Frömmelei‹ umzirkelten Bedeutungsfeld herumschwirrt; zudem klingt deutlich das Lateinische
›Cantus‹, für
›Gesang‹,
›Melodie‹, an. •••
Zurück
•••
Hal Duncan:
»The Book of All Hours 1 – Vellum«; 238 Abschnitte in 17 Kapiteln zu zwei Teilen auf 499 Seiten; Taschenbuch bei Pan Macmillan, 2005; ISBN: 0-330-44433-6
Hal Duncan: »Das Ewige Stundenbuch 1 – Vellum«; aus dem Englischen von Hannes Riffel; 594 Seiten; gebunden mit Schutzumschlag bei Shayol / Golkonda, 2007; ISBN: 978-3-926126-72-6
Taschenbuch bei Heyne, 2008: ISBN: 978-3-453-52254-1
Hal Duncan: »Das Ewige Stundenbuch 2 – Signum«; aus dem Englischen von Hannes Riffel; 648 Seiten; gebunden mit Schutzumschlag bei Golkonda, 2010; ISBN: 978-3-942396-00-4
Pratchett, Steward, Cohen: »Die Gelehrten der Scheibenwelt«, oder: Expeditionen in die Wirklichkeit der geschichtenerzählenden Affen
Eintrag No. 478
•••
 Ich weiß, ich weiß! Terry Pratchett ist einer der großen lebenden kapitalen Platzhirsche der Phantastik, vor allem der humoristsichen Fantasy, und da mittlerweile sogar öffentlich-rechtliche Sender[01] und überregionale Feuilletons und Buchmagazine bei Erscheinen eines neuen Pratchetts wohlwollend über den Scheibenweltschöpfer berichten, warum also hier in einem Fantasyjahrbuch ›unter Kennern‹ noch viele Worte über ihn und seine Bücher verlieren?[02]
Ich weiß, ich weiß! Terry Pratchett ist einer der großen lebenden kapitalen Platzhirsche der Phantastik, vor allem der humoristsichen Fantasy, und da mittlerweile sogar öffentlich-rechtliche Sender[01] und überregionale Feuilletons und Buchmagazine bei Erscheinen eines neuen Pratchetts wohlwollend über den Scheibenweltschöpfer berichten, warum also hier in einem Fantasyjahrbuch ›unter Kennern‹ noch viele Worte über ihn und seine Bücher verlieren?[02]
Pratchetts Scheibenwelt hat sich seit 1983 zur einer der erfolgreichsten und prägendsten Fantasy-Institutionen entwickelt.[03] Als attraktivste Eigenheit der Entwicklung von Pratchetts Schreiben empfinde ich, wie er sich im Laufe der Jahre vom parodistischen Satiriker, der vornehmlich (allzu) liebgewonnene Eigenheiten der Genre-Fantasy genüsslich aufs Korn nimmt, zu einem humoristischen Moralisten entwickelte. Über den Kurs der (derzeit etwa) 40-ebbes Scheibenweltbücher zeichnet sich Pratchetts Auseinandersetzung mit geschichtlichen, gesellschaftlichen und philosophischen Problemen und Spannung immer deutlicher ab. Als markante Stationen dieses Erstarkens von Pratchetts engagierten Zeitgenossenschaftskommentaren verweise ich auf das Geschlechterrollengerangel zwischen Magiern und Hexen (»Equal Rites«, 1987), die Gräuel des fundamentalistischen Monotheismus (»Small Gods«, 1992), den Missbrauch von sowohl fremdenfeindlicher als auch Multikulti-Denke durch Diplomatie und Politik in Kriegszeiten (»Jjngo«, 1997). Eine thematisch-stimmungshafte »Verdüsterung« der Scheibenwelt hat sich endgültig ab »Night Watch« (2002) etabliert, immerhin werden hier Revolutionsunruhen, Bürgerkriegsmassaker und Serienmörderpathologien ausgebreitet. Anders ausgedrückt, schafft es Pratchett scheinbar so nebenbei, sich für seine Fantasywelt Epochen wie die Industrielle Revolution oder die moderne Konsum- und Mediengesellschaft als Material nutzbar zu machen. Entsprechend abwechslungsreich finden sich in den Scheibenweltbüchern die verschiedensten modernen Milieus ein, wird spielerisch-erzählend vorgeführt, wie die Identitäten von Minderheiten Eigenleben entwickeln, individuelle Weltbilder von der sozialen Einbettung geprägt werden, und wie schwer die Bemühungen (ja leider oft gewalttätig die Konflikte) um eine vermittelnde, umfassende Sicht auf die Wirklichkeit sind.
Pratchett gehört zudem einer (wie ich finde begrüßenswürdigen) Avantgarde der Fantasy an, da er sich nicht scheut wissenschaftliches Bildungsgut und die moderne Informationsgesellschaft deutlich erkennbar in seinen Fantasyweltenbau einfließen zu lassen, und das eben nicht nur, um nette kleine Kalauer auf die Tücken der Technik zu platzieren, oder gar um der Wissenschaft vorzuwerfen, dass sie sich vom Menschen hat missbrauchen lassen, und damit den schrecklichen Katastrophen des 20. Jahrhunderts (die beiden Weltkriege, Rassenhygiene und atheistische Gulags) förderlich gedient zu haben.[04] Das prominenteste Requisit[05] dieser erfreulichen Offenheit der Scheibenweltbücher für die tatsächlich stattfindende Moderne ist Hex, ein in »Soul Music« (1994) debütierendes Konglomerat aus Glasröhren, Ameisen und Magie, das als einfache mit Lochkarten betriebene Rechenmaschine anhob, und sich zu einer immer mächtigeren Denkmaschine und schließlich Großrechenanlage gemausert hat.[06]
Zur Reihe der »GELEHRTEN DER SCHEIBENWELT« selbst: Der erzählende Prattchet-Anteil[07] ist deutlich geringer als die Sachtextportionen von Jack Cohen[08] und Ian Steward (1945). Wer also zuvörderst neue Scheibenweltromane erwartet, wird vielleicht enttäuscht. Die Schreibenwelthandlung dient hauptsächlich als lockerers Korsett und kurzweilige Intermezzi des großen Sachbuchbogens. Steward und Cohen glänzen zwar oft durch ihren Schalk, aber verglichen mit dem Humorvirtuosen Pratchett erscheint ihre Kalauerei ab und zu ein wenig zu harmlos oder zu willkürlich. Wer wilde Bücher mit herumschlenkernden Habitus, z.B. solcher Sachbuchphantasten wie Robert Anton Wilson, Douglas R. Hofstadter oder Rudy Rucker mag, wird mit der stellenweise blumig-albernen Ideenjoungliererei von Steward und Cohen seinen Spaß haben. Was das Hin und Her zwischen Scheibenwelt-Novelle und Sachtext-Argumentation betrifft: Ich selber habe (beim ersten Mal) nicht gewagt, mich dem schwindelerregenden Wechsel auszusetzen, und habe die beiden Stränge jeweils für sich am Stück genossen.
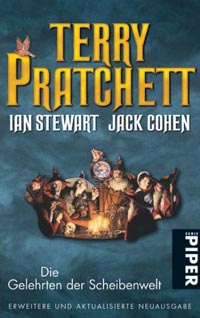 In der Erzählung des ersten Bandes der Reihe, »Die Gelehrten der Scheibenwelt«, beginnt alles mit Ponder Stibbons (Hex-Experte der Unsichtbaren Universität) Projekt der Spaltung des Thaums (= elementare magische ›X-Teilchen‹), gedacht als billige und effektive Energiequelle und Möglichkeit die Grenzen des Wissens zu erweitern. Da der Energieausstoß so gigantisch ist, dass er das Scheibenweltuniversum zu vernichten droht, leitet man die Energie in eine Glaskugel um, in der es keine Materie, keine Realität und, am wichtigsten, keine Magie gibt. Durch das neugierige Rummgefummel der Zauberer entsteht sozusagen als Unfall unser Universum. Die Zauberer haben ihren ›Videospielspaß‹ damit Materieklumpen aufeinanderzudonnern (= Sonnen zu schaffen), mittels des Schnellvorlaufs die aberwitzig langfristige Entwicklung des Universums auf etwa einen Monat zu verkürzen, und der allerweil hochstressierte weil überängstliche Zauberer Rincewind wird in einer Art ›Virtual Reality‹-Tauchanzug in unser Universum geschickt, um sich vor Ort genauer umzugucken. Die Zauberer verfolgen erstaunt das hartnäckig als Unwahrscheinlichkeit erscheinende Aufkommen von intelligenten Lebensformen. Andererseits drohen kosmische (es reichen auch globale) Katastrophen höhere wie niedere Arten mit Massenexitus. Das Buch klingt damit aus, dass die Scheibenweltgelehrten beobachten wie eine höhere Lebensform die Erde mittels eines Weltraumaufzuges verlässt, rechtzeitig bevor die nächste fiese Eiszeit zuschlägt.
In der Erzählung des ersten Bandes der Reihe, »Die Gelehrten der Scheibenwelt«, beginnt alles mit Ponder Stibbons (Hex-Experte der Unsichtbaren Universität) Projekt der Spaltung des Thaums (= elementare magische ›X-Teilchen‹), gedacht als billige und effektive Energiequelle und Möglichkeit die Grenzen des Wissens zu erweitern. Da der Energieausstoß so gigantisch ist, dass er das Scheibenweltuniversum zu vernichten droht, leitet man die Energie in eine Glaskugel um, in der es keine Materie, keine Realität und, am wichtigsten, keine Magie gibt. Durch das neugierige Rummgefummel der Zauberer entsteht sozusagen als Unfall unser Universum. Die Zauberer haben ihren ›Videospielspaß‹ damit Materieklumpen aufeinanderzudonnern (= Sonnen zu schaffen), mittels des Schnellvorlaufs die aberwitzig langfristige Entwicklung des Universums auf etwa einen Monat zu verkürzen, und der allerweil hochstressierte weil überängstliche Zauberer Rincewind wird in einer Art ›Virtual Reality‹-Tauchanzug in unser Universum geschickt, um sich vor Ort genauer umzugucken. Die Zauberer verfolgen erstaunt das hartnäckig als Unwahrscheinlichkeit erscheinende Aufkommen von intelligenten Lebensformen. Andererseits drohen kosmische (es reichen auch globale) Katastrophen höhere wie niedere Arten mit Massenexitus. Das Buch klingt damit aus, dass die Scheibenweltgelehrten beobachten wie eine höhere Lebensform die Erde mittels eines Weltraumaufzuges verlässt, rechtzeitig bevor die nächste fiese Eiszeit zuschlägt.
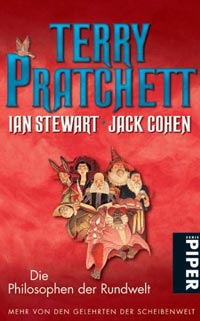 In »Die Philosophen der Rundwelt« gibt es dann mit den parasitären Elfen und ihrer Königin richtige Bösewichter, die sich aus der Scheibenwelt in die Rundwelt eingeschlichen haben, um mit ihrer verführerischen und täuschenden Magie die Menschen in abergläubischer Ehrfurchtsdummheit dümpeln zu lassen und damit zu versklaven. Da die menschliche Gabe der Vorstellungskraft das empfindliche Einfallstor für die Elfenmagie ist, sorgen die Zauberer der Scheibenwelt bei ihrem ersten Rettungsversuch in der Steinzeit dafür, dass die Frühmenschen ihren Hang zum Aberglauben nicht entwickeln[09]. Dadurch aber bleiben die Menschen so beschränkt, dass sie sich nie über das kulturelle Niveau der Steinzeit hinaus entwickeln. Beim zweiten Rettungsversuch, diesmal zur Zeit der englischen Renaissance, trachten die Zauberer deshalb danach, mit der richtigen Art von Geschichten die Kreativität der Menschen über das anfängliche Maß hinaus zu steigern, um die Menschheit gegen die unheilbringenden Elfenverführungen zu immunisieren (wobei Shakespeare und sein Theater ›The Globe‹ eine entscheidende Rolle spielen).
In »Die Philosophen der Rundwelt« gibt es dann mit den parasitären Elfen und ihrer Königin richtige Bösewichter, die sich aus der Scheibenwelt in die Rundwelt eingeschlichen haben, um mit ihrer verführerischen und täuschenden Magie die Menschen in abergläubischer Ehrfurchtsdummheit dümpeln zu lassen und damit zu versklaven. Da die menschliche Gabe der Vorstellungskraft das empfindliche Einfallstor für die Elfenmagie ist, sorgen die Zauberer der Scheibenwelt bei ihrem ersten Rettungsversuch in der Steinzeit dafür, dass die Frühmenschen ihren Hang zum Aberglauben nicht entwickeln[09]. Dadurch aber bleiben die Menschen so beschränkt, dass sie sich nie über das kulturelle Niveau der Steinzeit hinaus entwickeln. Beim zweiten Rettungsversuch, diesmal zur Zeit der englischen Renaissance, trachten die Zauberer deshalb danach, mit der richtigen Art von Geschichten die Kreativität der Menschen über das anfängliche Maß hinaus zu steigern, um die Menschheit gegen die unheilbringenden Elfenverführungen zu immunisieren (wobei Shakespeare und sein Theater ›The Globe‹ eine entscheidende Rolle spielen).
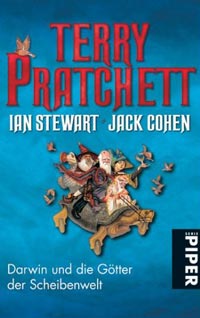 Der dritte Band »Darwin und die Götter der Scheibenwelt« nimmt sich dann insbesondere die Evolutionstheorie vor, sowie die Kontroversen über sie, was nichts anderes ergibt, als ein gründlichen Exkurs über die Rivalität zwischen Wissenschaft und Religion. Die Gegner der Menschheit sind diesmal die Revisoren der Realität, ein Rudel ›himmlischer Bürokraten‹, die alle höheren Lebensformen hassen, weil die mit ihrer quirligen Umtriebigkeit nicht zum Ideal der Revisoren von einem wie ein perfektes Uhrwerk ablaufendes Universum passen. Durch die Eingriffe der Revisoren verfasst Charles Darwin statt seiner »Entstehung der Arten« eine »Theologie der Arten«, in der er darlegt, dass die Evolution von der ordnenden Hand eines Schöpfer geleitet wird. Leider führt das Werk zu einer stagnierenden Denkblockade der Menschheit, der Weltraumaufzug droht wieder nicht rechtzeitig zur gnadenlosen Eiszeit fertigzuwerden. Es kommt zu einem aberwitzigen Krieg der Zauberer gegen die Revisoren, in der beide Seiten wieder und wieder in den historischen Zeitenlauf eingreifen. Schließlich verschlägt es Darwin auf die Scheibenwelt, wo er seine Unschlüssigkeiten zur ihn selbst arg beunruhigenden Evolutionstheorie[10] im Gespräch mit dem Scheibenweltgott der Evolution überwindet.
Der dritte Band »Darwin und die Götter der Scheibenwelt« nimmt sich dann insbesondere die Evolutionstheorie vor, sowie die Kontroversen über sie, was nichts anderes ergibt, als ein gründlichen Exkurs über die Rivalität zwischen Wissenschaft und Religion. Die Gegner der Menschheit sind diesmal die Revisoren der Realität, ein Rudel ›himmlischer Bürokraten‹, die alle höheren Lebensformen hassen, weil die mit ihrer quirligen Umtriebigkeit nicht zum Ideal der Revisoren von einem wie ein perfektes Uhrwerk ablaufendes Universum passen. Durch die Eingriffe der Revisoren verfasst Charles Darwin statt seiner »Entstehung der Arten« eine »Theologie der Arten«, in der er darlegt, dass die Evolution von der ordnenden Hand eines Schöpfer geleitet wird. Leider führt das Werk zu einer stagnierenden Denkblockade der Menschheit, der Weltraumaufzug droht wieder nicht rechtzeitig zur gnadenlosen Eiszeit fertigzuwerden. Es kommt zu einem aberwitzigen Krieg der Zauberer gegen die Revisoren, in der beide Seiten wieder und wieder in den historischen Zeitenlauf eingreifen. Schließlich verschlägt es Darwin auf die Scheibenwelt, wo er seine Unschlüssigkeiten zur ihn selbst arg beunruhigenden Evolutionstheorie[10] im Gespräch mit dem Scheibenweltgott der Evolution überwindet.
Die Sachtextabschnitte erzählen vom Werdegang der wissenschaftlichen Durchdringung der Welt. Es gibt spannende Anekdoten über Forscher und Philosophen und ihre Heureka- und Homer Simpson-Momente. Berühmt-berüchtigte und nicht so bekannte Gedankenexperimente und Spezialmetaphern sprühen hier Funken und es wird (ziemlich aktuell) über den Stand von kontrovers verhandelten Fragen referiert. Löblich vor allem, dass Wissenschaft hier nicht als Hort absoluter Wahrheiten dargestellt wird. Immerhin, desto eingehender man sich mit irgendeinem wissenschaftlichen Thema beschäftigt, um so deutlicher wird, dass wir Menschen eben nicht genau wissen wie und warum etwas so oder so funktioniert oder beschaffen ist. In einem Podcast der BBC anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Albert Einsteins Publikations-Wunderjahr 1905, sprechen die drei Scheibenweltgelehrten munter über die Ambivalenz der Begriffe Technik und Magie[11], und dass die Phantasie ein eminent wichtiges Talent für jegliche Wissenschaft ist. Tatsächlich muss ja jeder Person, die nicht nicht hinreichend in die Mysterien der Technik eingeweiht ist, ein Mikrowellenherd, Lichtschaltermagie, Fernsehen und Telefon wie Zauberartefakte erscheinen. Banal umschrieben wurde Magie dann angewandt, wenn am Ende eines Prozesses augenscheinlich mehr Ergebnis / Produkt / Auswirkung geerntet wird, als man anfänglich Aufwand / Arbeit / Tat investiert hat. – Die Evolutionstheorie kann hierzu als Beispiel für konkurrierende Erklärungs-Phantasmen dienen. In ihren Rückzugsgefechten um die Deutungshoheit zur Beschaffenheit der Welt, berufen sich die fundamentalistischen Religiösen auf einen Schöpfergott (oder in kosmetischer Verschleierung: auf Intelligent Design), um hochkomplexe Hervorbringungen der Natur, wie das Auge oder den Menschen selbst mit seinem wundersamen Bewusstseinsvermögen, zu erklären. Solche Leute hängen ihre Argumentation an dem Himmelshaken ›Schöpfergott‹ auf, und Gott wird schlicht als wahr vorausgesetzt, basta.[12] Wissenschaftliche Denke aber ist zu der Erkenntnis gelangt, dass genügend Zeit und Variation in kleinteiliger, aufeinander aufbauender Krahnarbeit eben vollkommen ausreichen, um die wundersamen Höhen an Gestaltungsarbeit zu erreichen, als die wir Menschen uns selbst gerne wähnen. Und bezügliche menschlicher Selbsterhöhung hat mich der feinsinnigen Spott des Trios beeindruckt, wenn sie derartige allzumenschliche Schwächen bloßstellen und z.B. lausbübisch statt der selbstglorifizierenden Bezeichnung ›Homo sapiens‹ (Weiser Mensch) den – zumindest auch für mein Empfinden – zutreffenderen Begriff ›Pan narrans‹ (geschichtenerzählender Schimpanse) vorschlagen.
Abschließend ein paar Worte zur neuen deutschen Auflage der Reihe bei Piper-Taschenbuch. Gut übersetzt von Andreas Brandenhorst (Pratchett) und Erik Simon (Cohen & Steward); erfreulich, dass die Paul Kidby-Illustrationen für die Umschlagszier übernommen, und die Reihe schön einheitlich gestaltet wurde. Ein Ärgernis aber ist das Papier, bzw. die Untugend, durch schweres und dickes Papier das Volumen von Büchern künstlich aufzublähen.[13] Die englischen Taschenbücher kann man in der Gesäßtasche einer Jeans mitnehmen, für die deutschen Ausgaben braucht’s schon mindestens Military- oder Baggy-Klamotte mit großen Beintaschen. Zudem finde ich es betrüblich, dass die ausführlichen Stichwort-, Namens- und Werksregister der Originalausgaben nicht übernommen wurden. Nur schwachen Trost spendet da der bibliographische Anhang mit weiterführende Lektüre des dritten Bandes. So lästig diese Makel auch sind, mindern sie nicht die einzigartige Bereicherung, die diese Reihe Wissbegierigen zu bescheren vermag.
•••
»Die Gelehrten der Scheibenwelt« (
»The Science of Discworld 1«) engl 1999, erweitert 2002; 528 Seiten; Piper Taschenbuch 2006; ISBN: 3-492-28616-X
»Die Philosophen der Rundwelt« (
»The Science of Discworld 2 – The Globe«) engl. 2002; 478 Seiten; Piper Taschebuch 2006; ISBN: 3-492-28624-6
»Darwin und die Götter der Scheibenwelt« (
»The Science of Discworld 3 – Darwins Watch«) engl. 2005; 430 Seiten; Piper Taschenbuch 2006; ISBN: 3-492-26622-3
Alle drei Bücher übersetzt von Andeas Brandenhorst (Pratchett), Erik Simon (Steward & Cohen) und mit Titelbildern von Paul Kidby.
•••
ANMERKUNGEN:
[02] Zu Pratchett siehe auch
»MAGIRA 2003«:
»Welt und Spiegel aller Welten« von Lydia Eslinger, S. 267; Carsten Kuhr über
»Der Zeitdieb«, S. 327. –/–
»MAGIRA 2004«: Erik Schreiber über
»Rettet die Rundwelt«, S. 252. –/–
»MAGIRA 2004«: Michael Scheuch über die Hörbücher von
»Gevatter Tod« und
»Wachen! Wachen!«, S. 301. –/–
»MAGIRA 2006«: Michael Scheuch über die Hörbücher von
»Ein Hut voller Sterne« und
»Pyramiden«, S. 405, 408. •••
Zurück
[03] Der moderne Volksmund der Engländer mutmaßt z.B., daß die Eisen-, S- und U-Bahnen auf der Insel dem ungeschriebenen Gesetzt folgen, daß kein Zug losfahren darf, ehe nicht mindestens ein den neuesten Pratchett lesender Fahrgast anwesend ist. •••
Zurück
[04] Menschen haben Menschen gedient, und sich bei Planung und Durchführung der Technik bedient. •••
Zurück
[05] Vielleicht doch genauer: der
›prominenteste Charakter‹? •••
Zurück
[06] Die Portrait-Skizze von
Paul Kidby in dem prächtigen Bildband
»Die Kunst der Scheibenwelt« (Heyne, 2006) läßt als Bestandteile von Hex u.a. erkennen: einen skeletierten Widderschädel; eine Tastertur mit Hebeln und kleinen Lochkartensteckschlitzen, nebst einem A4-Schreibfederplotter; einen Teddybären; ein nacktes, verknicktes Regenschirmgestell an dem Fische hängen; ein etwas schlapper Wasserball; ein Glockenwindspiel; eine wabbelige Dali-Kuckucksuhr; ein Aquarium; ein Miniatursteinkreis; ein traditionell-geflochtener Bienenkorb; eine Sanduhr an einer kräftigen Federwage; eine Mondphasenuhr, viele viele Zähnräder verschiedenster Größe und das allem zugrundeliegende ameisendurchwuselte (
›Anthill inside‹) Gewirr aus Glasröhren, Retorten und Kolbenflaschen. •••
Zurück
[07] Etwa 30% in Band 1 & 2 und 25% in Band 3. •••
Zurück
[08] Ich muß einfach auf Jack Cohens
»X-FILES« und
»MILLENIUM«-Connection hinweisen. Neben vielen anderen Tätigkeiten arbeitet Cohen als Berater für die Filmindustrie, z.B. wenn möglichst realistische Aliens entwickelt werden sollen. Cohen hat die TV-Leute wohl gehörg beeindruckt, denn der durchgeknallteste Drehbuchautor der für die beiden Serien schrieb, Darin Morgan, hat mit der Figur des SF/Sachbuchautoren Jose Chung eine zum Kringeln lustige Homage auf Cohen geliefert, zu genießen in
»Andere Wahrheiten« (
»X-FILES«, Staffel 3, olge 20) und
»Die Phantasien des José Chung« (
»MILLENIUM«, Staffel 2, Folge 9). •••
Zurück
[09] Die schönste mir bekannte Klage über Aberglauben findet sich in Caesars erstem Tagebuchbrief an Lucius Mamilius Turrinus aus Thornton Wilders
»Die Iden des März« (1948):
Dem Paket dieser Woche schließe ich ein halbes Dutzend jener unzähligen Berichte bei, die ich als Pontifex Maximus von den Auguren, Wahrsagern, Himmerlsbeobachtern und Hühnerwerfern erhalte. Was ist zu tun? Ich habe diese Last von Unsinn und Aberglauben geerbt. Ich regiere unzählige Menschen, muß aber anerkennen, daß ich von Vögeln und Donnerschlägen regiert werde. Das hemmt und hindert häufig die Staatsführung. {…} Vor allem wird durch diese Observanzen der wahre Lebensgeist im Gemüt des Menschen angegriffen und untergraben. Sie gewähren unsern guten Römern vom Kehrichtfeger bis zum Konsul ein unbestimmtes Gefühl der Zuversicht, wo es keine Zuversicht gibt, und flößen ihnen gleichzeitig eine Ängstlichkeit ein, die weder zum Handeln anspornt, noch den Geist erfinderisch macht, sondern nur lähmt. Mit den anderen Feinden der Ordnung läßt sich fertigwerden.
••• Zurück
[10] Apropos: Eine alternativ-historische Fantasy-Auseinandersetzung mit der vielleicht großartigen Idee aller Zeiten, der Evolutionstheorie, legte der von mir letztes Jahr für
»Aether« (»The Light Ages«) gelobte Ian R. McLeod 2005 mit
»House of Storms« vor. •••
Zurück
[12] Etwas origineller ist das Manöver der transzendenten Metaverkettung von Himmelhaken. Wenn der buchstäblich im Nichts hängende Himmelshaken an einem übergeordneten Himmelhaken befestigt ist, und dieser wieder an einem noch höheren Himmelshaken …
ad infinitum. •••
Zurück
[13] Auch der Heyne-Verlag ließe sich da wegen seiner Aufbereitung der
»WÄCHTER«-Tetralogie von Lukianenko rügen. Legt die gewichtige Mehrheit der (womöglich überwiegend jugendlichen, leichtblendbaren?) Leser tatsächlich Wert auf solche
›Ich tu so, als ob ich dicker (= wichtiger? seriöser?)
wär‹-Ausgaben? Ist das so ein haptischer Fetischismus? Bestehen richtige Genre-Leser womöglich auf derartig aufgeblähte Mimikri-Ziegel? •••
Zurück
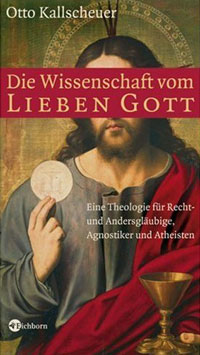 Vergnügt hat mich das Buch schon, auch und gerade indem es mich uffgeregt und genervt hat. Kallscheuer babbelt die meiste Zeit derart flappsig und kalauernd daher, dass ich mich frug, ob ich es hier mit einem (Möchtegern-)Komiker zu tun hab. Den glaubensverteidigenden Humorleistungen eines G. K. Chesterton kann Kallschauer jedoch nicht das Wasser reichen und so wirkt die Witzischkeit von »Die Wissenschaft von Lieben Gott« desöfteren mehr wie aufgesetztes Ornament, nicht wie tragende Struktur. Die besteht leider aus jenem (für mich Ungläubigen mal zutiefst unheimlich, mal putzig anmutendem) kirrem, sturem und treuherzigem Postulieren von Absolutismen, also ›Überdrübergehtnixmehr‹-ismen, welche unter dem exotisch und ehrwürdig klingenden Namen Theologie angeredet werden dürfen.
Vergnügt hat mich das Buch schon, auch und gerade indem es mich uffgeregt und genervt hat. Kallscheuer babbelt die meiste Zeit derart flappsig und kalauernd daher, dass ich mich frug, ob ich es hier mit einem (Möchtegern-)Komiker zu tun hab. Den glaubensverteidigenden Humorleistungen eines G. K. Chesterton kann Kallschauer jedoch nicht das Wasser reichen und so wirkt die Witzischkeit von »Die Wissenschaft von Lieben Gott« desöfteren mehr wie aufgesetztes Ornament, nicht wie tragende Struktur. Die besteht leider aus jenem (für mich Ungläubigen mal zutiefst unheimlich, mal putzig anmutendem) kirrem, sturem und treuherzigem Postulieren von Absolutismen, also ›Überdrübergehtnixmehr‹-ismen, welche unter dem exotisch und ehrwürdig klingenden Namen Theologie angeredet werden dürfen. Zudem: Ulkige Fehler lassen sich finden. Kallscheuer zitiert zwar alle möglichen obskuren Katholen mit Inbrunst, aber aus dem ägyptischen, einen Falkenkopf tragenden Gott Horus macht er einen ›Stiergott‹ (S. 161), und aus Hergé, dem Schöpfer von Tim & Struppi, wird ›Hervé‹ (S. 386).
Zudem: Ulkige Fehler lassen sich finden. Kallscheuer zitiert zwar alle möglichen obskuren Katholen mit Inbrunst, aber aus dem ägyptischen, einen Falkenkopf tragenden Gott Horus macht er einen ›Stiergott‹ (S. 161), und aus Hergé, dem Schöpfer von Tim & Struppi, wird ›Hervé‹ (S. 386).
 Mit den beiden letzten Kapiteln leistet Shippey entsprechende Klärung zum »Silmarillion« und den kleineren Schriften Tolkiens. Da ich hoffentlich bereits genug Beispiele der klugen Beschäftigung Shippeys mit den Eingeweiden von Tolkiens Weltenbau angeführt habe, möchte ich das Augenmerk der geneigten Leser nun lieber auf die Einleitung und den Epilog von Shippeys Schatzkiste von einem Buch lenken. Diese beiden Teile sind nicht nur für Leser von Interesse, die ihre Sicht auf Tolkien schärfen möchten, sondern schildern anregend den merkwürdigen literaturkritischen Diskurs zu Tolkien und Phantastik. Shippey geht den Argumenten der Kritiker Tolkiens und dem überraschenden Erfolg vor allem von HDR auf den Grund, mit (wie ich finde) einer erfrischenden Portion streitbarer Plausibilität. Die Begeisterung des Publikums für Mittelerde wird drastisch kontrastiert durch die Ausgrenzung der Mehrheit der Gärtner der so genannten ernsthaften Literaturzirkel. Ein Exempel für die gespaltene Zunge der Kritik liefert Shippey z.B. mit Philip Toynbee, der 1961 in einem Artikel für die »Times« schrieb, dass die Kriterien, die ein guter Schriftsteller zu erfüllen habe, sein sollen:
Mit den beiden letzten Kapiteln leistet Shippey entsprechende Klärung zum »Silmarillion« und den kleineren Schriften Tolkiens. Da ich hoffentlich bereits genug Beispiele der klugen Beschäftigung Shippeys mit den Eingeweiden von Tolkiens Weltenbau angeführt habe, möchte ich das Augenmerk der geneigten Leser nun lieber auf die Einleitung und den Epilog von Shippeys Schatzkiste von einem Buch lenken. Diese beiden Teile sind nicht nur für Leser von Interesse, die ihre Sicht auf Tolkien schärfen möchten, sondern schildern anregend den merkwürdigen literaturkritischen Diskurs zu Tolkien und Phantastik. Shippey geht den Argumenten der Kritiker Tolkiens und dem überraschenden Erfolg vor allem von HDR auf den Grund, mit (wie ich finde) einer erfrischenden Portion streitbarer Plausibilität. Die Begeisterung des Publikums für Mittelerde wird drastisch kontrastiert durch die Ausgrenzung der Mehrheit der Gärtner der so genannten ernsthaften Literaturzirkel. Ein Exempel für die gespaltene Zunge der Kritik liefert Shippey z.B. mit Philip Toynbee, der 1961 in einem Artikel für die »Times« schrieb, dass die Kriterien, die ein guter Schriftsteller zu erfüllen habe, sein sollen: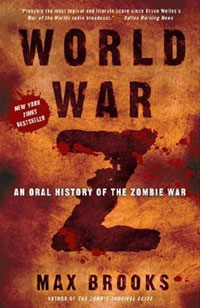



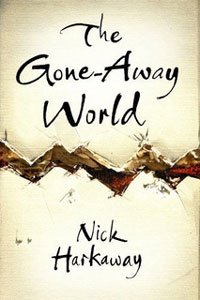
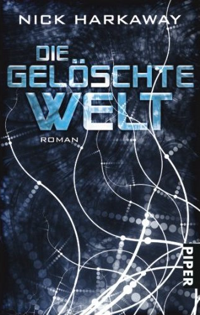 Die im ersten Viertel des Buches hervortretenden politischen Wirren konzentrieren sich in einer Abschweifung wirtschaftliche Begehrlichkeiten auf globaler Bühne, wenn Harkaway über das Hickhack um das fiktive Land Addeh Katir (irgendwo an den Ostausläufern des Himalajas gelegen) sehr trefflich über die finstereren Machenschaften des neoliberalen Großkapitalwahnsinns und fatal-hirnloser internationaler Gierdiplomatie fabuliert. In dieser Fremde geraten der Erzähler und sein Kumpel Gonzo schließlich in die Nicht-Kriegswirren um Addeh Katir, und hier, etwa zur Halbzeit, beginnt sich der Roman endgültig zu einem überwältigenden Pandämonium zu entfalten, wenn wir lernen die Go Away-Bomben zu lieben und das kosmische Grauen aus dem freigesetzten, wankelmütigen »Zeugs«-Gewaber und dem Gestobe menschlicher Träume und Ängste steigt. Durch Go Away-Bombon beraubt man Materie und Wesen ihrer sie in Gestalt haltenden Information und verwandelt sie damit in »Stuff«. Die nichteinkalkulierte Knieschußfolge ist, dass sich dieses »Zeugs« und alles was mit ihm in Kontakt kommt planlos neue Informationen aus der Noospähre
Die im ersten Viertel des Buches hervortretenden politischen Wirren konzentrieren sich in einer Abschweifung wirtschaftliche Begehrlichkeiten auf globaler Bühne, wenn Harkaway über das Hickhack um das fiktive Land Addeh Katir (irgendwo an den Ostausläufern des Himalajas gelegen) sehr trefflich über die finstereren Machenschaften des neoliberalen Großkapitalwahnsinns und fatal-hirnloser internationaler Gierdiplomatie fabuliert. In dieser Fremde geraten der Erzähler und sein Kumpel Gonzo schließlich in die Nicht-Kriegswirren um Addeh Katir, und hier, etwa zur Halbzeit, beginnt sich der Roman endgültig zu einem überwältigenden Pandämonium zu entfalten, wenn wir lernen die Go Away-Bomben zu lieben und das kosmische Grauen aus dem freigesetzten, wankelmütigen »Zeugs«-Gewaber und dem Gestobe menschlicher Träume und Ängste steigt. Durch Go Away-Bombon beraubt man Materie und Wesen ihrer sie in Gestalt haltenden Information und verwandelt sie damit in »Stuff«. Die nichteinkalkulierte Knieschußfolge ist, dass sich dieses »Zeugs« und alles was mit ihm in Kontakt kommt planlos neue Informationen aus der Noospähre
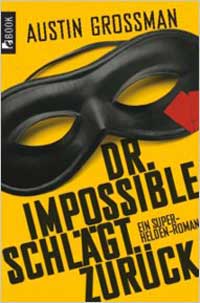
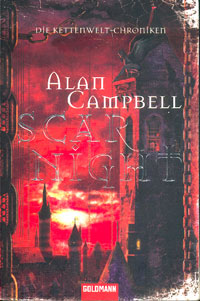
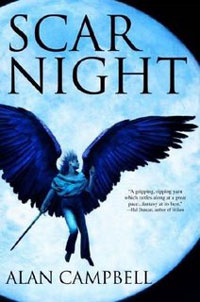 Wie dem auch sei. In Teil 1, wird mir erstmal die an Ketten über einem Abgrund hängende Stadt Deepgate vorgestellt.
Wie dem auch sei. In Teil 1, wird mir erstmal die an Ketten über einem Abgrund hängende Stadt Deepgate vorgestellt. 





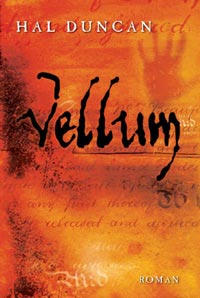
 Zwei Dinge dünken mir bei »Vellum«, im Guten, bemerkenswert. Erstens der gewollt rand- und bandlose Umgang mit Genregrenzen, wenn mythische und utopische Register wechseln, wenn sich klar verortbare Genre-Stimmungen, wie beispielsweise Kriegs- und Spionageabenteuer, mit vom magischen Realismus bekannter doppelbödigen Stimmungspoesie verquickt. Da lässt sich nicht auseinanderklamüsern wie die mythische Archaik aufhört, in modernen Horror übergeht und die fetzige Cyperpunk-SF beginnt, denn gemäß der alles ihren Weltenbrandstrudel ziehenden Logik gemäß ist hier alles stets im Übergang und ein Vor- oder Nachecho seines gewandelten Selbst. Sprachlich versteht sich Duncan zuallermeist vorzüglich darauf, Punk-Jargon mit sakralem Mythenton zu kreuzen, zwischen legendengesättgtem Fantasygeraune und Science Fiction-typischen Gadgetsprech zu wechseln, auf abgefahrene Traumbildcharaden Schilderungen von realistischen Echtweltszenen folgen zu lassen. Zweitens, und das geht mit eben ausgeführten Stil- und Genremix prächtig Hand in Hand, beziehungsweise ist eine Folge davon, meistert Hal Duncan erzählend ein Desorientungshütchenspiel mit den fundamentalen Wirklichkeitskathegorien Ort, Zeit und Identität. »Nix ist fix« scheint das Buch mir als Leser einflüstern zu wollen, und nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass Mich-treiben-lassen ohne Orientierung von diesem Durcheinander von mir gefordert wird, traten um so deutlicher die starken Gefühle der Figuren und die spezifischen Orts- und Zeitstimmungen (ob historisch oder andersweltlich) als eigentlich bestimmende Motive hervor. Da kommt dann unter anderem zur Sprache: Der Schmerz derer, die Verfolgung, Ausgrenzung und Folterung erleiden (oder zufügen), oder deren geistiger Halt durch den Verlust des/der Geliebten zerrissen wurde; der rebellische Trotz derer, die dem Schöpfer- und Ordnungszwang der selbstgerechten Positivisten ein trotziges Nein entgegenstellen; die schamgepeinigte Einsamkeit der Verräter und Feiglinge; das Erschrecken von Liebenden über die Mächtigkeit ihrer eigenen Leidenschaft.
Zwei Dinge dünken mir bei »Vellum«, im Guten, bemerkenswert. Erstens der gewollt rand- und bandlose Umgang mit Genregrenzen, wenn mythische und utopische Register wechseln, wenn sich klar verortbare Genre-Stimmungen, wie beispielsweise Kriegs- und Spionageabenteuer, mit vom magischen Realismus bekannter doppelbödigen Stimmungspoesie verquickt. Da lässt sich nicht auseinanderklamüsern wie die mythische Archaik aufhört, in modernen Horror übergeht und die fetzige Cyperpunk-SF beginnt, denn gemäß der alles ihren Weltenbrandstrudel ziehenden Logik gemäß ist hier alles stets im Übergang und ein Vor- oder Nachecho seines gewandelten Selbst. Sprachlich versteht sich Duncan zuallermeist vorzüglich darauf, Punk-Jargon mit sakralem Mythenton zu kreuzen, zwischen legendengesättgtem Fantasygeraune und Science Fiction-typischen Gadgetsprech zu wechseln, auf abgefahrene Traumbildcharaden Schilderungen von realistischen Echtweltszenen folgen zu lassen. Zweitens, und das geht mit eben ausgeführten Stil- und Genremix prächtig Hand in Hand, beziehungsweise ist eine Folge davon, meistert Hal Duncan erzählend ein Desorientungshütchenspiel mit den fundamentalen Wirklichkeitskathegorien Ort, Zeit und Identität. »Nix ist fix« scheint das Buch mir als Leser einflüstern zu wollen, und nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass Mich-treiben-lassen ohne Orientierung von diesem Durcheinander von mir gefordert wird, traten um so deutlicher die starken Gefühle der Figuren und die spezifischen Orts- und Zeitstimmungen (ob historisch oder andersweltlich) als eigentlich bestimmende Motive hervor. Da kommt dann unter anderem zur Sprache: Der Schmerz derer, die Verfolgung, Ausgrenzung und Folterung erleiden (oder zufügen), oder deren geistiger Halt durch den Verlust des/der Geliebten zerrissen wurde; der rebellische Trotz derer, die dem Schöpfer- und Ordnungszwang der selbstgerechten Positivisten ein trotziges Nein entgegenstellen; die schamgepeinigte Einsamkeit der Verräter und Feiglinge; das Erschrecken von Liebenden über die Mächtigkeit ihrer eigenen Leidenschaft.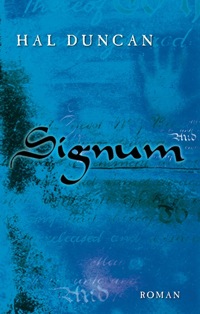

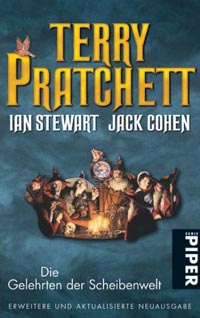
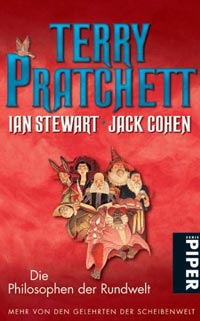 In
In