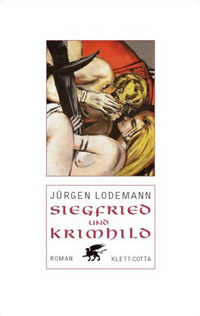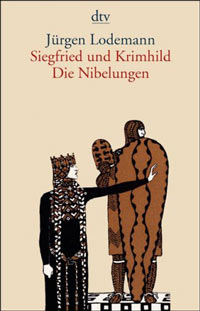Die wilden Welten von Matt Ruff (1): Ein persönlich gefärbter Werksüberblick
{07. November 2009: Der ürsprüngliche Eintrag über »Bad Monkeys« und die Romane von Matt Ruff wurde durch die erweiterte »Magira 2008«-Fassung ersetzt.
}
Für
»Magira 2008« habe ich anders als in den Jahren zuvor und danach keine Sammelrezension geliefert, sondern mich auf das Werk eines einzigen Autors – Matt Ruff – konzentriert.
Für die Molochronik-Leser habe ich diesen langen Beitrag in zwei Teilen aufbereitet. Hier könnt Ihr meinen persönlich gefärbten Werksüberblick zu den bisher vier Roman von Matt Ruff lesen. —
Teil zwei enthält mein Gespräch mit Matt, dass ich anläßlich seiner
»Bad Monkeys«-Deutschlandlesetour im Februar 2008 in Frankfurt führen konnte.
Wie immer habe ich den Herausgebern Michael Scheuch und Hermann Ritter, den Korrekturlesern und Layoutern von »Magira« für ihre Unterstützung zu danken. Besonderen Dank schulde zudem ich dem Hanser-Verlag für seine Aufgeschlossenheit, sich auf einen Amateur-Journalisten wie mich einzulassen, und natürlich danke ich Matt Ruff selbst für seine Großzügigkeit und seine Hilfe bei der Nachbearbeitung des Interviews.
Bei
Wieland Freund möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich seine Schriften stellvertretend im Folgenden als Sandsack für Argumentationsschläge missbrauche.
•••••
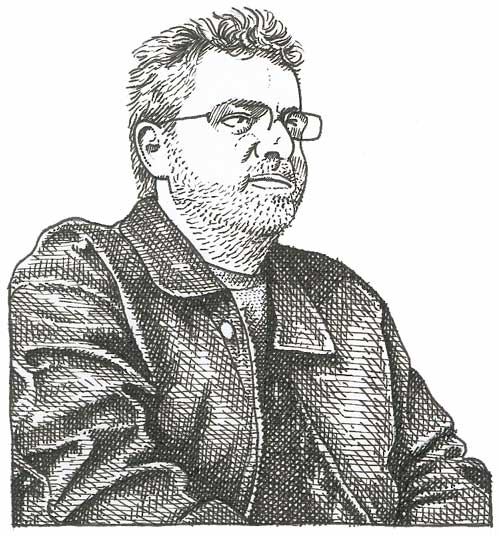 Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.
Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.
Matt Ruff hatte es als 23-Jähriger das Glück, mit einem solchen Kultbuch zu debütieren: »Fool on the Hill« (1988). Wohl besser als gelehrige Beschreibungen, veranschaulicht wie ich finde Folgendes, was ein Kultbuch auszeichnet. Als ich vor gut 15 Jahren einem mit Herzeleid und Sinnkrise geschlagenen Freund eine deutsche Taschenbuchausgabe »Fool on the Hill« geschenkt habe, und wir uns nachdem er es gelesen hatte auf einer Fantasy-Con wieder begegneten, raunte mir dieser Freund dankbar zu, wie erstaunlich punktgenau dieser Roman tröstende Kraft und gemütserweiternden Perspektivwechsel gespendet hat. Ruff ist bei Weitem nicht der einzige moderne Phantast, der über die Macht und die Magie des Geschichtenerzählens schreibt, aber als mir mein Freund dann erzählte, dass er abwechselnd dachte, beim Lesen Wahnsinnig oder erleuchtet zu werden und zeitweise den Verdacht hegte, das ich Gott sei, merkte ich auf. Einmal, weil es selbst unter guten Freunden peinlich und beschämend ist, wenn man derart heftige Komplimente entgegenzunehmen hat, dann auch, weil dieses Gespräch auch für mich ein Aha-Erlebnis war. Mein Temperament als vorlauter Skeptiker und Fan des Abstrusen machen es mir schwer mit allzu tröstlichen oder idyllischen Stoffen warm zu werden. »Fool on the Hill« empfahl ich damals gerne, weil der Roman flotten Popkornspaß bietet und dennoch Tiefgang hat, weil er augenzwinkernd Popkulturanspielungen anbringt und auf überraschende Art aus dem System springt, Seitenschritte macht, die mich zu Grübelein und Gedankenwanderungen anregten. Mein Freund machte mir klar, wie wichtig diese Fähigkeit von Romanen sein kann, wenn uns Lesern durch sie reinigende Erregungen, tröstendes Kopfzurechtrücken zuteil wird.
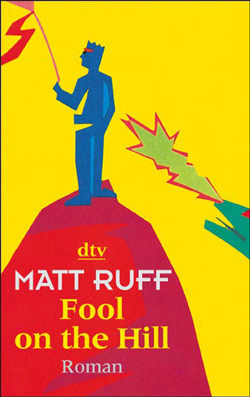 »Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.
»Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.
Worum geht es? Zentraler Held ist Stephen Titus George, ein Geschichtenerzähler, also ein Lügner, der eine Hilfsdozentenstelle an Cornell Uni inne hat; der sich optimistisch aber einsam nach der ganz großen Liebe sehnt; der beim Drachensteigenlassen mit Hunden über seine fehlgeschlagenen Liebelein plaudert; der gesegnet ist mit dem Talent durch seinem Tanz den Wind zu beschwören und nicht ahnt, dass er von niemand geringeren als einem über alle Geschehnisse des Romans wachenden griechischen Gott (ebenfalls ein Fabulator aus Leidenschaft) auserkoren wurde, ein Heiliger der Tagträumerei zu sein, ein Drachenbezwinger zur Bewahrung des chaotisch-friedlichen Miteinanders der Campus-Welt in der Nußschale. — »Fool on the Hill« erzählt aber auch die Geschichte von dem naiven Mischlingshund Luther und dem auf ihn aufpassenden Kater Blackjack, die sich von der Süd-Bronx aus aufmachen den Hundehimmel zu finden, und deren Queste, bei der sie den Groll von faschistoischen Hunderudeln auf sich ziehen, sie zur Ithaca-Uni führt. — Schließlich ist das Campusgelände auch die Heimstätte von kleinen Elfenwesen, unter ihnen tollkühne Modellflugzeugpiloten und -Schiffskapitäne, die nächtens Tiere aus dem medizinischen Versuchslabor zu befreien trachten und sich vor der Rückkehr des Koboldmagiers Rasferret und seiner Rattenarmee fürchten. Dieser in der Büchse der Pandora begrabene Wicht vermag Lebloses in golemartige Killermonster zu verwandeln, am schrecklichsten gelingt ihm das mit der horrorverbreitenden Gummibraut, dem Sexpuppenmaskottchen einer von Mittelerde begeisterten Studentengruppe des Tolkienhauses. Davor, daneben und dazwischen tummeln sich viele kleine Geschichten in der Geschichte wie die vom Mann mit der Phobie vor der Zahl 13, dem Einritt der subversiv-anachistischen Bohemier-Studentenkumpel von Stephen in ein Provinzkaff und ihr dortigers Gefecht mit einer Bikergang. Die vielleicht schönsten Eigenschaften von »Fool on the Hill« sind, dass der Roman trotz der ein oder anderen wackeligen Stelle überhaupt funktioniert, und der abenteuerliche, gerade mit der richtigen Priese Melancholie gesprenkelte Optimismus, mit dem der Roman seine Leser entlässt.
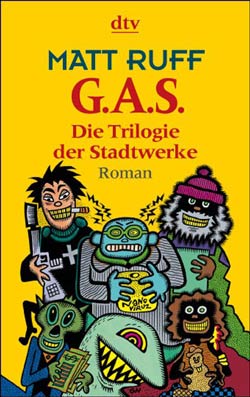 Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).
Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).
Oberflächlich betrachtet wird den Lesern hier eine wendungsreiches ›Science Fiction Fantasy Verschwörungsthriller‹-Prosacomic geboten. Die atemberaubenden Tumultszenen von »G.A.S.« wirken auf mich, als ob sie einem der exzellenteren SF-Animes, wie »Akira« oder »Robot Angel«, entfleucht sind. »G.A.S.« ist, was die bitterböse Groteskerie seiner phantastischen Übertreibungen angeht, der satirischste und bittertste Roman von Ruff, was sich vor allem in den Ungeheuerlichkeiten des übertriebenen politisch-gesellschaftlichen Aspekten Weltenbaus niederschlägt. Aber Ruff gibt Acht, dass seine Sprache nicht ausser Rand und Band gerät, sondern er präsentiert seine schrägen Ideen und facettenreichen Diskurse des Buches mit lockerem Ton und lebendigen Reden.
Die Jahre 2023 angesiedelte, jedoch immer weider von Rückblenden unterbrochene Handlung, konzentriert zum einen auf New York, wo der reichste Mann der Welt, der Erfinder und Großindustrielle Harry Gant einen gigantischen neuen ›Babel Tower‹ errichtet hat, zum anderen auf Schauplätze in Florida, den Atlantik und Kalifornien. Gant hat sein unverschämt vieles Geld mit den sogenannten ›Elektronegern‹ verdient, Androiden die groß in Mode kamen, nachdem fast die gesamte schwarzhäutige Weltbevölkerung von einer mysteriösen Seuche ausradiert worden ist. Ein Wall Street-Konkurrent von Gant wurde, wie es scheint, von einem solchen Roboter dem die durch Isaac Asimov bekannten Sicherungen durchgebrannt sind gekillt, was natürlich ganz schlecht für Gants Geschäftsimperium wäre. Also engagiert er der Publicity wegen seine radikalliberale Ex-Frau, die sich zusammen mit einem fast 200 Jahre alten Veteran des Amerikanischen Bürgerkrieges aufmacht, den Mord aufzuklären. — Auch die bunte Ökoterroristentruppe um den begnadeten Saboteur-Künstler Philo Dufrense bereitet mit ihrem bunten Wunder-U-Boot ›Yabba-Dabba-Do‹ dem megareichen Industriekapitän Gant Probleme. Darüberhinaus sorgt ein mutierter Monsterhai namens Meisterbrau in den Kanalisationseingeweide von New York für Angst und Schrecken und irgendwo hinter den Kulissen heckt eine durchgeknalle Künstliche Intelligenz wegen eines Hörfehlers Pläne aus, die selbst Hartgesottenen eine Gänsehaut bescheren dürfte. — Der Roman knöpft sich kreuz und quer in diesem schnellgeschnittenen Gewusel sehr frech und engagiert verschiedene brachial-positivistische Gesellschaftsknetenwoller und ihre Großraumphantastik vor.
Egal wer »Hurrah, die Zukunft gehört uns!« ruft, ob Kapitalisten, christliche Pfadfinder, Geheimdienststrippenzieher oder die Verwalter des dunklen Vermächtnis von Disneyland, sie alle bekommen ihr Fett ab. Am aufregendsten ist dabei die in »G.A.S.« stattfindende Auseinandersetzung mit der bei uns weitestgehend unbekannten Ayn Rand, Erfinderin des ›Objektivismus‹, einer vulgär-materialistischen Kapitalismus- und Egoismusverherrlichung. Rand inspiriert bis heute als frappierend humor- und emphatiefreies Pinupgirl Chicago-Boys, Neocons & Neoliberale. Trotz all der munter-skurielen Abstrusitäten und der zahllosen schrägen Typen wird der Leser am Ende in eine etwas bedrückende Stimmung entlassen, was aber angesichts des seit Erscheinen des Romanes ehr heftiger als milder gallopierenden Infowar-Wahnsinns die angemessene Spötterei auf hegemoniestützende Märchen vom Ende der Geschichte ist. Also ist Vorsicht oder Lesewagemut gefordert, damit man beim Lesen nicht von auf mehrfache Schallgeschwindigkeit beschleunigten Salamis K.O. geschlagen wird.
Um die für meinen Geschmack beeindruckende Reifung von Matt Ruffs Schreiben zu beschreiben, die sein nächstes Buch markiert, will ich kurz innehalten, um über die Reize und Gefahren seiner, und allgemein über phantastische Fabulationen, zu sinnieren und zwar im mir eigentlich gar nicht behaglichen, ja sogar unsympathischen weil anmaßenden ›Wir‹-Modus.
{Wir-Modus an} Aufmerksame Beobachter der kulturellen Weltläufte sagen, dass um ums herum ein Paradigmenwechsel abläuft. Das geschriebene Wort wird verdrängt vom photographierten, vom gefilmten, vom digital zusammengezauberten Bild. Keinesfalls teile ich die Ansicht, dass die erzählende Literatur durch diese vermeintlich unheilvollen Entwicklung ins Abseits gerät. Aber wer allein und lediglich schreibend erzählt, sieht sich vor die Wahl gestellt, ob man sich auf Leser spezialisiert, welche die neuen Medien meiden um lieber in den pietätvollen Gefilden der Literatur zu bleiben, oder ob man es als Geschichtenerzähler wagt, sich den Herausforderungen durch Blockbuster-Kino, TV-Serien und Computerwelten zu stellen. Wir, die mit zweiterem als etwas Selbstverständlichem aufgewachsen sind, und denen die Freuden und den Wert des ersteren nahezubringen man sich bei unserer Erziehung mühte, tun uns zuweilen schwer damit, wie vom Kulturestablishment unsere Popkultur als nichtiger oder gar gefährlicher Tüdelkram in die Schämecke geschickt wird. Man verzeihe mir, wenn ich zur Veranschaulichung hier einen fragmentarischen Remix einer solchen Skeptik zu den Freuden popkulturellen Fabulierens präsentiere:
Ruff ist ein Bewohner des Weltinnenraums, dieser vollklimatisierten, bildschirmgepflasterten, in sich selbst verdrehten Zone. … ein Nerd … Ruff bedient sich, wo er will … wie gerne Kinder sich Höhlen bauen, um darin zu kuscheln … Ruff kuschelt auch … (Fantasy ist unter anderem ein Globalisierungsphänomen) … Politisch korrekt war das bei Lichte besehen nicht, doch hat Ruff die Gabe, es dem Leser so gemütlich zu machen, dass der lieber liest, als nachzufragen. … Bilderbuch-Liberaler. … Manchmal allerdings geht es eben durch mit dem politisch korrekten Matt, vor allem beim Rennen, Retten, Flüchten und Schlagen und Schießen und Bluten. Eigentlich kommt kein Ruff-Plot ohne Tom-und-Jerry-Finale aus. … Am Ende spielen alle Bücher des Matt Ruff im Weltinnenraum der Fiktion und alles Außerhalb ist ihnen ein fernes, kaum mehr verständliches Echo.
{01}Nicht alle von uns, die wie Matt Ruff selige Tage der Adolszenz mit Rollenspielen, Comics, Soap- und SF-Serien verbracht haben, bleiben ewig treudoof unkritisch gegenüber unseren mit Postern, Action-Figures und Franchise-Icons geschmückten Kuschelhöhlen. Trotzdem (oder durchaus auch weil) wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit mit solchen Dingen wie Superheldenbiographien, Trading Cards und nicht zuletzt Weltenbau vertändeln, haben wir ein Gespühr sowohl dafür entwickeln können, dass sich die Athmo des Inneren so mancher altehrwürdigen Elfenbeintürme der Großraumphantastik-Verwalter kaum unterscheidet von der unserer infantilen Höhlen, und wie sensibel die Kulturtechniken zur Entwicklung, Installation, Instandhaltung von, und des Austausches zwischen Parzellen des klimatisierten (sprich: künstlichen) Weltinnenraums der Fiktion ist. Auch wir Fans von zuweilem arg schriller und eskapistischer Phantastik können, wie es ein Kenner der Materie beschreibt, mittels dieser
zu den Wurzeln unseres Denkens und Verhaltens vorzustoßen, was den Einzelnen befähigt, wieder Herr zu werden über seine Entscheidungen.
Freilich kann man nun trefflich streiten darüber, welche Phantastik seriöse »distentzierende Erkenntnisakte«, und welche nur liederliche, gar schädliche Ablenkung und Betäubung fördert.{02} {Wir-Modus aus}
 Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das
Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das
{w}as die seriöse Phantastik vom bloßen Obskurantentum trennt, sei es von seinen literarischen oder auch von den heute ins Kraut schießenden pseudokultischen Ausprägungen, der Umstand {ist}, dass sie nicht einer Droge ähnlich wirkt, sondern den Leser durch die literarische Gestaltung der Angst in einen Zustand erhöhter Alarmbereitschaft versetzt.
{03}Der englische Nebentitel lautet ›A Romance of Souls‹, was man in etwa mit ›Eine Abenteuergeschichte von Seelen‹ eindeutschen kann, und das ist wortwörtlich gemeint. Hier geht es um zwei Menschen, die mit dem so genannten ›Multiplen Persönlichkeits Syndrom‹ geschlagen sind. In der Realität wird diese Diagnose noch ziemlich heftig debattiert, was nicht verwunderlich ist, handelt es sich doch bei Fragen dazu, wie denn genau unsere inneren Welten beschaffen sind und funktionieren noch um eine Problematik, die sich nicht mit der objektiven Phantasie ergründen lässt, auch wenn wir in Zeiten leben, in denen man täglich über neue Meldungen den Medien stolpern kann zur wissenschaftlich-instrumentellen Erforschung dieses dunkelsten aller Weltenterrains.
Während Andy über seinem Zustand Bescheid weiß und damit ganz passabel umzugehen gelernt hat, hat die von Black-Outs geplagte Penny keinen Schimmer davon, dass viele konkurrierende Teilpersönlichkeiten sich um ihren Körper kabbeln. Im Milieu der Seattle’schen New Economy begegnen sich Andy und Penny als Mitarbeiter einer IT-Spiele-Firma namens ›Virtuell Reality‹, und brechen später auf zu einem irrwitzigen Trip ins Herz der provinziellen USA, um die Vergangenheits-Geheimnisse von Andys Seelenzertrümmerung zu ergründen.
Obwohl dieses dritte Buch von Ruff meistens genauso verspielt und humorig wie seine beiden Vorgänger ist, mutet es seinen Lesern stellenweise extrem gruselige Passagen über innerfamiliäre Grausamkeit zu. Das taugt sicherlich nicht jedem, das schreckt sicherlich manche ab, doch Ruff bleibt anständigt, da er keine Spektakelausbeutung mit dem Thema Kindesmißbrauch und sadistische Eltern betreibt. Ich persönlich fand es da sehr angenehm und passend, dass »Ich und die Anderen« nicht so wirr und trügerisch wie »G.A.S.«, sondern wieder eher wie »Fool on the Hill« versöhnlich-aufrichtender ausklingt. Zudem ist es sprachlich weniger peppig und der dramaturgische Fluß merklich ruhiger als seine beiden Vorgänger.
 2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!
2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!
»Bad Monkeys« ist einerseits ein Kammerstück, eine Charkterstudie, denn die Handlung setzt im Juno 2002 ein, im weißen Raum einer Gefängsnispsychatrie in Nevada, wo ein Dr. Vale die frischverhaftete Mörderin Jane verhört. Diese ›White Room‹-Kapitel sind kurz, auktorial erzählt, rekapitulien beziehungsweise leiten zu den längeren Kapiteln über, in denen Jane als Ich-Erzählerin ihre Lebensgeschichte als ›Bad Monkey‹-Agentin erzählt. Die Art des Verhörhumors läßt sich fein illustrieren anhand weniger Zeilen von S. 3:
»Worin besteht die Arbeit bei Bad Monkeys«, fragte der Arzt, »also was tun Sie? Böse Menschen bestrafen?«
»Nein. Normalerweise töten wie sie einfach.«
Jane ist eine packende, charismatische Erzählerin (obwohl: manche Rezensenten fanden sie unsympathisch. Am Ende des Romanes zu urteilen, ob Jane denn nun sympathisch oder unsympathisch, feige oder mutig, böse oder gut ist, gehört zu den aufregenden Angeboten, die Matt Ruff hier seinen Lesern macht) wenn sie von ihrer wilden Kiffer-Jugend im San Francisco der Siebziger und vom zunehmenden Klinsch mit ihrer Mutter berichtet; davon, wie sie ein netter Polizist zu Verwandten in die hinterletzte Provinz bringt, nachdem ihre Mutter vollends die Nerven verloren hatte, als Jane beim Dope-Anbau erwischt wurde. Schön sachte driftet dann die bisher realistische Welt ins die Gefilde der Verschwörungsphantastik, wenn die jugendliche Jane eine seltsame ›Natürliche Ursachen‹-Knarre findet, mit der man Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen kann, ein Artefakt einer namenlos bleibenden Organisation, von der Jane Jahre später für die Abteilung ›Bad Monkeys‹ rekrutiert wird.
Ganz besonders freut und beeindruckt mich, dass Matt Ruff mit diesem Roman eine hinreissende Homage auf Philip K. Dick — den (für mich) großartigsten Kurzgeschichten-Phantasten der zweitem Hälfte des 20. Jahrhunderts — vollbracht hat. Trotz aller Späßchen und Thrills pulsen die Erz-Fragen von P. K. Dicks Werk (»Was ist Menschlich?«, »Wer bin ich?« und »Was ist Wirklichkeit?«) stets merklich durch den Strang der »Bad Monkeys«-Erzählung. Was habe ich Seite um Seite gestaunt, wie eingängig »Bad Monkeys« ist, und doch zugleich wie verwickelt, mit seinen zig-ineinandergeschachtelten Finten. Der für mich schönste, alles zusammenfassende Weisheitsspruch aus »Bad Monkeys«, der zugleich auch wie kein anderer Satz die Essenz seiner vier Bücher herausdestilliert lautet »Omnes mundum facimus« (»Wir alle machen die Welt«).
••• Zu Teil zwei mit dem Interview.
•••
Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.
•••
BIBLIOGRAPHIE:
»Fool on the Hill« (»Fool on the Hill« 1988); Übersetzung: Ditte König & Giovani Bandini, 576 Seiten; — Gebunden: Hanser (Erstausgabe, vergriffen), 1991; Zweitauendeins, ISBN: 3861504057; — Taschenbuch: DTV, 1993, ISBN: 3423117370.
»G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerke« (»Sewer, Gas & Electric – The Public Works Trilogy«, 1997); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 624 Seiten; — Gebunden: Hanser, 1998, ISBN: 3446192905; — Taschenbuch: DTV, 2000, ISBN: 3423207493.
»Ich und die Anderen« (»Set this House in Order – A Romance of Souls« 2003); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 600 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2004, ISBN: 3446205357; — Taschenbuch: DTV, 2006, ISBN: 3423208902.
»Bad Monkeys« (»Bad Monkeys« 2007); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 251 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2008, ISBN: 3446230025 ; — Taschenbuch: DTV, 2009, ISBN: 3423211792.
•••
ANMERKUNGEN:
01 Wieland Freund:
»Kampfaffen in der Tiefgarage, eine Begenung mit dem Kinoerzähler Matt Ruff«, in »Die Welt« vom 09. Februar 2008. •••
Zurück
02 Paraphrase nach Winfried Freund: »Arbeitstexte für den Unterricht: Phantastische Geschichten«, Seite 90, Reclam 1979/2001. ••• Zurück
03 Ebenda, S. 92.••• Zurück
Jeff Vandermeer: »Die Stadt der Heiligen und Verrückten«, oder: Pilzsporen und Kalmartentakel
Eintrag No. 391
•••
 Ach gucke mal da!, dacht ich mir am Klett Cotta-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2005, als ich deren zweiten Phantastiktrumpf des damaligen Jahres entdeckte. Kommt nicht so oft vor, dass ein Buch neben seinen Konkurrenten auffällt wie ein Artefakt aus einer anderen Welt. Schwarz wie der berüchtigte Monolith auf dem Mond, aber vollgewimmelt mit weißem Text. Erst beim zweiten oder dritten Blick entdeck ich vorne ganz unten in gelb den Titel »Stadt der Heiligen & Verrückten« (The City of Saints & Madmen) von Jeff Vandermeer (1968), daneben der bescheiden posende rote Kett Cotta-Greif.
Ach gucke mal da!, dacht ich mir am Klett Cotta-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2005, als ich deren zweiten Phantastiktrumpf des damaligen Jahres entdeckte. Kommt nicht so oft vor, dass ein Buch neben seinen Konkurrenten auffällt wie ein Artefakt aus einer anderen Welt. Schwarz wie der berüchtigte Monolith auf dem Mond, aber vollgewimmelt mit weißem Text. Erst beim zweiten oder dritten Blick entdeck ich vorne ganz unten in gelb den Titel »Stadt der Heiligen & Verrückten« (The City of Saints & Madmen) von Jeff Vandermeer (1968), daneben der bescheiden posende rote Kett Cotta-Greif.
Schon der Buchrücken wird durch ein zentrales Gestaltungsmotiv des Autoren geprägt: die Collage, dem Mit- und Durcheinander von längeren und kürzeren Fitzeln und Fragmenten, die zusammen etwas gänzlich Neues ergeben. Unter dem Titel und dem Autorennamen prangt wie ein klassisches Emblem ein Detailausschnitt des Front-Covers: Eine sehende Hand mit Auge[01]. Darunter sieben programmatische Wörter, die für einen Dr. V von größtem Interesse sind: hochmütig Dunkelheit tapfer Last Flut Grauhüte Grimasse. Es folgt wiederum ein Bild, diesmal logohaft reduziert: ein grünlicher Kalmar, angeblich das Selbstportrait eines gewissen F. Madnok. Zuletzt eine figürlich-abstrakte, an urzeitliche Symbole erinnernde Männchen-Zeichnung mit dem Titel »Sporer Nr. 2« von Orim Lackpole, ausgestellt im Morhaim Museum. Vordere und hintere Schutzumschlagseite flirren, denn auf ihnen lesen wir in weißer Schrift zwei prosa-lyrische Szenen, die jeweils eine mittig platzierte Illustration umrahmen. Der Text der Vorder- und Rückseite ergibt bereits die erste kleine Geschichte von einem sich nachts in einem Boot auf dem Mott-Fluss der Stadt Ambra nähernden Reisenden, der im Gepäck unter anderem ein Exemplar des Buches »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« hat. Der Reisende plumpst ins Wasser und hat eine unheimlich-visionäre Begegnung mit einem der großen Königskalmare.
Derart ist das ganze Buch, sogar für gewöhnlich harmlose Teile wie ›Andere Bücher des Autoren‹ und ›Biographie‹, von kreativer Devianz befallen. Da tummeln sich fiktive oder noch zu schreibende Bücher von Vandermeer[02], und der Lebenslauf franst ins Mysteriöse aus, wenn er angibt, dass der Autor für einige Zeit als spurlos verschwunden galt. Ein völliges Novum sind die ›Anmerkungen zu den Schriften‹, eine exemplarische Kostprobe von Vandermeers synästhetischem Humor, wenn es z.B. über die Caslon Old Face heißt:
»Nach feinem Leder duftend, nach Sandelholz und Zimt, ist die Caslon trocken, aber samten«;
und zur Times New Roman wird kommentiert, dass sie
»das grobe Fluidum eines zähen Bratens mit der Struktur von Kartoffeln (vereint), und ihrem steinernen Bukett eine feuchte Textur beigemischt (ist)«.
Grob gesagt, ist das vollkommen durchgeknallte, ziemlich elitär-feinsinnige Phantastik, sozusagen 72% Edel-Fantasy-Schoko.
 Doch wie sieht es in dem Buch aus? Jede Übersicht muss hier gröblichst vereinfachen, denn der ›Collage-Roman‹ ist so geradeaus wie ein Korkenzieher für n-dimensionale Weinflaschen. Die erste Hälfte des Buches füllen vier längere Geschichten, die auf Amerikanisch 2002 erschienen. In »Dradin verliebt« erzählt ›ganz normal‹ ein auktorialer Erzähler von einem jungen Missionar des Religionsinstitutes von Morrow, der nach seinem Scheitern aus den südlichen Dschungeln nach Ambra zurückkehrt. Seine überreizte Verliebtheit in eine unbekannte Schönheit verquirlt sich mit dem Fieberwahn einer Geschlechtskrankheit und idyllisch-bitteren Erinnerungen an die Eltern. Schließlich stolpert Dradin, der Möchtegern-Ex-Missionar, durch nächtliche Widrigkeiten ärgerer Güte.
Doch wie sieht es in dem Buch aus? Jede Übersicht muss hier gröblichst vereinfachen, denn der ›Collage-Roman‹ ist so geradeaus wie ein Korkenzieher für n-dimensionale Weinflaschen. Die erste Hälfte des Buches füllen vier längere Geschichten, die auf Amerikanisch 2002 erschienen. In »Dradin verliebt« erzählt ›ganz normal‹ ein auktorialer Erzähler von einem jungen Missionar des Religionsinstitutes von Morrow, der nach seinem Scheitern aus den südlichen Dschungeln nach Ambra zurückkehrt. Seine überreizte Verliebtheit in eine unbekannte Schönheit verquirlt sich mit dem Fieberwahn einer Geschlechtskrankheit und idyllisch-bitteren Erinnerungen an die Eltern. Schließlich stolpert Dradin, der Möchtegern-Ex-Missionar, durch nächtliche Widrigkeiten ärgerer Güte.
Es folgt als Zweites ein Sachtext, der »Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra«, die ein Duncan Shriek für das große Handels- und Verlagshaus Hoegbotten schrieb[03]. Ursprünglich hieß Ambra Cinsorium und war das blühende Kulturzentrum eines Volkes kleiner Pilzmenschen (die im späteren Buchverlauf sogenannten Grauhüte), bis der im mächtigen Mündungsdelta des Mott-Flusses gelegene Ort von Piraten-Kaufleuten (den Katten) entdeckt und in gut räuberisch-›merkantil-imperialer‹ Manier erobert wurde. Hier werden neben vielen anderen Dingen halluzinogen-gesättigte Berichte von Irrwanderungen durch die unterirdischen Gänge der gedemütigten Grauhutkultur vom Historiker abgeklopft; Shriek spekuliert, wie (wenn überhaupt) die Grauhüte besiegt wurden, oder ob sie nicht vielmehr langsam und subversiv Ambra zurückerobern.
Der dritte Text »Die Verwandlung des Maler Martin See« erzählt von der , der durch eine (Nabokov läßt grüßen) geheimnisvolle ›Einladung zu einer Enthauptung‹ in eine brutal-heikle Lage gerät. Der Zwischenfall traumatisiert ihn, macht aber seiner bis dahin brav-zahmen Malerei flotte Beine, und See geht als einer der großen Kunstheroen in die Geschichte der Stadt Ambra ein. Im Hintergrund liefern sich innige Verehrer und Verächter des verschwundenen Komponisten-Titans Voss Bender einen handgreiflichen Straßenkrieg. Zwischen diese wieder auktorial dargestellten Erlebnisse von See fügt Vandermeer Auszüge aus einem Essay über Sees Bilder von der gescheiterten Malerin, (dann) Galeristin und Kunstgeschichtlerin Janice Shriek[04]. Wunderbar der Kontrast zwischen den Schauer-Schilderungen der Abenteuer, Visionen und Alpträume die Martin See zu seinen gerühmten Gemälden treiben, und den in Monographiestilistik gehaltenen Deutungen über Sees Werk und Leben.
Als Viertes folgt »Der seltsame Fall von X«, und man begleitet (wieder auktorial) den ›Vernehmer‹ einer geschlossenen Anstalt Ambras bei seiner Arbeit mit dem Patienten X. Soweit ich das verstanden zu haben glaube[05], soll der Mann in der Zelle niemand anderes als der in seinem Lebenslauf als verschollen gemeldete Vandermeer selbst sein, der dem Verhörer/Arzt Rede und Antwort über seinen Wahn von der Fiktionalität/Realität der Stadt Ambra liefern muss.
Bestes Hin- und Her und Ineinander von echter Welt (hier) und Fantasy-Welt (dort) also. Das Motiv des in seine Fiktion hineingestülpten Autors (bzw. ›Helden‹) ist zwar jetzt nicht sooo brennend neuartig[06], aber Vandermeer traut sich, diese Narrationsschraube schwindelerregend weit zu drehen. Immer wieder, aufeinander verweisend, ineinander geschachtelt, variierend finden verwirrende Bild-, Sprach- und Wirklichkeitsscharaden statt: Über Menschen und Menschenförmiges; über Kalmare, deren Intelligenz der Menschlichen das Wasser reicht und über Menschen, die sich für Kalmare halten; über Zellen, Gefängnisse, Käfige, Labyrinthe und Verwandlungen, aber auch über Impres-sionen, Erinnerungen, Ängste, Träume und Visionen.
Die Frage, was genau ›das Rezept‹ von Vandermeers registerreicher ›Erzählweise‹[07] ist, ließe sich z.B. so präzisieren: Wie schafft Vandermeer es, sich einerseits im besten Sinne dem leidenschaftlichen Schwulst düster-dystopischer Empfindsamkeit hinzugeben, dem aber andererseits mit einer erfrischend trocken-lakonischen Stimmlage gegenzusteuern? Meine Antwort wäre: —Vor allem mit stilistischer Eleganz. So bringt Vandermeer die ureigene Überreiztheit und Hybris der Phantastik, ihre Neigung zu einer monströs-paranoiden Eskapistik der Faszinationen mal witzig, mal berauschend, mal träumerisch, aber immer lebendig zum Schillern. Vor welchem ›Hintergrund‹ könnte man solch schlierenbunte Phantastik-Ästhetik besser glänzen lassen, als vor einem passend-elegantem Strudel finster-undurchschaubarer Komplexität?
In der rätselhafteren zweiten Hälfte, dem »Annex«, um den das Buch in seiner Ausgabe 2004 ergänzt wurde, befindet sich die schriftliche Hinterlassenschaft, die man in der Zelle des verschwundenen Patienten X. gefunden hat, nebst Briefen seines Arztes und Manuskripten anderer Personen. Die literarische Technik, in kleinen Dosen ›hand outs‹ aus der Fiktions- bzw. Phantastikwelt einer Geschichte beizugeben, findet sich ja durchaus mal ein. Kommt schon in jedem Krimi vor, wenn z.B. Zeitungsartikel ›eins zu eins‹ wiedergegeben werden. Für einen Literaten, selbst für einen Phantasten, treibt Vandermeer aber auch diesen Kniff atemberaubend weit.[08]
Doch weiter mit der Buchbesichtigung des Vandermeer’schen Labyrinths. Ein Orientierungsverlust-Schub ergibt sich ab Annexbeginn schon aufgrund der fehlenden oder irreführenden Paginierung, aber wenn ich richtig zähle, dann sind hier elf unterschiedliche Dokumente, Buchauszüge, Broschüren, und sonstige Unterlagen versammelt, inklusive Werbeanzeigen wie:
»Erfahren Sie, warum der Strattonimsus Schwindel ist. (…) Werden Sie Ihr eigener ›Kampfphilosoph‹«
und:
»Strattonismus / Verehre das zweigekammerte Hirn (…) Du kannst die Stimmen in Deinem Kopf beherrschen«.
Der Leser versucht indes, das Stimmenwirrwarr des Buches in den Griff zu bekommen. Gutes Trainingsgerät, um die ›willing suspension of disbelief‹-Muckis bis zum Kribbeln zu reizen.
Für meinen Geschmack ist der ›abgefahrenste‹ Text des »Annex« ist »Der Königs-Kalmar / Als da ist eine kurze Monographie von Frederick Madnok (nebst einigen zusätzlichen Untersuchungen von dem Bibliothekar Candace Harpswallow)«. Hier gibt es eine monströse Bibliographie mit 265 fiktiven Titeln, die sich überwiegend mit Kalmaren befassen. Einige der aufgeführten Titel hat Madnok kommentiert oder zusammenfasst. Er versucht dabei, verschlüsselt von seinen eigenen dunklen Familienerinnerungen zu berichten. Und nebenbei gibt’s dann plötzlich in all diesem Durcheinander köstliche Parodien auf trashige Rumsbums-Genreserien, wenn Madnok die fetzige »Folterkalmar-Serie« einer gewissen (fiktiven) Vivian Price Rogers zusammenfasst und kommentiert.
Auf den »Annex« folgen ca. 50 Seiten mit 130 Glossar-Einträgen über Geschichte, Gesellschaft, Persönlich- und Eigentümlichkeiten der Welt von Ambra. Hier gönnt sich Vandermeer nun als Ausgleich nach all dem empfindsamen Wahnsinn, den aufdringlichen Halluzinationen und unheimlichen Verwandlungen die dicksten Kalauer[09]. Ich muss den euro-chauvinistischen Smutje meines Lese-Schiffs mit Rum ruhigstellen, um ihn davon abzuhalten, mit großem Gewese dem Amerikaner Vandermeer mittels Ordenanheften zum ›literarischen Europäer ehrenhalber‹ zu ernennen. Aber ist so ein Impuls erstaunlich bei einem Autoren, der von sich sagt, dass er am ehesten der Tradition des Magischen Realismus folgt, und der Nabokov und Kubin und Herzmanovsky-Orlando zitiert?
Jeff Vandermeers Debüt in Deutschland ist eines der wenigen Bücher der letzten Jahre, an denen nicht wenig Leser scheitern mögen, was aber die Qualität des Werkes keineswegs in Frage stellt. Okay, der Vorwurf, »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« sei so ›artsy-fartsy‹- oder ›Kunstkacke‹-Phantastik, mag vulgär klingen, liegt aber nur im Ton, nicht sachlich daneben. Das Buch taugt nicht mal mit Schwimmflügeln und Schorchel als U-Bahn-Lektüre, und ich empfehle erregbaren Gemütern ausdrücklich, es nicht zum Einschlafen zu lesen[10].
Allen anderen kann ich nur wünschen, dass in ihnen ebenfalls dieses wunderbare Gefühl erblüht
»… für die unvergleichliche Pracht der Stadt – ihre Liebe zum Ritual, ihre Leidenschaft für die Musik, ihre unendliche Fähigkeit zu schöner Grausamkeit«
.
•••
[02] Mit Titeln wie
»Das trunkene, aber reuige Leben des Cadmion Signal«. •••
Zurück
[03] Annotations-Fetischisten aufgepaßt: Hier gönnt sich Vandermeer durch die Schrulligkeit der Figur Shriek sprechend tollen Fußnotenspaß. Dagegen ist Pratchett zahm! •••
Zurück
[05] Immerhin liegt Ambra am Mott-Fluß, und
›Dr. Mott‹ hieß der Arzt, der Edgar Allan Poe in dessen letzter Phase womöglich mehr schlecht als recht behandelte. Angeblich mit zu laxer Hand, was Morphium, Opium oder sonstiges dunkelromantisches Rauschmittel betrifft. Jedenfalls verschwand Poe spurlos einige Tage, um völlig derangiert, verwirrt und todkrank wiederaufzutauchen und kurz darauf zu sterben. Niemand weiß, was damals wirklich mit ihm geschah. •••
Zurück
[06] Siehe z.B.
»The Blazing World« (1658) der Herzogin Margaret von Newcastle, J. L. Borges, Fernando Pessoa, Michael Ende, Matt Ruff und jüngst im breitfließendem Genre-Mainstream Stephen King in seinem
»Dark Tower«-Epos. Auch Cornelia Funkes
»Tintenherz«-Trio lebt von diesem Motiv. •••
Zurück
[07] Hier könnte im ursprünglichen Sinne des Wortes
›Phantastik‹ stehen; was ich umständlich der Ethymologie des Wortes Phantasie folgend
›medial-narrative Modi, die sich besonders dadurch auszeichnen, daß sie beim Empfänger Bilder, Vorstellungen und Eindrücke sichtbar werden lassen, oder eben für ihn und/oder in ihm erscheinen lassen‹ nenne. •••
Zurück
[08] Klassische Beispiele für literarische Texte, in denen Originalquellen aus der Fiktionswelt als ornamentale Ergänzungen zur Geschichte gereicht werden, sind z.B. Rudyards Kiplings
»With the Night Mail – A Story of 2000 A.D.« (1909) und natürlich Karel Çapeks
»Der Krieg mit den Molchen« (1936). Und sind nicht auch der von Bilbo Beutlin verfaßte Reise- und Abenteuerbericht
»There and Back Again« (Der kleine Hobbit), sowie das von seinem Neffen Frodo und dessen Freund Sam fertig-geschriebene
»Grosse Rote Buch der Westmark« (Der Herr der Ringe)
›Original-Manuskripte‹ aus der Mittelerdewelt, und sind entsprechend z.B. die Lieder und Gedichte nicht solche
›Authentizifizierungsfenster‹ in die Phantastikwelt? •••
Zurück
[09] Mit sprichwörtlichen Reinsteigerschenkelklopfern. Wo immer man das Buch in die Pfoten bekommt, ich empfehle als Kostprobe den Glossareintrag
»Hyggboutten«, so um die vierzigstletzte Seite vom Buchende gezählt zu finden. •••
Zurück
[10] Außer natürlich, man liest auch sonst gerne solche Dinge wie Baudelaire-Verse, Bierce-Fabeln oder Hebbel-Tagebuchnotizen zum Einschlafen. •••
Zurück
China Miéville: »Der Eiserne Rat« und Bas-Lag, oder: Wenn die ›Weird Fiction‹ revoluzzt
Eintrag No. 379
•••
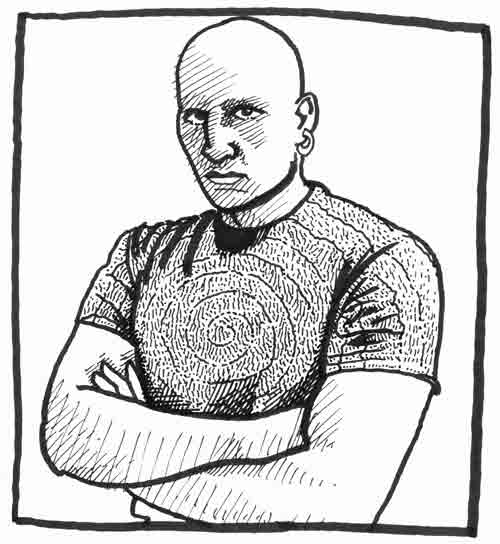 Vorweg der Offenbarungseid: Seit meiner ersten Reise zur »Perdido Street Station«[01] New Crobuzons in der ›Weird Fiction‹[02]-Fantasywelt Bas-Lag bin ich von China Miéville (1972) und seinem Schreiben in zappeliger Fan-Manier begeistert. In noch heftigeres Erstaunen versetzte mich die zweite, diesmal maritime Ausfahrt mit »The Scar«[03]. Entsprechend besorgt und her-ausgefordert bin ich deshalb, ob’s mir denn dermaßen heftig infiziert überhaupt gelingen kann, nicht-peinlich über »Der Eiserne Rat« zu schreiben. Immerhin ist Miéville einer dieser Autoren, die Leserschaften polarisieren. Noch vor wenigen Jahren, im Umfeld des Erscheinens von »Perdido Street Station« und »The Scar«, hat Miéville rabaukig über die ›ausgelatschten‹ Touristik-Pfade in tolkienartige ›Fäntäsyländs‹ gemosert.[04]
Vorweg der Offenbarungseid: Seit meiner ersten Reise zur »Perdido Street Station«[01] New Crobuzons in der ›Weird Fiction‹[02]-Fantasywelt Bas-Lag bin ich von China Miéville (1972) und seinem Schreiben in zappeliger Fan-Manier begeistert. In noch heftigeres Erstaunen versetzte mich die zweite, diesmal maritime Ausfahrt mit »The Scar«[03]. Entsprechend besorgt und her-ausgefordert bin ich deshalb, ob’s mir denn dermaßen heftig infiziert überhaupt gelingen kann, nicht-peinlich über »Der Eiserne Rat« zu schreiben. Immerhin ist Miéville einer dieser Autoren, die Leserschaften polarisieren. Noch vor wenigen Jahren, im Umfeld des Erscheinens von »Perdido Street Station« und »The Scar«, hat Miéville rabaukig über die ›ausgelatschten‹ Touristik-Pfade in tolkienartige ›Fäntäsyländs‹ gemosert.[04]
»Jüngstes Superduper-Genie der anspruchsvollen Genre-Zunft!«, jubeln durch die Phantastikbeete ondulierende Hurra-Schlümpfe wie ich; »›Nett‹, jedoch störend verhunzt durch renitente Marxistenprophetenpolemik«, meinen Skeptiker, und deuten dazu jetzt besonders bei »Der Eiserne Rat« auf die befremdende politische Heftigkeit von Miévilles verdrehter Fabuliererei hin. Später mehr zu diesen ›Vorwürfen‹.
Allein das Kuddelmuddel an Widersprüchen, in die sich Miéville verstrickt, wenn er über die empfohlene Lesereihenfolge der Bas-Lag-Romane spricht: Mal sagt er, dass jeder der drei Bas-Lag-Romane für sich allein genommen ›rund‹ sei; als Text Genuss verschaffen, als Story Substanz, und als Statement Virulenz haben soll. Dann aber nennt er die drei Bücher auch mal locker ›Anti-Tolkien‹-›Anti-Trilogie‹-Trilogie, deren Teile sich in beliebiger Reihenfolge lesen ließen. Und schließlich, dass in der Folge ihres Erscheinens (die auch dem Verlauf der Bas-Lag-Chronologie entspricht) nach »Perdido Street Station« und »The Scar« nun »Der Eiserne Rat« so was wie ein Abschlussstein ist. In mehrfacher Hinsicht wird damit diesem Dritten im Bunde strukturell und programmatisch die Aufgabe aufgebürdet, kulminativer Höhepunkt zu sein. Wurscht, was man sonst über das Fantasy-Genre zu wissen glaubt, sicher ist immer: Der letzte Teil einer Trio lässt die Fetzen nur so fliegen!
Jetzt wäre China Miéville nicht dieser unverschämt talentierte Ideen-Lausbub der er ist, wenn er nicht schon bei der Komposition der Struktur einer Trilogie ›Unsinn‹ anstellte. »Perdido Street Station« und »The Scar« ähneln einander, sind beide noch verhältnismäßig konventionelle Romane. Beide schildern auktorial die Handlung linear von A nach Z. »Perdido Street Station« bietet kleine Intermezzi einer, »The Scar« mehrere Ich-Erzähler-Stimmen, von denen eine auch in längeren Briefauszügen zu Wort kommt. »Perdido Street Station« ist ausschließlich in New Crobuzon (der bratzigsten Industriemetropole der Welt Bas-Lag) angesiedelt und umspannt einen Zeitraum von einem halben Jahr[05]. »The Scar« setzt nur wenig später ein, erstreckt sich über etwa ein Jahr[06] und begibt sich auf eine weite Rundreise durch die östliche Hemisphäre von Bas-Lag mit der schwimmenden ›Gestalt‹-Großstadt Armada (EIN Konkurrent von New Crobuzon beim Rennen um Macht und Reichtum).
Buch drei schlägt nun aus der Art. »Der Eiserne Rat« springt zwischen New Crobuzon und den westlichen Weiten des Kontinents Rohagi hin und her. Es gibt diesmal keine Ich-Erzählerstimme, alles wird aus einer Art auktorialer Vogelperspektive geschildert. Eine lange Rückblende steckt wie ein Fremdkörper im Gewebe des linearen, chronologischen Erzählverlaufs. Der Kernzeitraum der Gegenwartshandlung schildert die Ereignisse eines Jahres[07], die bis zu den Ereignissen der beiden Vorgänger reichende Rückblende aber umfasst einen Zeitraum von etwa 20 Jahren. Obwohl man die beiden Vorgänger nicht gerade als ereignisarm bezeichnen kann, überbietet »Der Eiserne Rat« — das kürzeste der drei Bücher — in fast schon beängstigender Manier die Geschehnisdichte von »Perdido Street Station« und »The Scar«.
Kurzum: »Der Eiserne Rat« ist als Bas-Lag-Einstiegslektüre nur Lesern anzuraten, die als waghalsige Freeclimber ohne Sicherung gern gewillt sind, die schwierigsten Hänge zu erklimmen. Man sollte schon ›einen leichten Schuss‹ haben, oder über so etwas wie ›robuste Lesegeschicklichkeit‹ oder ›Aufnahmeflexibilität‹ verfügen, wenn man mit »Der Eiserne Rat« seine Freude haben will.
Mit einer gewissen ›musikalischen Lesart‹ aber lässt sich diese widersprüchlich daherkommende Trilogie-Partitur als klassisch-dreisätzige Symphonie nehmen. In den einzelnen Sätzen greift Miéville thematisch und bezüglich des Settings auf ein jeweils anderes historisches Vorläufer-Genre der modernen Phantastiksparten zurück. Und jeder der drei Romane beschäftigt sich mit einer anderen Facette zum Thema Magie, die in Bas-Lag größtenteils als Thaumaturgie bezeichnet wird.
So gibt »Perdido Street Station« als urbaner Horrorthriller das Allegro ma non troppo, und ein freischaffender Querbeet-Thaumaturg baut einen Transformator, mit dem sich ›die Macht‹ der allgegenwärtigen Krisis-Energie nutzen lässt. Als Adagio in exile schildert dann »The Scar« eine Entdeckungsabenteuerfahrt von Piraten, und setzt sich anhand arkaner Möglichkeitsmagie mit den quantenphysikalischen Eigenschaften der Thaumaturgie auseinander. »Der Eiserne Rat« darf nun das Finale allegretto extravaganza sein und als großangelegtes, aus den Nähten der üblichen Romanform platzendes Potpourrie dem Eisenbahn-Western seine Referenz erweisen.
 »›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.
»›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.
Nach einem kurzen ›raunend‹-lyrischem Intro über einen Mann, der weiß, dass seine Pläne heilig sind, wird der Leser mitten in die Äktschn des ersten von drei großen Handlungssträngen in den Wald geschickt. Dort erwartet Cutter, ein Ladenbesitzer in den Dreißigern aus dem Gelehrtenviertel, in einer Hahnenkampfgrube seine Revoluzzerkameraden aus dem nahen New Crobuzon. Das Stadtimperium führt Krieg gegen das ferne und quecksilbrig-rätselhafte Tesh. Wie der Krieg losging, weiß niemand mehr so wirklich, sicher ist aber, dass der Konflikt für New Crobuzon bitterer und zäher verläuft, als das herrschende Stadtparlament und dessen Milizia erwartet haben. Die sechs Revoluzzer folgen der Spur des von ihnen allen verehrten, von Cutter sogar sehnsüchtig geliebten Judah, einer Art Guru der Dissidentenszene, der selbst auf der Suche nach dem legendären Eisernen Rat ist. Cutters und Judahs homoerotisch-, tragisch-romantische Liebesgeschichte erzählt von der Asymmetrie des Verlangens, mit für erfolgreiche Fantasy ungewöhnlicher Offenheit und ›Härte‹. Wer Schwulitäten in der Fantasy nicht abkann, sei ein wenig beruhigt. Der diesmal überwiegend knorrige, ›an kurzer Leine gehaltene‹ Sprach- und Szenenrhythmus bewahrt solche Leser davor, seitenlanges Auswalken von Homo-Herzeleid und Sexszenen ›erleiden‹ zu müssen. Alle anderen, denen es wie mir auch piepegal ist, zwischen wem oder was sich eine bewegende Liebesgeschichte abspielt, können Cutters Leiden an seiner eigenen be-dingungslosen Treue zu Judah als gute Darstellung von universellen Problemen lesen, die sich nun mal aus intimer Nähe ergeben. Doch Romanze beiseite, kommt Cutter mit am weitesten herum in der Welt des Romans. Seine ersten fünf Kapitel ist er mit seinen Revoluzzerkumpeln auf sich gestellt. Man reist mal zu Fuß, mal in einem Luftvehikel, mal übers Meer, und es ereignet sich auf diesen ersten 80 von 680 Seiten mehr Äktschn und Hatz, als anderswo im ersten von fünf dickleibigen Büchern.
Der zweite Handlungsstrang begleitet den jungen Dissidenten Ori auf seinem Weg durch die radikale Untergrundszene von New Crobuzon. Zugegeben, Ori vertritt sehr deutlich den Typ des tatendurstigen ›zornigen jungen Mannes‹. Man lernt ihn kennen bei einem außer Rand und Band geratenen Auftritt der Nuevisten, einer Gruppe kritisch-provokativer Agitprop-Aktionskünstler. Ein bissiges Marionettentheaterstück über die Hinrichtung des legendären Volkshelden Jack Gotteshand vor zwanzig Jahren wird gegeben. Ein Zensor der Stadtregierung hat ein wachsames Auge auf diese Michael Moores, und die extrem rechten Schlägerjungs von der Spitzen Feder Partei wollen den linken Provokateuren ans Leder: Tumult, Saloon-, pardon: Vaudeville-Schlägerei par excellence. So cool Ori die kreativen Sticheleien, Aktionen und Happenings der Nue-visten findet, ist er dennoch auf der Suche nach zupackenderen Tatgemeinschaften. Ori hat keinen Bock, seinen Gestaltungsdrang für eine gerechtere und bessere Zukunft mit Diskutierereien zu vertrödeln, und folgt lieber den wirren Weisungen eines alten Fuzzis aus einem Obdachlosenasyl. Dieser irre Alte, Spiral Jacobs, hat Jack Gotteshand noch gekannt und hilft nun Ori, das heikle Initiationsritual der Aktivisten-Zelle von ›Toro mit dem Stierkopf‹ antreten zu können. Nur fair und billig, in heutigen Zeiten die gute alte ›Knappe wird zum Ritter‹-Queste mal mit fanatischen Terrorzellen zu inszenieren (und: dieser Handlungstrang kommt mir zudem vor, wie eine sehr auf den Kopf gestellte Verarbeitung des minoischen ›Minotaurus im Labyrinth‹-Mythos).
Im dritten Gegenwartsabschnitt sind wir wieder mit Cutter unterwegs, diesmal durch die Randzonen des Krieges zwischen New Crobuzon und Tesh. Nach diesen Kriegsgräuel und Flüchtlingsschicksalen folgt die Unterbrechung, die große Synkope der ›Anti-Trilogie‹: Judahs Vorgeschichte, oder genauer, die »Anamnese«[08] vom ewigen Zug. Judah hat vor vielen Jahren als Kundschafter für den visionären Industriekapitän Wrightby das Sumpfland des Stiltspear-Volkes erforscht. Wrightby wollte das Unmögliche schaffen und eine Eisenbahnlinie westwärts quer durch den ganzen Kontinent errichten. Als die Bautruppen den Sumpf erreichten, konnte Judah nichts ausrichten und Wrightbys Unternehmen verdrängt die Stiltspear, wie alles andere, was sich dem Zug in den Weg stellt. Judah versucht verzweifelt, so viel wie möglich von der Stiltspearkultur zu bewahren und zu lernen. Dazu gehört die seltsame Kunst, Zeit zu manipulieren, welche schon Kinder üben, indem sie kleine, ungeschickte Matschmännlein machen. Nach der Zerstörung des Lebensraums der Stiltspear will Judah nichts mehr mit Wrightby und seinem ›Trancontinental Railway Trust‹ zu tun haben, kann sich jedoch dem Sog des Zuges nicht entziehen und bleibt so in dessen wuseligem Umfeld. Hier gibt es nun ordentlich viel Wilden Westen, und mittendrin Judah als Mann vieler Karrieren in den schnell entstehenden und wieder verfallenden Orten am Rande der Gleise, zwischen Kopfgeldjägern, Eisenbahnräubern, Spielern, Duellisten und Streckenbauern. Judah lässt sich auf ein junges wildes Landei ein, Ann-Hari, die sich lebenshungrig als Hure dem Eisenbahn-Tross anschließt. Für einige Zeit gehen die beiden nach New Crobuzon, und Judah beginnt sich intensiv mit Golemetrie zu beschäftigen.
Dieses bewusste Eingreifen in den Lauf der Dinge, diese Unterbrechung und Neuausrichtung von Vorgefundenem ist das magische Hauptthema dieses Bas-Lag-Romans. Judah wird zu einem Genie in der Kunst des thaumaturgischen Formatierens von ›Etwas‹ zu einem meist menschenförmigen Wesen und dem Programmieren dieser Wesen zu selbsttätig handelnden Agenten. Atemberaubend, woraus Judah im Lauf seines Lebens alles Golems macht[09], oder wie er diese Kunst mit Uhrwerken zu Zeit-bomben und Fallen ›verfeinert‹.
Zu den aufregenden Gedankenspielen Miévilles über Golemetrie gehört etwas, das man Judahs ›inneren Moral-Golem‹ nennen könnte. Diese ›Gutheit mit eigenem Willen‹ hat ein alter Stiltspear in Judahs Brust als Abschiedsgeschenk erweckt. Eine bewegende Szene und typisch für Miévilles zerschartete Idyllik: Die Rückmeldung der vom Fortschritt Überrollten ist hier nicht blinde Rache, sondern eine Gabe, die man ›Gewissen‹ nennen könnte. Gäbs ‘ne Hall of Fame für Metaphern, würde ich diesen Moral-Golem in der Abteilung vermuten, in der auch die goldene Kugel aus »Picknick am Wegesrand« der Strugatzki-Brothers ausgestellt wird. Atemberaubend auch, wenn in einem der längeren Großkämpfe des Buches Golemetrie und die am anderen Ende des thaumaturgischen Tat-Spektrums angesiedelte Elementarbeschwörung aufeinanderprallen: Wilde, ungezügelte Begierde von Feuer-, Fleisch- und Mond-Elementardämonen gegen mehrere Golems aus Eisenbahnbestandteilen und einen Lichtgolem.
Ich geh mal die Gefahr ein, als blauäugiger oder unentschlossener Depp dazustehen. Ich kann nicht erkennen, dass der bekennende Trotzkist und ›politische Aktivist‹ China Miéville mit solchen thematischen Melodien über bewusstes Manipulieren und leiden-schaftliches Draufloshandeln dem Leser wie auch immer geartete Propaganda für allgemeine oder extrem linke Programme auftischen will. Alle drei Bas-Lag-Romane führen am Ende ihrer argumentativen Verläufe allerdings zu vielstimmigen Fragestellungen, zu Aussichtsposten auf einschüchternd große und komplexe Probleme. Die Geschichten aus Bas-Lag sind eben kein Manifest und versuchen nicht, dem Leser das ein oder andere DU SOLLST! MANN MÜSSTE! reinzureiben, oder das sich dem menschlichen Komplettverständnis immer entziehende Echtwirklichkeits-Tohuwabohu in griffige Vereinfachungen zu pressen. Freilich werden Miévilles Bücher durch seine persönlichen Interessen und Vorlieben geprägt. So berechtigt eine gewisse Paranoia gegenüber der fabulierenden Zunft auch ist, ›vertraue‹ ich Miéville aber soweit, seine Romane als seine erzählende ›Kür‹ zu verstehen, in der er sich als Weird Fiction-Freak austobt. ›Nebenbei‹ zu seinen Romanen arbeitete Miéville an seiner akademischen ›Pflicht‹ in Form der Abschlussarbeit (über Theorie und Geschichte des Völkerrechts aus marx-istischer Sicht) »Between Equal Rights« an der London School of Economics. Seine Sympathien sind deutlich zu erkennen, wenn man sich z.B. die Milieu-Architektur seiner Dramaturgie anschaut: Die eigentlichen Machthaber, und die sonst oftmals im Zentrum von Genre-Stoffen stehenden Reichen und Schönen spielen meist nur am Rande eine Rolle, die tragenden ›Helden‹ der Bas-Lag-Bücher aber sind Außenseiter, Abweichler, oftmals aus den unteren Gesellschaftsschichten und entsprechend arm und durch’n Wind.
Die kräftigste Einzelillustration Miévilles für die Probleme, die sich aus der Um-zingelung des Menschen durch den Menschen ergeben, sind dabei vielleicht die ›Remade‹ von New Crobuzon. Die Rechtssprechung des imperial-merkantilen Stadt-staates verurteilt ihre Delinquenten zu einer Behandlung in den thaumaturgisch ausgestatteten Straffabriken, in denen die Körper der Verurteilten mit allen Kniffen der Kunst einer meist abartigen Umgestaltung unterzogen werden. Die Umgemodelten sind in den schlechteren Gegenden der Stadt zuhause und bilden neben den Armen und Immi-granten den verachteten und ignorierten Bodensatz der Gesellschaft von New Crobuzon. ›Glück‹ haben dabei noch jene Remade, die speziell für ihre jeweiligen Tätigkeiten als Kampf- oder Arbeitsmaschinen hergerichtet werden, oder als Sklaven in den fernen Kolonien und für andere Großprojekte schuften. Richtig arm dran sind die Remade, an denen sich ihre Richter kreativ ausgetobt haben. Dann werden aus den Verurteilten lebendige Skulpturen gemacht, ihre Körper zu perversen, bescheuert-grausamen ›Sinnbildern‹ der jeweiligen Verbrechen umgeformt.
»Die Moral von der Geschicht?« Na, einer tragischen Kindsmörderin werden halt die Arme ihrer toten Tochter wie Fühler auf die Stirn gepflanzt, oder einem Verräter die Zunge durch ein gefräßiges Meeresvieh ersetzt. Für Liebhaber von Grotesquerie-Revues ist das freilich für sich schon ‘ne feine Monsterparade, doch die Remade sind mehr als nur das: nämlich bitter-brilliante Phantastik über die finsteren Gepflogenheiten in allen Kulturen, wenn eben jene mit Deutungs- und Gestaltungshoheit, wie es ihnen richtig erscheint oder beliebt, Leben, Psyche und Physis der ihnen Ausgelieferten zurechtkneten. Die Utopien vom neuen Menschen (bzw. die Träume vom unverdorbenen Menschen) entpuppen sich in der Welt Bas-Lag als die Schokoladenseite der Untaten, die Menschen einander antun, oder die sich antun zu las-sen sie bereit sind. Doch es gibt auch Remade, die sich auflehnen, die in New Crobuzon untertauchen oder ins Umland fliehen, zu ›fReemade‹ werden, sozusagen Freigemodelte.
Der oben erwähnte Jack Gotteshand[10] wurde in Perdido Street Station als solch ein krimineller Volksheld vorgestellt und hatte dort einen Heldenauftritt[11]. Jack war ein Mann der Tat, der Miliziaspione und Hinterzimmerschreibtischtäter in bester Vigilantenart meuchelte oder bloßstellte, den Reichen Geld stahl und an Arme verteilte. Nach seinem Tod ist die Stelle des Volkshelden vakant, und in »Der Eiserne Rat« geht’s es zu einem Gutteil darum, wie dieser Posten eines hoffnungsspendenden Widerstandsmythos neu besetzt wird. Nachdem Judah und Ann-Hari zum ewigen Zug zurückkehren, verschärfen sich dortz in der Anamnese die Zustände. Nachschub und Lohnzahlungen stocken, die Stimmung lädt sich auf und es kommt zu einer Rebellion der Trosshuren, einiger nichtumgemodelter Arbeiter und der Remadesklaven gegen die Aufseher des TRT. Der ewige Zug macht sich frei von New Crobuzons Kontrolle, flieht westwärts in die Wildnis und wird für die Bewohner von Rohagi schnell zum sagenhaften Eisernen Rat. Als Barde für die Sache des Eisernen Rates wird Judah später wieder nach New Crobuzon zurückkehren und den dortigen Widerstandgruppen vom unerhört erfolgreichen Aufbegehren das sich in der fernen Fremde zutrug berichten. In dieser Zeit wird er Cutter kennen lernen, und sich dann in der zuspitzenden Krise des Krieges New Crobuzon gegen Tesh aufmachen, den Eisernen Rat zu suchen.
Ganz passend empfiehlt Kolja Mensing für Deutschlandradio Miéville als »Begleitlektüre für die globale Katerstimmung zu Beginn des 21. Jahrhunderts«[12]. Vor allem »Der Eiserne Rat« wendet sich trotz all seiner Vernarrtheit für genrespezifische Steckenpferde eher an eine Fantasy-, Horror- und SF-Leserschaft, die sich bei allem ›Eskapismus‹ gern und heftig mit der Echtweltwirklichkeit konfrontiert, und/oder auch beim geliebten Genre-kram avantgardistischen Anspruch mag. In zwei jüngeren Interviews hat Miéville sein literarisches ›Programm‹ umschrieben:
»Es gibt mehrere Werte — das avantgardistische Fein-gefühl, die realistische Schilderung von gesellschaftlichen Strukturen, ein reißerisches Garn zu spinnen — und es ist unklar, bis zu welchem Maß diese Werte in einem Text miteinander fruchtbar auskommen.«
[13]und:
»Mein Ziel wäre also, genau dieses reißerische Garn zu spinnen, das gesellschaftlich ernsthaft und stilistisch avantgardistisch ist. Meiner Meinung nach ist das doch der Heilige Gral.«
[14]Für mich eine Wonne, dass es Genreautoren gibt, die sich, obwohl sie ihre Leserschaft im Blick haben, dennoch trauen auf ästhetische Gralssuche zu gehen, und nicht ›nur‹ den Markt zu bedienen trachten.
•••
[01] Siehe
»Magira 2003«: Besprechungen von Werner Arend (S. 23) und Molosovsky (als Alexander Müller) (S. 91). •••
Zurück
[02] ) Übersetzte ich mir mit
›verdrehte, verrückte, seltsame, befremdende Fiktionen‹. (Nebenbei. Bemerkenswert, daß am ethymologischen Brunnen des Wortes
›weird‹ wiederum drei alte Zauberweiber rumhängen.) Um den Begriff New Weird gabs und gibts in
›der Szene‹ sowohl angeregte wie auch aufgeregte Diskurse. So ganz kann ich auch (noch) nicht nachvollziehen, wie der neue Subgenrebegriff aufkam, aber als einer der ersten die ihn gebrauchten, wird immer wieder M. John Harrisson genannt, von dem Freund China ja bekennender Fan ist. Von Harrisson hat Miéville sich das Ettikett New Weird geborgt und sich selbst und vielen anderen — von denen nicht alle darüber glücklich waren — ans Revers geheftet. Wichtig erscheint mir, daß mit ›New Weird‹ ein Begriff da ist, mit der sich die heutigen Strömungen brauchbar umschreiben lassen, die weniger an die ›klassische‹ (High Fantasy) Phantastik eines J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Lloyd Alexnder oder E. R. Eddison anknüpfen, als vielmehr auf Werken von Autoren wie Mervyn Peake, Stefan Grabinski, Bruno Schulz, den jungen H. G. Welles und den Papst des Old Weird H. P. Lovecraft aufbauen. — Die derzeit verlässlichste Auskunft zur ›New Weird‹-Entwicklung gibt Thomas P. Weber in
»Fischer Kompakt: Science Fiction« (Fischer Taschenbuch, November 2005), S. 81 ff. Dort heißt es z.B. knapp und einleuchtend über Miéville, daß er
»… die Möglichkeiten der SF und Fantasy {und des Horrors. – Molo}
zu nutzen {versucht}, um die in einer neoliberalen Welt verkümmerte soziale Phantasie wiederzuerwecken.« •••
Zurück
[03] Siehe
»Magira 2004«: Besprechung von Manfred Roth, S. 191. •••
Zurück
[05] Von Chet (April) bis Thatis (Juni) des Jahres ›Anno Urbis‹ 1779. •••
Zurück
[06] Von Rinden (Oktober) 1779 bis Tathis 1780. •••
Zurück
[07] Von Chet 1805 bis Lunary (Januar) 1806. •••
Zurück
[08] Bedeutet allgemein
›zur Sprache gebrachte Erinnerung‹; medizinisch
›Vorgeschichte‹; liturgisch der Teil einer Messe, in der man der Toten (und besonders der Märtyrer) gedenkt. •••
Zurück
[09] Erde, Fels, Leichen, Giftgas, Schwarzpulver, Schatten, um ein paar Beispiele zu geben. Auch spekuliert Judah, ob sich aus Hoffnung, Angst und Ähnlichem Golems schaffen lassen. •••
Zurück
[10] Jack Half-a-Prayer im Original. Der Spitzname bezieht sich auf Jacks rechten Unter-arm, der durch eine übergroße Gottesanbeterschere ersetzt wurde. •••
Zurück
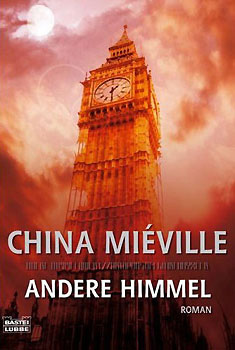
[11] »Ein versteckter Schlüssel?«, trau ich mal in einer Fußnote drauflos zu spekulieren, denn mit der Story
»Jack« reicht China Miéville in seinem Kurzgeschichtenband
»Looking For Jake« (»Andere Himmel«, Bastei 2007) ein Zuckerl über diesen legendären fReemade-Rebellen. Darin erzählt ein Mitarbeiter der Straffabriken nach Jacks Tod seine Meinung zu diesem fReemade im besonderen und den Remade im Allgemeinen. Die Kurzgeschichte
»Jack« liest sich wie eine grimmig-kritische Meditation über Heldentum und die Sehnsucht nach großen Gestalten und deren typischen
›Trieb‹, ihren wahren Gefühlen um scheinbar jeden Preis gestaltend Ausdruck zu verleihen, also Zeichen und Markierungen in der Welt zu hinterlassen. •••
Zurück
Ian R. MacLeod: »AETHER« oder: Vom melancholischem Leben im Takt der Maschinen
Eintrag No. 376
•••
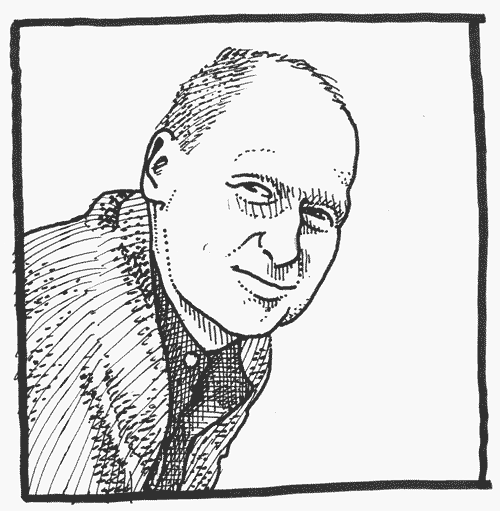 2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.
2006 und Klett Cotta trumpft auf, die Erste! Der Großmeister Robert Borrows — noch kein alter Knacker, aber auch nicht mehr der Jüngste — begibt sich vom Nobelviertel Northcentral aus auf einen Spaziergang durch das nächtliche London. Von der ersten Seite weg ist merklich, daß es in diesem Buch steampunkig, bzw. alternativ-historisch zugeht. Das ist nicht das Viktorianische England unserer tatsächlichen Echtwelt-Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, sondern eine Abzweigungswelt im Fiktionsraum, in der kurz nach Cromwells Revolution im 17. Jahrhundert ein Joshua Wagstaffe den Aether entdeckt hat. Auf seinem Weg zu einem ›Wechselbalg‹ in den herunter-gekommenen Easterlies kommt Großmeister Borrows statt an der Westminster Abbey an einem Westminster Park mit hohen Bäumen vorbei. Er sieht ›magisch‹ umgeformte Modehunde dünnbeinig, gefiedert und mit fluguntauglichen Flügeln, mit reptiliengleichen Kämmen[01], lässt Straßenbahnstationen hinter sich, begegnet einer Kinderbande, die ihn mit billigen Illusionszaubereien auszutricksen versucht. Der Großmeister erreicht die Ruine einer Themse-Brücke, findet dort die schäbige Unterkunft von Niana, einer Wechselbalgfrau. Ein seltsames Treffen, das sich zu einem rätselhaften Gespräch und schließlich zu einem undurchschaubaren Handel entwickelt, bei dem Robert sich daran zu erinnern hat, was ihn zum Menschen machte.
So beginnt »Aether« (The Light Ages) des aus Birmingham stammenden Ian R. MacLeod (1956). Dabei sei gleich davor gewarnt, daß dieser auktorial erzählte Rahmenhandlungsanfang erst nach dem Höhepunkt des Buches am Ende wieder geschlossen wird. Den Löwenanteil des Buches bildet die Icherzählerrückblende von Hochmeister Borrows.
—So Charles Dickens mit Fantasy und Steampunk halt ist allerdings ist ein reichlich vager ›in etwa so‹-Vergleich. Nur weil etwas in England und überwiegend in London spielt, sowie arme, reiche und einige kuriose Leute auftreten, ist etwas noch lange nicht so ähnlich wie Charles Dickens, der deutlich sprunghafter als MacLeod erzählt und zwischendurch auch immer wieder gern dick aufträgt, übertreibt oder abschweift. MacLeod selbst ›gesteht‹ in einem Interview[02], sich nu’ auch weniger an Dickens orientiert zu haben, sondern daß vielmehr Autoren wie D. H. Lawrence (für die Schilderung von Roberts Kindheit) oder Henry James (bei den Passagen über gesellschaftliche Zusammenkünfte) als bewusst gewählte ›Paten‹ dienten. Das zeugt dann Prosa, die sich an geduldigere Leser wendet, die mit dem Tonfall von ›klassischen‹ Edelfedern froh zu werden verstehen. Das soll nicht bedeuten, daß MacLeod verkopft schreibt, umständlich erzählt, oder sich gar zu angegilbten Sentimentalitäten hinreißen lässt.
Einige englischsprachige Rezensenten umschreiben den Roman ganz vorzüglich, indem sie sich den deutschen Begriff ›Bildungsroman‹ ausleihen. Immerhin wird eine spannende Lebensreise vom jungen zum alten Menschen ausgebreitet. Um so besser, wenn wie bei »Aether« die Lebensentwicklung des Helden viele Aspekte ihrer Zeit, ihrer Kultur, kurz: der Welt und Wirklichkeiten des Protagonisten streift, wenn er also als exemplarischer Repräsentativmensch plastisch erscheint. —Ich habe das bedrückende Leid der Armen geteilt, und an den Luxustafeln der Reichen gespeist, könnte ich Hochmeister Borrows übermütig in den Mund legen. Ian R. MacLeod alternative Aether-Welt bietet zwar genug von der Echtweltwirklichkeit abweichende Eigenschaften, daß sich in ihr spektakuläre Achterbahnfahrten veranstalten ließen oder übergroße Helden und Schurken auftreten könnten, aber der Autor hat mit seiner Alternativwelt anderes im Sinn, als große Spektakel aufzuführen.
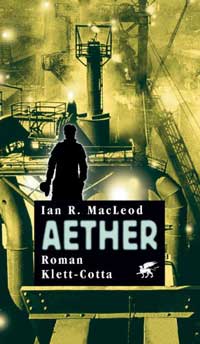 Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.
Das Arbeiterkind Robert Borrows schwingt sich also nicht zum strahlenden Kämpfer für eine gerechtere Welt auf, auch wenn ihn u.a. derartige Ambitionen antreiben. Sein Weg durch die Gelleschaft ist aber auch ohne Hetzjagden und Gefechte aufregend, abwechselungsreich und damit interessant. Robert wächst in Bracebridge auf, einer kleinen aber geschäftigen Industriestadt in Nordengland, in der Aether aus dem Boden gewonnen wird. Wir lernen ihn dort als Jungen kennen, wie er in der Schule ein Initiations-Ritual der von Gilden beherrschten Aethergesellschaft über sich ergehen lässt. Wie bei einer Schutzimpfung bekommt er ein Mal am Handgelenk verpasst, und solange es erhalten bleibt, ist alles ›normal‹ und in Ordnung mit Robert. Mit Aether lassen sich nämlich nicht nur Materialien veredeln, Werkstoffe und Produkte mit außergewöhnlichen Eigenschaften versehen oder magische Taten vollbringen. Zu starke Aetherdosierung oder heftige Kontamination können Übles und Unheimliches bewirken. Der Aether lässt giftiges Unkraut (Kuckucksnesseln) wuchern und fies mutiertes Ungeziefer (Drachenläuse) kreuchen. Köstlich im Jugendabschnitt von Roberts Lebensreise, wie der Knirps in der Schulbibliothek mehr über die vergangenen Aetherzeitalter herauszufinden versucht; wie den Kindern von der Pfarrkanzel gepredigt wird, daß Gott im Laufe der Aetherzivilisation selbst zu einem Gildenmann wurde.
Dann dämmert dem jungen Robert langsam, daß mit seiner Mutter etwas nicht stimmt. Bei einem Arbeitsunfall vor vielen Jahren wurde sie mit Aether ›verseucht‹ und leidet seitdem an einer schleichend kulminierenden Veränderung zu einem Wechselbalg, einem wilden Aether-Geist. Diese beklemmenden Kindheitserlebnisse hab ich als originelle Variation des Jekyll & Hyde-Motivs gelesen. Wechselbälger, Trolle und andere Aethergeschädigte werden von den Gilden kassiert, mit schwarzen Kutschen und Wägen in geschlossene Anstalten gebracht, um ein tristes Dasein zu fristen und als Probanten der Aether-forschung zu nützen. Hauptsache, sie verschwinden aus den Augen der Öffentlichkeit. Ein Schicksal, dem Roberts Mutter mit dem tragischsten aller Mittel zu entkommen sucht.
Moment, ich will nicht[03] andeuten, daß »Aether« eine entmutigende Depri-Lektüre ist. MacLeod gönnt dem Leser schon auch längere Passagen mit idyllischen Szenen, z.B. wenn Robert den Märchengeschichten über das magische ›Arkadien‹ Einfell lauscht oder mit seiner Mutter einen Ausflug nordwärts unternimmt. Per Eisenbahn und zu Fuß suchen die beiden die aufgegebene Aethermine Redhouse auf und treffen dort zwei vom Aether Veränderte, die sich dem Zugriff durch die Gilden entziehen konnten: die alte Kräutermeisterin Summerton und Anna Winters, die etwa so alt wie Robert ist. Summerton und Anna sind jedoch keine hässlich-furchterregenden Monster, im Gegenteil wurden sie durch die seltsame Natur des Aethers in so etwas wie ›Lichtalben‹ verwandelt, die allerdings auf ihre Art ebenfalls nicht ganz geheuer sind.
Wieder nix mit einfacher Töpfchen-Kröpfchen-Verteilung von Gut und Böse, dafür ein atmosphärisch dichtes und glaubwürdiges Durcheinander von Abhängigkeiten, Widersprüchen, Faszinationen und Impressionen. So mag es zumindest ich.
Man erwartet von Robert, der Karriere seines Vater zu folgen und als Angehöriger der Niederen Gilde der Werkzeugmacher in der Aetherfabrik von Bracebridge zu arbeiten. Nun wäre kein Bildungsroman komplett ohne vertuschte Geheimnisse, und entsprechend stolpert auch Robert als Gildenlehrling über beunruhigende Spuren und Gerüchte aus der Vergangenheit, die mit dem Arbeitsunfall seiner Mutter zusammenhängen. Im Dritten der sechs Abteilungen des Romans flüchtet Robert aus der ihm zu engen Provinz nach London. Hier schließt er bald Freundschaft mit dem Taschendieb Saul, dem Sohn der Betreiberin eines Traumhauses, einer Art Bordell und Rauschgifthöhle, nur auch mit Aether-Drogen statt Opium. Saul und Robert engagieren sich für eine revolutionäre Bürgerbewegung, die gegen die Missstände der Gildenherrschaft antritt, und sie liefern bissige und beflügelnde Beiträge für die Zeitung ›Der Neue Morgen‹.
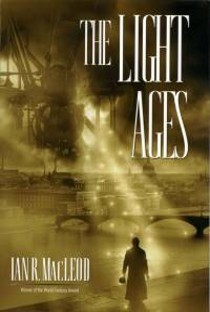 Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.
Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters (neben anderen Herzensdamen) in Roberts Leben eine große Rolle spielt, macht »Aether« zudem als Qualitäts-Schnulze vor phantastisch-alternativhistorischen Hintergrund eine gute Figur. »Aether« lässt sich aber auch als kritische Auseinandersetzung über Themen wie Technologie, bzw. Magie, Hoffnung und (Ohn-)Macht, Klassenhegemonie und Revolution lesen. So verführerisch rätselhaft die Aether-Welt mit all ihrer Detailliertheit bleibt, zeichnet sich als eine klare Botschaft des Buches vielleicht folgende Prämisse ab: Obwohl wir glauben, die Maschinen und Dinge, die wir herstellen und betreiben zu beherrschen, liefern wir uns ihnen eigentlich größtenteils aus. Die Wurzel des Übels sind dabei weniger diese heikle Beziehung zwischen Natur, Kultur und Technologie (oder wie hier eben: Aethermagie), sondern die gesellschaftlichen Hierarchien und die ihnen eigentümlichen Verführungen, Ungerechtigkeiten und Zwänge.
Wunderbar versetzt MacLeod die Leser in die ›Froschperpektive‹ Roberts, der erfreulicherweise kein flacher oder lascher Charakter ist, vielmehr eine plausible Mischung aus aufmüpfiger Eigenwilligkeit und naiver Kurzsichtigkeit. Schön ist es, mitgehen zu können, wenn Robert z.B. von quasi-marxistischer Kapitalismus-Kritik begeistert wird; oder mit ihm über die mannigfachen Besonderheiten der Aetherwelt zu staunen; oder sich mit ihm in eine junge Dame aus bester Gesellschaft zu verlieben. Auch wenn die Rahmenhandlung des alten Großmeisters einen gebrochenen Helden zeigt, der verzweifelt seinen Träumen nachspürt, und Roberts Lebensgeschichte einen tragischen Bogen spannt, schimmern immer wieder wundersame Hoffnungslichter im üppig-›realistischen‹ Weltenbau auf. Abgesehen von seinen unterhaltenden Qualitäten verführt »Aether« dazu, über die Begriffe Magie und Technik nachzudenken.
Was man als Magie und was als Technik betrachtet hängt entscheidend vom jeweiligen Wissensstand, bzw. Einweihungsgrad ab. Unsere Echtweltzivilisation blühte in den letzten Jahrhunderten durch die Perfektionierung des Einsatzes von fossilen Energielieferanten auf. Ist es Schicksal der Natur, oder hat sich die Menschheit damals freiwillig z.B. für den Verbrennungsmotor als Genius der Kultur entschieden? In MacLeods Welt gibt es Magie — Elektrizität und Automobile befinden sich noch im experimentellen Stadium — und dennoch nimmt die gesellschaftliche Entwicklung einen Verlauf, der unserer echten Welt mit ihrer bösen Moderne erstaunlich ähnlich ist. Anglo-phile Phantastikreisende werden diesen politischeren Ton sehr wahrscheinlich wiedererkennen, und man darf sich entsprechend freuen, wie gut sich Ian R. MacLeod einreiht zu den Herren Engländern, die vorzügliche, anspruchsvolle und verführerische London- und Königreich-Fantasia schreiben[04].
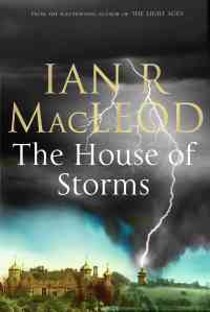 NACHTRAG, Mai 2007:
NACHTRAG, Mai 2007:
Es ist immer ein Glücksfall, wenn Übersetzungen ganz besonders gelingen, grad im sonst oftmals so schluderig gehandhabten Feld der Genre-Phantastik. Es hat mich also besonders gefreut, daß Klett-Cotta Barbara Slawig für die Übersetzung von MacLeods deutschem Debut gewonnen hat. Was ich seit Erscheinen von »Aether« aus dem Gerüchtedschungel erlauschen konnte, läßt mich bangen: »Aether« soll sich nicht so dolle verkauft haben, was ich sehr schade finde, denn dieses Buch bringt alles mit, um sowohl Fantasy/Steampunk-Genrespezialisten zu sättigen, als auch Leser zu erfreuen, die sich nicht speziell für Fantasy, aber eben für England, die Industrielle Revolution, einen gut geschriebenen Roman interessieren. Ich hoffe sehr, daß eine Taschenbuchauflage von »Aether« noch kommt und mit mehr Interesse aufgenommen wird, und ich bange darum, daß die quasi-Fortsertzung »House of Storms« (2005) dem deutschen Publikum noch gereicht wird. »House of Storms« spielt ca. 100 Jahre nach den Geschnehnissen von »Aether« im gleichen Weltenbau, und behandelt u.a. eine Queste um die Evolutionstheorie, einen Bürgerkrieg zwischen West- und Ostengland sowie herausragende Passagen aus der Sicht eines Wechselbalges. Ich persönlich fand diesen zweiten Roman aus der Aetherwelt noch besser, weil eleganter, abwechslungs- und auch äktschnreicher als seinen Vorgänger, und es wäre schade, wenn er hierzulande nur Gesprächsstoff für solche Leser bleibt, die ihre Lektüre auch englisch goutieren.
•••
[03] ERRATA: Dieses
nicht hat durch meine Schlamperei in der Druckfassung dieser Rezension gefehlt, was leider diesen Satz auf den Kopf gestellt hat. Hier also nun korrigiert. •••
Zurück
[04] Eine willkürliche Auswahl: Ian Sinclair, Michael Moorcock, Michael De Larrabetti, Peter Ackroyd, Clive Barker, Kim Newman, Glenn Duncan, Geoff Nicholson; sowie die hier ebenfalls besprochenen Herrn Gaiman und Miéville. •••
Zurück
Tobias O. Meißner: »Das Paradies der Schwerter«, oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt
Eintrag No. 371
•••
 Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[1], dass …
Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[1], dass …
»… {n}iemand dies Buch ohne Verstörung lesen können (wird), …«
… hoffnungsvoll als Kauf- und Leseanreiz.
Das Geständnis vorweg: Ein endgültiges Urteil zu »Das Paradies der Schwerter« will ich nicht wagen. Ich schwebe, was diesen sowohl inhaltlich wie auch sprachlich sehr durchmischten Roman betrifft, in einer Ambivalenz irgendwo zwischen gackernder Kleinjungenbegeisterung und skeptischer Verkopftheit. Ich bewundere Tobias O. Meißner (1967) aufrichtig für seine Chuzpe und Experimentierfreude. Aber ich bin völlig unsicher, ob ich seinen Roman als abenteuerliche Fantasy ernst nehmen kann, vom ›Meisterwerk‹-Ettikett ganz zu schweigen. Zu viele Stilblüten und schiefe Unplausibilitäten türmt er (scheinbar?) munter-unbekümmert aufeinander. Jäger lag also richtig: ich bin verwirrt. Aber ich wollte es ja nicht anders.
Zweifellos bietet aber, wie schon der Titel verspricht, »Das Paradies der Schwerter« zumindest Fresseschläge satt. Üppige Tabelaux mit testosteronprallen Kämpfer-Typen schrecken mich nicht, im Gegenteil. Ich bin so frei, mir durchaus zuzutrauen, solche Geschichten über triebstarke und tatendurstige Kriegerhelden so lesen zu können, dass sie mehr hergeben als lediglich platte Propaganda für bestialisch-›faschistische‹ Männermythen.[2]
Der Bischof der befestigten Stadt am Grünen Fluss im Tal der Glocken lässt ein großes Kampfturnier auf Leben und Tod veranstalten. Sechzehn Kämpfer sollen paarweise in vier Runden gegeneinander antreten. Als Preis wartet ein goldener Stirnreif im Wert von 1000 neuen Talern auf den Turniersieger. Meißner hat also ein kräftiges und altbewährtes Handlungsgerüst gewählt, hochprozentiger lässt sich die große Erzählung über das Dasein als Wettkampf aller gegen alle kaum destillieren.[3]
Die erste Hälfte (Kapitel 1 bis 17 des Buches) kommt als Episoden-Collage daher und stellt dem Leser in sechszehn Strängen erst mal die Teilnehmer des Turniers vor. Das bietet reichlich Anlässe für Stil- und Kulissenwechsel. Eine passende Stelle, um meiner Begeisterung darüber Ausdruck zu verleihen, dass Meißner es wagt, die ästhetische Herausforderung anzunehmen, die die neuen Medien wie z.B. PC- und Konsolenspiele für das schriftliche Erzählen darstellen.
Literatur bleibt im Grunde immer einer linearen Programm-Natur verhaftet, wurscht wie gekonnt der Text den Leser in die Erzählung eintauchen lässt, egal wie gut es dabei gelingt, überzeugend in Mehrdeutigkeiten zu flackern, oder wie sehr auch immer mit Kunstkniffen versucht wird, vieldeutig ›ins Offene‹ zu zeigen. Turniere sind ein klassisches Daddel-Genre, das sich entscheidend dadurch auszeichnet, dass man als Spieler zwischen einer bunten Schar verschiedener Figuren wählen kann, mit denen (bzw. gegen die) man sich dann misst. Auf allzu detaillierte Hintergrundgeschichten wird dabei selten Wert gelegt. Vielmehr helfen bei Spielen (aber auch schon bei Rumsbumsfilmen) mehr die fetzigen Namen, das Styling und Design der Figuren, sowie ihre jeweils eigentümlichen Eigenschaften, Gebärden, Waffen und Tricks, sich verführen zu lassen und in die Charaktere, die Welt und die Äktschn einzutauchen. Dabei generiert jede Spielsession immer wieder eine neue Story-Variante, auch wenn sich diese ›Stories‹, bedingt durch die Begrenzungen des Möglichkeitsraums der Spielarchitektur, bis jetzt noch immer ziemlich ähnlich sind. Hier kann nun, wie Meißner zeigt, Literatur den interaktiven und adrenalinreizenden Spielen Paroli bieten, indem sie tiefere Hintergrundgeschichten statt oberflächlichem Detailreichtum bietet. Prickelnd ist zudem, wie die Leserschaft als Zeuge des ganzen wahnwitzigen Brot-und-Spiele-Irrsinns positioniert wird. Klar sind Romane auf ’ne lahmere Art ›interaktiv‹ als komplizierte virtuelle Digital-Realitäten. Ich nehme schon an, dass Meißner mit »Das Paradies der Schwerter« durchaus mehr anpeilt, als sich nur auf dem Feld der Literatur behaupten zu wollen. Ich vermute, er hatte wohlüberlegterweise im Sinn, sich mit dem Roman auch intermedial an Filmen, Comics und eben digitalen Genrewelten zu messen. —Knackige Äktschn mit Anspruch, wa? Ganz richtig, und ich nähere mich solchen Ambitionen gern mit neugierigem Wohlwollen.
Allerdings brachten mich andererseits Sprachseltsamkeiten des Romans oft zum Stirnerunzeln und Augenbrauenlüpfen, und rabiat-ungestümes Zusammenzimmern von Unterschiedlichstem ließ mich zudem grübeln, ob ich mich ›im Sinne des Buches‹ amüsierte, oder doch eher als ›gegen den Strich-Leser‹ meine Freude damit hatte. Beispielsweise als Piraten nächtens ein Schiff nahe der Küste des Tals der Glocken überfallen, und der junge Wandermönch Wei Guan Zhou, der aus fernen Landen im Osten stammt, Verdana rettet:
»›D … danke …‹, keuchte die junge Frau, eine Einheimische in knapper, Bewegung ermöglichender Abenteurerkleidung.«
[4]Solch moderner Versandhauskatalog-Sound klingt für mich wie ein alberner oder unpassender Anachronismus. Oder ist sowas als satirische Geste, als Insiderjoke auf Rollenspielklischees gedacht? Ich bin nicht sicher. Doch es gibt auch n’hübsches Büschel frech-origineller Anachronismen in Meißners namenloser Prügel-Welt, z.B. drogensüchtige, sprich an der Nadel hängende Glücksritter, oder westernmäßige Shootouts mit kleinen Armbrüsten.
Ein weiteres Beispiel für ein irritierendes Sprachtrumm bietet ein Kapitel mit Waisenkinderschar. Die kleine Lilin rennt aufgeregt durch den Wald, um ihren großen Brüdern von der Turnier-Einladung zu berichten:
»Sie war schnell wie ein Reh. Die Bäume zuckten vorüber, ein Wechsel von Dunkel und Grün, einzig verbunden durch ihre wehenden blonden Haare.«
[5]Leider keine neue Ent-Variante (obwohl hier Bäume mit blonden Haaren zucken), sondern nur eine missverständliche Bezüglichkeit. Ist das nun ‘ne echte Schlamperei des Autoren bzw. seines Lektorats? Oder soll das ein gewollt ›ungewöhnliches‹ Bild sein, vielleicht sogar zu verstehen als Diss gegen allzu impressionistisch-lyrische Töne, die in der Fantasy gern mal zu picksüßer Intensität anschwellen? Nun, ich ärgere mich nicht, sondern bin erstaunt und belustigt und eben unschlüssig. Aber immerhin: es ist durchwegs viel los. Die Tiefe des Weltenbaus, mit seinen manchmal haarsträubenden Vereinfachungen[6], bleibt durchwegs auf Marionettentheater-Niveau. Dafür überschüttet Meißner die Leser mit einem munteren Schwall an (ab und zu platten, doch überwiegend spritzigen) Ideen und Ereignissen. Grober atmosphärischer Kurs dabei: immer schön ordentlich rumscheuchen die Sprache, sowohl zu den niederen Pfaden, wenn’s grimmig, dreckig, martialisch, zornig zugeht, als auch hinauf zu idyllischen Wiesen, wenn Empörung, Mitleid, Sehnsucht und Trauriges zur Sprache kommt. —Haut‘s ummanand, ihr Metaphern, wu-ha!
 Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.
Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.
—Jetzt geeehts loo-oos!, denn mit Turnierbeginn nimmt Meißner neben dem Schreibzeug auch das Rollenspielwürfel- und Tabellenwerkzeug zur Hand, um die Geschichte erst mal auszuspielen, bevor er – selbst zum ohnmächtigen Zuschauer und Analytiker ›degradiert‹ – die Ereignisse des Kampfprotokolls schriftstellerisch aufbereitet.[7] Da nutzt ein Autor die Praxis und das Werkzeug des Rollenspielgenres, aber nicht um eine Serie loszutreten, oder als eines von vielen Rädchen den steten Produktausstoß einer Marke zu gewährleisten, sondern um einen Roman lang sein eigenes Experiment aufzuführen: —Hut ab! Als Leser schaute Meißner neugierig und gespannt dabei zu, welche ungewöhnlichen Handlungskurven durch die Zufallsentscheidungen der Würfelei gekratzt werden. Allerdings ragen auch hier wacklig-ungebändigte Sprachornamente aus dem Erzählfluss, z.B. vor dem Schlussakkord des ersten Kampfes:
»Über Grotyn Terentius Craos Kopf detonierte die Sonne und überschüttete das trichterförmige Universum mit hochbeschleunigten Magmanadeln.«
[8]Und im dritten Kampf werden Waffen ziemlich unbekümmert vermenschlicht:
»Wieder stöhnte das Schwert auf, schien die Erlösung des Zerbrechens zu erwägen.«
[9]—Doch hinfort mit euch, ihr dummen Nörgelgedanken eines Sprach- und Klangfetischisten.
Für das Publikum besteht die Gaudi eines Turniers zu einem Gutteil darin, dass sich unten in der Arena erbarmungslos eliminiert wird, während sich von oben das Schicksalsgeschehen wunderbar ungeschoren verfolgen und bewerten lässt. Auch diesen Aspekt von Turnierereignissen zapft Tobias O. Meißner auf anregende Art an, und versteht zumeist überzeugend, die Arena als Kessel der Gemütserregungs- und Enttäuschungs-Dynamiken zu inszenieren. Zwischen den Kämpfen kommentieren zwei berühmte Wettkönige in Sportmoderatoren-Manier die Duelle, stellen Prognosen auf und bemühen sich, den zunehmend chaotisch-herben Verlauf des Wettkampfes durch Gewitzel aufzulockern. Durchaus gekonnt unheimlich dabei, wie leicht es diesen beiden Kennern fällt, ›tödliche Spiele‹ als sportiv-ästhetische Darbietung zu genießen. Meißner spottet erfreulich ätzend über z.B. das hysterische Gewese, das in den Massenmedien um Show-Wettkämpfe, Ekel-Tests und Superstar-Erwählungen veranstaltet wird.
Die Arena als Brennglas eines Fantasy-Spektakels über Spektakel, Spektakelindustrie und Spektakel-Lüsternheit. In Sachen Stilsouveränität eine vielleicht etwas schmutzige Linse, die nicht immer die richtige Sprachklang-Tiefenschärfe findet, aber die ›Unbescheidenheit‹ Meißners wiegt das für mich locker auf. So klug und selbstgewahr, wie er sich in dem oben erwähnten Interview äußert, kann er dem Rezensenten und anderen Lesern vielleicht nachsehen, wenn deren ›innere Literaten‹ sich finster grummelnd unter Deck verkriechen. Der Posse von ›inneren Trash-Freaks & Metallern‹ wird mit »Das Paradies der Schwerter« reichlich Gelegenheit geboten, mitzujohlen und headzubangen. Das Buch mag mit enervierenden Makeln gesprenkelt sein, aber das ist nun mal der Preis dafür, wenn man es darauf ankommen lässt, dass Literatur ›rocken‹ soll. Wer sich dafür interessiert, welch interessante Pfade die zeitgenössische, zudem die deutschsprachige, Fantasy einschlagen kann, sollte mal ein Exemplar des Buches in die Hand zu nehmen und ankosten. Subjektiv bin ich nicht sicher, ob der Roman ein krasser Spaß oder alberne Akrobatik ist, aber wenn ich den Inhalt Revue passieren lasse, muss ich innerlich grinsen. Und selbst wenn meine Belustigung nicht immer ›im Sinne des Autors‹ sein mag, nehme ich sie als Hinweis dafür, dass das Buch objektiv betrachtet wohl durchaus was taugt, trotz aller Geschmacks-Grätschen. —Good fight. Good night.
•••
[1] »
Warnung vor einem Meisterwerk –
Das Leben ist ein Turnier: Tobias O. Meißners Kunst der Grausamkeit« in der FAZ vom 27. März 2004.
••• ZURÜCK
[2] Man ›gönne‹ sich z.B. die bestenfalls lapsige, schlimmstenfalls arrogante Begründung von Rainer Zondergeldt, Fantasy und nichteuropäisch-westliche Werke weitestgehend aus seinem
»Lexikon der Phantastischen Literatur« (Suhrkamp Verlag 1983; erweiterte Neufassung zusammen mit Holger E. Wiedenstried, Erdmann Verlag 1998) auszuklammern, wie auch seinen ›tendentiösen‹ (sprich: geringschätzigen) Eintrag zu Robert E. Howard dort.
••• ZURÜCK
[3] Oder wie es der berühmt-berüchtigte
›Medienphilosoph‹ Peter Sloterdijk in seiner großen Menschheitserzählung umschreibt:
»Die Faszination von Turnieren {…}: Bei ihnen wird, analog zur Tierzucht, das Eliminationsverfahren zu einer menschgemachten Selektion. Er oder ich, wir oder sie – das wird in der Arena wie in einer Versuchsanordnung künstlicher Selektion eingeübt. {…} Wenn das griechische Leitwort lautete: Erkenne dich selbst, so heißt das römische: Erkenne die Lage.«
Aus dem Exkurs »Später sterben im Aphitheater. Über den Aufschub, römisch« in »Sphären: Globen – Makrosphärologie«, Suhrkamp 1999, Seite 330 ff.
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
[6] Kapitel 24, S. 277: Eine junge Landadelige, die um einen Teilnehmer (ihren namenlosen Retter aus einer der Vorgeschichten) bangt, und ihren Vater dafür haßt, sie zum Turnier geschleift zu haben, damit Heiratswillige die
›Ware‹ beschauen können. Meißner schreibt:
»Angrica hätte darüber nachgedacht, ihren Vater aus Zorn und Verachtung zu ermorden, aber ihre Erziehung legte ihr den Gedanken an Selbstmord näher.«
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
[8] Kapitel 18, S. 239. Die Sonne explodiert freilich nur metaphorisch.
••• ZURÜCK
••• ZURÜCK
Gaiman, Neil: »Anansi Boys«, oder: ›Die spinnen, die Götter‹ (für MAGIRA 2006).
•••
 Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt (mehr über den Leipzig-Besuch von Gaiman in meinem Gedächtnisprotokoll mit Skribbel). Wer Gaiman schon kennt, kann sich als entsprechend Informierter den nächsten Absatz sparen.
Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt (mehr über den Leipzig-Besuch von Gaiman in meinem Gedächtnisprotokoll mit Skribbel). Wer Gaiman schon kennt, kann sich als entsprechend Informierter den nächsten Absatz sparen.
Gaiman gehört zu den britischen Aufsteigern der Neunziger, und hat seine Laufbahn mit Büchern über Duran Duran und Douglas Adams’ »Per Anhalter durch die Galaxis«-Reihe begonnen. Mit Graphic Novels wie »Violent Cases« und »Black Orchid« erlangte er Ansehen als Comic-Autor, was ihm die Gelegenheit verschaffte, die große Geschichte »The Sandman« in 75 (fast immer) monatlichen Heften von 1988 bis 1995 zu erzählen. Die Saga über den Abstieg und die Wiedergeburt des Herrschers der Traumlande machte Gaiman zum Star einer Phantastik-Gemeinde, die es zu schätzen weiß, wenn Religionen und Mythen aller möglichen Epochen und Weltgegenden vermischt werden und mit einer gewitzten Sensibilität für moderne Fantasy- bzw. urbane Horrorgeschichten, gewürzt mit einer kräftigen Prise guter alter Familien-Soap, erzählt werden. »The Sandman« gilt vielen Lesern immer noch als Gaimans bisher bester Brocken. Mit ein bisschen Übertreibung kann man behaupten, dass seitdem Gaiman sozusagen in den Kult-Rang eines zeitgenössischen Ovids aufgestiegen ist, sein Publikum gebannt seinen Variationen über die Metamorphosen von Wesen, Zeitläuften und Welt lauscht. So kennen ihn Terry Pratchett-Leser als Co-Autor apokalyptischer Komik (»Good Omens«), Art-Book-Fans als Wiederbeleber der Tradition des (in diesem Fall von Charles Vess) aufwändigst illustrierten Märchenbuches für Erwachsene (»Stardust«). Gaiman hat im Fernsehen z.B. in der SF-Serie Babylon 5 (»Day of the Dead«) und als Schöpfer einer BBC-London-Fantasia (»Neverwhere«) seine Geschichten erzählt. Als Mit-Entdecker und Übersetzer von »Prinzessin Mononoke« für den englischsprachigen Markt glänzte er als Vermittler. Derzeit steigt Gaiman in die narrativ-industrielle A-Liga auf, nachdem er jahrelang den Titel innehatte, die meisten nichtverfilmten Drehbücher in Hollywood verkauft zu haben: innerhalb der nächsten 18 Monate laufen »Beowulf« (der nächsten starbepackten CGI-Flick von Robert Zemeckis), »Stardust« (mit der Pfeiffer und dem de Niro) und »Coraline« (von Meister Selnik, dem »Nightmare Before Christmas«-Puppentrickser) an. Getrost kann man auch alle Früchte der Zusammenarbeit Gaimans mit seinem bildnerischen Kumpel und »The Sandman«-Covermagier Dave McKean als echte Phantastik-Gemmen werten. Dazu zählen neben den oben erwähnten frühen Graphic Novels auch die ›graphischen Erzählungen‹ für Erwachsene »Signal To Noise«, »Mr. Punch«, die Kinderbücher »The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish« und »Coraline«, sowie jüngst das extravagante Film-/Bildband-Projekt »Mirrormask«.
Laut Autorenbio des Klappentextes hat Neil Gaiman »Anansi Boys« ganz speziell ›für dich‹ geschrieben, was ja schon mal ein nette Geste ist. Respektvoll verneigt sich der Autor dann im Postskriptum seiner Danksagungen vor vier Autorengeistern, und zeichnet damit erste Konturen der Ambitionen und Themen des Romans (kursiv sind die entsprechenden Narrations-Harmonien markiert, die sich in Anansi Boys vernehmen lassen):
- P.G. Wodehouse mit seinen Geschichten vom wohlhabenden aber planlosen Junggesellen Bertie Wooster und dessen fähigem aber trockenen Butler Jeeves[1] ist ein Klassiker der britischen Gesellschaftskomödie, und sein Einfluss liefert Konversations- und Peinlichkeits-Humor;
- ›Tex‹ Avery war ein Genie des höheren Zeichentrick-Blödsinns und hat z.B. Bugs Bunny und Duffy Duck erfunden, ewiges Vorbild für wilden Slapstick mit phantastischen Unmöglichkeiten;
- von Thorne Smith stammt die Vorlage für den Filmklassiker »I Married a Witch« und auch bei Gaiman geht’s um Ehen bzw. städtisch-moderne Romanzen zwischen normalen Sterblichen und magischen Überwesen;
- Zora Neale Hurston veröffentlichte eine Reihe Bücher über afro-karibische Mythologie, und der titelgebende Spinnengott Anansi stammt aus Westafrika.[2]
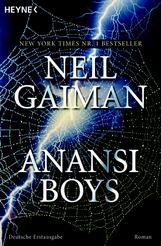 Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.
Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.
Die Geschichte beginnt mit einer Eröffnung über die Macht der Lieder und die Song-haftigkeit der Welt. Schon mal sehr schön, dieses klassische Fantasy-Motiv von der Welt oder dem individuellen Leben als Musik hier neu verhandelt zu finden.[3] Ein willkommenes Gegengewicht in einer Zeit, da die visuellen Medien ja vielbeklagterweise dominieren.
Der Rest des ersten Kapitels dreht sich um Verwandtschaft und Spitznamen. Die Hauptfigur Charlie Nancy ist ein schüchterner ›Jedermann der Moderne‹. Leicht nervös zu machen und deshalb ungeschickt, zurückhaltend und sich schnell mal schämend. Nicht gerade die klassischen Eigenschaften eines tatkräftigen Helden oder eines düsteren Antihelden. Obwohl er schon lange kein Dickerchen mehr ist, blieb der von Papa verliehene Spitz-name ›Fat‹ an Charlie hängen. Mit seiner schalkhaften und fidelen Art und Weise bescherte der Vater Fat Charlies Kindheit und Jugend so manches blamable Fettnäpfchenbad. Nach dem Tod der Mutter zerfällt die Familie und später siedelt Fat Charlie von Amerika nach London. Da sitzt er nun mit seiner Verlobten Rosie – die mit dem Sex erst nach der Trauung loslegen möchte – und plant die Hochzeit. Rosie und ihre verwitwete Mutter sind dabei die entscheidenden Planer, und so will Fat Charlie auf Rosies Vorschlag hin nach langer Zeit wieder Kontakt mit seinem Vater aufnehmen. Doch statt eine Hochzeiteinladung aussprechen zu können, erfährt Charlie telephonisch von seiner alten Nachbarin vom plötzlichen Tod des Vaters. Wie ein Gedankenspiel Gaimans für den Beginn einer »Six Feet Under«-Folge nimmt sich das aus[4]: Papa Anansi purzelt bei einem Karoke-Abend mit Hetzattacke von der Bühne. Fat Charlie fliegt also nach Florida, um seinen Vater unter die Erde zu bringen und lernt dabei von drei ›netten‹ Voodoo-Damen aus der ehemaligen Nachbarschaft, dass Papa Nancy der Spinnengott Anansi war, und dass Fat Charlie einen Bruder namens Spider hat.
—Alles Humbug, denkt sich Fat Charlie, kann aber der Versuchung, seinen unbekannten Bruder kennenzulernen, nicht wiederstehen, und so bittet er – wie es ihm die ›Nornen‹ gesagt haben – eine kleine Spinne, seinem Bruder Bescheid zu geben. Mit Spiders Auftauchen in London beginnt der Roman, seine wilden Slapstick-Unmöglichkeiten gekonnt auszuspielen. Spider hat im Gegensatz zu Fat Charlie die übernatürlichen Fähigkeiten von Papa Anansi geerbt und übernimmt mit ihnen Stück für Stück Fat Charlies Leben. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Grahame Coats, Charlies Boss in einer Promi-Agentur, will seinen gutmütigen Angestellten als Sündenbock missbrauchen. Coats hat nämlich jahrelang Geld seiner Klienten abgezweigt und in ein karibisches Insel-Steuerparadies verschoben, dann im Affekt auch noch die Kundin Meave ermordet und ihre Leiche im Geheimsafe seines Büros zurückgelassen. Das ruft die perfektionistisch-zielstrebige Ermittlerin Daisy von Scotland Yards Betrugsabteilung auf die Erzählbühne. Fat Charlie und die Geschichte pendeln nun zwischen London und Florida, bevor sie nach vielen überraschenden Wendungen in ein ungewöhnliches Gesangsfinale auf der Insel St. Andrews mündet.
Fat Charlie hat heftig zu ringen: mit seinen grollenden beschämten Gefühlen gegenüber dem Hallodri-Vater und dessen ›Erbe‹; mit Spider um die Souveränität über sein Leben; mit Rosie um die Beziehung; mit Daisy um seine juristische Unschuld; aber vor allem auf der großen Metaphernebene mit Grahame Coats selbst. Wie so oft bei Gaiman, garnieren auch diesmal wieder kleine in sich abgerundete Geschichten den großen Bogen des Romanverlaufs. Zum Beispiel die Episode, in der Anansi einmal seine tote Großmutter verhökern wollte, oder die von Anansis Tod im Bohnenfeld. Mit von der Partie sind dabei auch andere Tiergottheiten, und Grahame Coats entpuppt sich als ein Avatar-Gefäß von Tiger, dem ewigen Gegenspieler von Anansi. Es ist ein archetypischer Kampf zwischen Schläger und Trickser, zwischen den rigiden Kriegerüberlebensmythen der Jäger und Sammler und den geselligkeits- und kulturfördernden Leichtsinnskräften von Wein, Weib und Gesang, den, wie Spider mal zu Fat Charlie sagt, einzigen drei Dingen, die den Schmerz der Sterblichkeit und die Wirrheiten des Lebens mildern können.
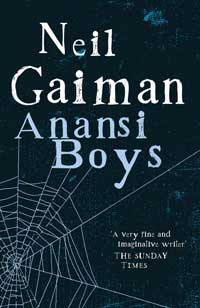 Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.[5] Zudem erfährt der Leser in einem Interview etwas über Neils Lieblingsgötter, seine Meinung zu Spinnen, Karaoke, Spitznamen und peinliche Familientreffen. Glanzstück ist aber der Abdruck einer gestrichenen Szene, die aus Tempogründen entfiel, aber dermaßen feine ›spinnerte‹ Abenteuer von Spider bietet, dass es wahrlich eine Schande gewesen ist, sie dem deutschen Publikum vorzuenthalten. Als letztes gibt es acht Fragen für Lesezirkel, und ich kann nicht anders, als über das Niveau an Textbeschäftigung, dass diese Fragen postulieren, zu staunen.
Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.[5] Zudem erfährt der Leser in einem Interview etwas über Neils Lieblingsgötter, seine Meinung zu Spinnen, Karaoke, Spitznamen und peinliche Familientreffen. Glanzstück ist aber der Abdruck einer gestrichenen Szene, die aus Tempogründen entfiel, aber dermaßen feine ›spinnerte‹ Abenteuer von Spider bietet, dass es wahrlich eine Schande gewesen ist, sie dem deutschen Publikum vorzuenthalten. Als letztes gibt es acht Fragen für Lesezirkel, und ich kann nicht anders, als über das Niveau an Textbeschäftigung, dass diese Fragen postulieren, zu staunen.
Ich freue mich besonders, dass der Übersetzer Karsten Singelmann diesmal den trocken-witzig-poetischen Grundton Gaimans besser getroffen hat, nachdem ihm dies bei »American Gods« und dritten bei »Neverwhere« nicht unbedingt zufriedenstellend gelungen ist[6]. Immerhin gehört zur unverwechselbaren Kunst Gaimans, weitestgehend mühe- und schartenlos zwischen poetischerer Sprache bei den mythisch-magischen Passagen und schnörkel-losen Erzählen bei den Ereignissen der Gegenwartshandlung zu wechseln.
»Anansi Boys« ist Gaimans bisher flottester Roman, gradlinig und abwechslungsreich. Viele Fantasy-Phantastik-Leser, die anspruchsvolle und dennoch ›leicht zugängliche‹ Unterhaltung mögen, wissen Gaimans Romane (und Comics) sowieso zu schätzen. »Anansi Boys« sei deshalb speziell allen, die noch nichts von Neil Gaiman kennen, als guter Einstieg in die Welten dieses inspirierenden Mythenmixers empfohlen.
•••
[1] Nebenbei: Als phantastische (
›Low Fantasy‹) Neuauflage dieser sehr englischen Herr/Diener-Konstel-lation läßt sich der plappernde Wallace und sein Retter aus allen Notlagen-Hund Gromit lesen.
••• ZURÜCK
[2] Fast möcht ich meinen, daß Gaiman mit seinem neuesten Buch auf das Debüt
»King Rat« von China Miéville reagiert, in dem Anansi neben dem König der Ratten und einem Vogelgott gegen den verführerischen Flötenspieler der Hamel-Legende kämpfen. Auf Deutsch finden sich Anansi-Geschichten z.B. in
»Westarfikanische Märchen«, Hrsg. von Kurt Schier und Felix Karlinger (Diederichs, 1975) und in
»Afrikanische Märchen«, Hrsg. von Friedrich Becker (Fischer Taschenbuch, 1969).
••• ZURÜCK
[3] Mythologisch z.B. anzufinden von den antiken Welt- oder Sphärenharmonien über vedische Weltschöpfungslieder bis hin zu vom Weg abbringenden Sirenengesängen. Gaiman selbst greift schon in
»The Sandman« mit einem Handlungsstrang um Orpheus dieses ›Sein als Musik‹-Motiv auf, das sich auch bei Meistersängerkriegen und Rattenfängern findet. Für Fantasy-Leser
›klassisch‹ ist der musiklaische Schöpfungsmythos Mittelerdes bei J. R. R. Tolkien; Alan Dean Forsters
»Bannsänger«-Reihe trägt die magische Musik bereits im Titel; in Tad Williams
»Der Blumenkrieg« soll im Finale ein irdischer Sänger als melodische Bombe scharfgemacht werden; China Miéville variiert die Figur des verführenden Musikers in
»King Rat« mit einer originellen Kulmination aus Flötenspiel und Drum & Base; umfassend und vielschichtig wird das Motiv der zauberhaften Musik und der Rangeleien um ihre Geheimnisse in Helmut Kraussers historisch-phantastischem Roman
»Melodien« aufbereitet.
••• ZURÜCK
[4] Jede Folge dieser seit 2002 laufenden HBO-Serie beginnt mit einem Todesfall, mal tragisch, mal friedlich, mal grotesk, oder wie auch hier bei Gaiman fröhlich-komisch. In dieser Serie über ein familiäres Bestattungsunternehmen werden ansatzlos die Träume, Angst- und Wunschvorstellungen der handelnden Figuren visualisiert.
›Leider‹ sind diese individuellen Welten in die materielle Echtweltwirklichkeit einge-bettet. Dabei nutzt
»Six Feet Under« durchaus phantastische Erzählmittel, überschreitet jedoch nie die Grenze zur
›reinen‹ (High) Fantasy. Dennoch: schön wird hier gezeigt, wie jeder Mensch eigentlich in seiner eigenen Phantasiewelt lebt, und wie die Hinterbliebenen mit den Verstorbenen Zwiesprache galten.
••• ZURÜCK
[5] Harmloser Stoff für kuriosen und harmlosen Lokalpatriotismus: Das Blankobuch der Erstniederschrift hat Gaiman während seines Aufenthalts beim Göttinger Literaturfestival gekauft.
••• ZURÜCK
[6]Ich danke dem BibPhant-Haberer Gero für den Hinweis, daß Karsten Singelmann schon »American Gods« übersetzt hat. Der Mann hat sich seitdem verbessert.
••• ZURÜCK
Vorschau auf Molos Rezis in MAGIRA 2006 (mit Portraits)
Erstellt von molosovsky um 18:08
in
Literatur,
Magira Jahrbuch,
China Miéville,
Fantasy,
Jeff Vandermeer,
Tobias O. Meißner,
Weird Fiction,
Ian R. MacLeod,
Steampunk,
Neil Gaiman,
Phantastik
Eintrag No. 273
EDIT 23. Aug. 2006:: Um Links zu Portaitgroßansichten und den einzelnen Rezis ergänzt. Fehlerchen gemerzt, um Links zu Büchern ergänzt.
•••
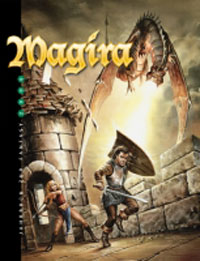 Mittlerweile ist »Magira – Jahrbuch zur Fantasy 2006« erschienen und die einzelnen Rezis (mit Anstandsverzögerung) auch in die Molochronik eingepflegt worden.
Mittlerweile ist »Magira – Jahrbuch zur Fantasy 2006« erschienen und die einzelnen Rezis (mit Anstandsverzögerung) auch in die Molochronik eingepflegt worden.
Nach meiner ›bösen‹ Rezi zu Tad Williams »Der Blumenkrieg« wollte ich (schon vor dem verständlichen Diss bei SF-Radio) diesmal auf gar keinen Fall von unangenehmen Lektüren berichten. Meckern kann ich zwar, aber es ist so öde. So gibts dieses Mal einen launischen Reisebericht über die seltsamen aber empfehlenswerten Bücher der Saison 2005/2006.
Die ganzen ca. 11.000 Worte sind wieder von Michael Scheuch und Herrman Ritter lektoriert worden (und Krischan Seipp durfte sich mit meinen Portrait-Illus herumschlagen). Hier findet der geneigte Leser das Introdubilo, die Überleitungs-Absätze.
Ich kann mich gar nicht genug bei den Genre-Kollegen und Genre-Freaks in den verschiedenen Foren die ich heimsuche bedanken. So manche Idee, Signatur, Ansichtssache hat mir beim Schreiben dieser launischen Empfehlungen geholfen.
•••
LAUNISCHE ABER AUFRICHTIGE EMPFEHLUBNGEN
VON SELTSAMEN & VERWIRRENDEN FANTASYBÜCHERN
DER PHANTASTIKSAISAON 2005/2006
»Ich sehe die Rezension als eine Art von Kinderkrankheiten an, die die neugeborenen Bücher mehr oder weniger befällt. Man hat Exempel, dass die gesündesten daran sterben, und die schwächlichen oft durch-kommen. Manche bekommen sie gar nicht. Man hat häufig versucht, ihnen durch Amulette von Vorrede und Dedikation vorzubeugen, oder sie gar durch eigene Urteile zu inokulieren, es hilft aber nicht immer.«
—Georg Christoph Lichtenberg, »Sudelheft J« (1718–1732)
—Was macht gute oder schlechte Phantastik aus? Wann sprießen wirklich neuartige Blüten im Garten der Fantasy und wann ist ›Fantasy‹ lediglich ’ne Karotte zum Erwartungsdirigieren und Treuekonditionieren von Konsumenteneseln? Wann wird an bestehende Traditionen erfrischend angeknüpft, und wann werden nur altbewährte Verführungstricks aufgefahren?
—Mensch Molo, lass doch den verkopften Quark und gib’ einfach Bescheid: ist ein Buch die Lappen, die ich dafür hinblätter wert, oder eben nich’? Überversimpelt gesagt, besteht im Beantworten solcher Fragen der Job eines Kritikers. Doch schaut man dazu am besten von einem fixen Standpunkt, z.B. als Torwächter auf die durchkommenden Bücherkarren aus den fraglichen Genregebieten, und lässt die Guten in die Stadtgemeinschaft passieren und weist die Unwürdigen ab; oder soll man versuchen, als Leuchtturmwärter den potentiellen Lesern Orientierungslicht zu spenden? Sicherlich sind solche statischeren Perspektiven auf Literatur und damit auch auf Teilgebiete wie Fantasy berechtigt und nützlich. Aber ich muss gestehen, dass ich mich dafür als zu skeptisch und sprunghaft einschätze, um auf brauchbare Art und Weise als Wache oder Leuchte zu dienen[01]. Ich will also im Folgenden versuchen, eine in ihrer Unaufgeräumtheit dennoch kurzweil-ige Sammelrezension anzubieten[02].
Aus den lebendigeren Gegenden des großen Kontinentes KONVENTIONA berichte ich, wie der geschickte Mythenimpressario Neil Gaiman, ein Konzert veranstaltet, indem er Spinnen Schöpfungslieder singen lässt, und wie Ian R. MacLeod mit Könnerschaft an gute alte europäische Prosatradition anknüpft, um vom ›Unbehagen in der beschleunigten Moderne‹ zu erzählen. Im verstreuten Inselreich AVANTGARDIEN wollte ich nicht versäumen zu erleben, wie China Miéville sein dreiteiliges ›gegen den Genre-Strich‹-Manöver mit rahmensprengender Vehemenz abschließt; und ich bin verblüfft vom artistischen Feinsinn Jeff Vandermeers, nachdem ich mich in seinem verführerischen, kompliziert-verspielten Narrationslabyrinth genüsslich verirrt habe.
Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da ›geb‹ ich lieber ›Zeitung‹ von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹[03], dass
»Niemand dies Buch ohne Verstörung lesen können (wird)«,
hoffnungsvoll als Kauf- und Leseanreiz.
 Tobias O Meißner: »DAS PARADIES DER SCHWERTER« –oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt.
Tobias O Meißner: »DAS PARADIES DER SCHWERTER« –oder: Wenn der Autor auch mit dem Würfel schreibt.
Zur Rezi.
•••
Nach soviel wilden Blutstrudeln, Sprachbrechern und Metaphernriffen entlang der zerfledderten Küsten AVANTGARDISCHER Inseln, nun zu einem Autor, den ich seit Jahren als ›sicheren Hafen‹ zu schätzen weiß, weshalb er in meiner Lektüregeographie an den Gestaden KONVENTIONIAS gelegen ist.
 Neil Gaiman: »ANANSI BOYS« –oder: »Die spinnen, die Götter«.
Neil Gaiman: »ANANSI BOYS« –oder: »Die spinnen, die Götter«.
Zur Rezi.
•••
Wie überraschend und erfrischend der Einfluss von älterer oder auch neuerer Mainstreamschreibe für heutige Fantasy bzw. Phantastik sein kann, hat ja auch die vielgelobte Susanna Clarke mit ihrem voluminösen »Jonathan Strange & Mr. Norrell« vorgeführt[04]. Jetzt wäre es natürlich Blödsinn, wenn ich hier in einem Jahrbuch zur Fantasy Werke dafür lobte, dass sie Lesern von ›kanonischer Literatur‹ feine Fantasy-Ausflüge bereiten. Umgekehrt wird aber ein Schuh draus: Fantasy-Leser, die ihre Nase bisher gar nicht oder seltenst in alte Bücher gesteckt haben, können sich z.B. vom folgenden Titel anfixen lassen, öfter mal vermeintlich ›angestaubter‹ Literatur ‘ne Chance zu geben.
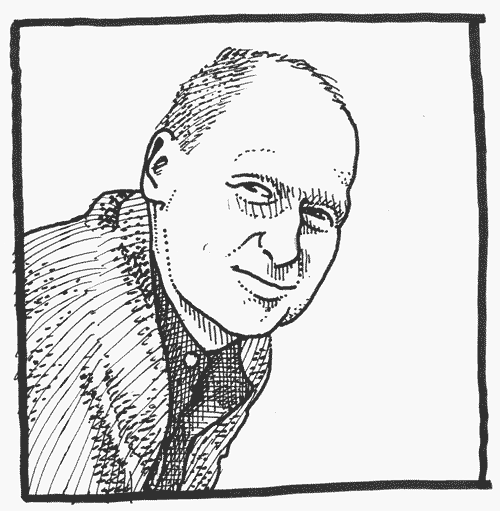 Ian R MacLeod: »AETHER« –oder: Vom melancholischen Leben im Takt der Maschinen.
Ian R MacLeod: »AETHER« –oder: Vom melancholischen Leben im Takt der Maschinen.
Zur Rezi.
•••
Ian R. MacLeod macht keinen Hehl daraus, als junger Mensch von linken Hoffnungen erfüllt gewesen zu sein. Es sei ihm gegönnt, dass er sich als gereifter und desillusionierterer Mensch einer eleganten Verquickung aus Zorn und Melancholie hingibt. Vom ältesten zum jüngsten Autor dieser Sammelrezi: Was kommt dabei heraus, wenn ein Geek mit heftigst lodernder ›Sozi-Inbrunst‹ auf diesen bedrückten Gemütslagen eine kräftige Portion handgreiflicher und spekulativer Äktschn aussäht?
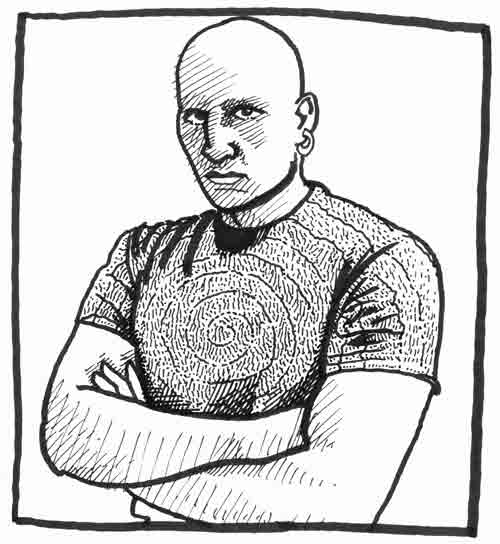 China Miéville: »DER EISERNE RAT« und Bas-Lag –oder: Wenn die ›Weird Fiction‹† revoluzzt.
China Miéville: »DER EISERNE RAT« und Bas-Lag –oder: Wenn die ›Weird Fiction‹† revoluzzt.
Zur Rezi.
•••
Nach dem bombastischen Ausflug in die konfliktreiche Globalisierungsgeschichte einer phantastischen Zweitschöpfungswelt schließe ich meinen Reisebericht nun mit einem thematisch nicht minder gegenwartsbezüglichen, bis auf Einschübsel meist indirekter Art gänzlich urbanem Erzählungspuzzle. Der nächste Autor ist auch so einer, der meint, dass man als Künstler sowohl seine art pour art-Haltung pflegen, und zugleich trotzdem zeitgenössisch auf der Höhe sein, und politisch-gesellschaftlich relevante Fiktionen von vergnüglicher Reife zustande bringen kann. Aber schon der Titel dürfte anklingen lassen, dass ›gnostischere‹ Fantasy auf einen zukommt.
 Jeff Vandermeer: »STADT DER HEILIGEN & VERRÜCKTEN« –oder: Kalmartentakel und Pilzsporen.
Jeff Vandermeer: »STADT DER HEILIGEN & VERRÜCKTEN« –oder: Kalmartentakel und Pilzsporen.
Zur Rezi.
•••
[01] —Vorsicht, nicht die Küste rempeln. •••
Zurück
[02] Darum wissend, dass ich selbst eine Virenschleuder für oben genannte ›Kinderkrankheiten‹ aus dem Reich der Meinungsschieberei bin. •••
Zurück
[04] Gwenda Bond stellt in ihrem Artikel für
»Fantasy Goes Literary«
(»Novels with supernatural elements are finding a new readership«)
für Publishers Weekly Einschätzungen von Verlagen und Agenten zu diesem Phänomen vor. ••• Zurück
China Miéville: »Perdido Street Station« (»Die Falter«, »Der Weber«) oder: Thrillerhafte Monsterhatz in einer urbanen Weird-Fiction-Fantasia
Eintrag No. 261 — Ich bin ja bekennender Bas-Lag und China Miéville-Fan. Meine größte Sorge ist da freilich, ob ich als ›Fan‹ überhaupt nichtpeinlich über das von mir bewunderte Werk schreiben kann. Folgende Besprechung erschien zuerst in »MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert.
•••
China Miéville (1972) bietet in »Perdido Street Station«‡ Phantastik, die zwar mit dem Genre der Fantasy kokettiert, aber die Mode a la Tolkien meidet. So erzählt der Roman weder von mystischen Questen noch von Kämpfen des Guten gegen das Böse, sondern die fatalen Folgen des Zufalls sind der Ausgangspunkt der Handlung.
‡ Originaltaschebuchausgabe in einem Band; 867 Seiten mit Karte; Pan Books; London, 2001 — Entweder: Für die deutsche Ausgabe in zwei Bücher aufgeteilt als: 1. »Die Falter«; 2. »Der Weber«; aus dem Englischen übersetzt von Eva Bauche-Eppers; je 557 Seiten; Bastei-Verlag; Bergisch Gladbach, 2002. — Oder: Einbändige Sonderausgabe von Amazon.
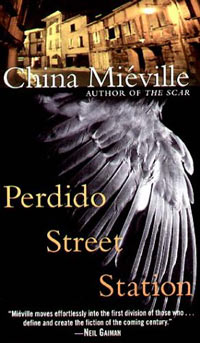 Es beginnt mit zwei Aufträgen.
Es beginnt mit zwei Aufträgen.
Erstens: Der Universalgelehrte und Erfinder Isaac Dan der Grimnebulin soll einen Weg finden, daß der flügellose Vogelmensch Yagharek wieder nach Belieben fliegen kann.
Zweitens: Isaacs Geliebte Lynn ist Künstlerin. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit soll sie eine lebensgroße Skulptur des Verbrecherfürsten Vielgestalt (englisch: Mr. Motley) anfertigen.
Isaacs Recherchen führen zur Freisetzung von extrem gefährlichen, exotischen Labortieren. Nicht nur, daß diese Lebewesen auf ausgeklügelt schauderhafte Weise jagen und sich laben, sie sind zudem nur umständlichst überwindbar. Hilfsmittel gegen die Monster zu finden und die Viecher zu erlegen sind nun die Ziele einer kleinen verzweifelten Gruppe um Isaac.
Großartig versteht es Miéville, die Millionenstadt New Crobuzon zum Beispiel eben als Speisetafel für die gefährlichen Monster-Falter darzustellen. Überhaupt geht viel Verführungskraft des Buches von der höchst originell ausgestalteten Welt Bas-Lag, bzw. der Stadt New Crobuzon aus. Mit viel Liebe zum Detail wird uns eine kapitalistisch-industrielle Metropole geschildert, in der alles möglich ist, die brummt und schafft, ständig verdaut und gebiert, Sehnsüchte der Mächtigen erfüllt und Hoffnungen der Unmächtugen zernichtet.
Für mich ist New Crobuzon dabei durchaus verwandt mit Ankh-Morpork aus Terry Pratchetts Scheibenwelt, nur ungleich härter und grimmiger. Wo die Phantasie bei Pratchett der komödiantischen Verspieltheit frönt, gibt sich Miéville lieber dem Grotesken hin. Beide führen die Klischees der Fantasy vor, der eine um damit Satire zu betreiben, der andere, um dem Genre eine erfreuliche Frischzellenkurz zu verpassen.
Zum Beispiel Rassen: Miéville bietet unter anderem Vogel- Wasser- und Kaktusmenschen (sic!) und Insekenfrauen. Wie Miéville zurecht kritisiert, werden Rassen in der Fantasy oftmals nur als Kürzel benutzt (Zwerge gieren immer nach Gold, Elfen sind immer arrogant und Trolle dumpf), und er unterläuft diese langweilige Mechanik von phantasieloser Fantasy, indem er Allgemeinplätze über Rassen als genau das vorführt: als gedankenlose oder rassistische Vorurteile.
Auch der Umgang von Wissenschaft und Thaumaturgie (die X-Kunst) ist wohltuend innovativ. Magie ist ein Wissenschaftszweig von vielen und selten habe ich so schöne Spekulationen in der Fantasy gelesen, wie bei Isaacs Bemühungen um eine einheitliche Feldtheorie und Krisis-Energie, mit der er Yaghareks Problem zu lösen hofft. Zu den vielen Fäden und Themen der Monsterhatz wurden u.a. die Folgen von bedenkenlos eingesetzten ›Atomwaffen‹, der Verselbstständigung einer kypernetischen (= konstruierten) Intelligenz, blutig niedergerungenen Arbeiterstreiks, politischer Untergrundaktivisten, rassenübergreifer Geschlechtsbeziehungen verwoben. Dabei ist »Perdido Street Station« trotz flotter Ereignisfolge und bunter Schilderung nicht durchwegs aalglatt zu konsumieren, sondern spielt ganz bewußt mit punktuell ungestümer Wortwahl (siehe ›Hä?‹-Refelx), lyrischem Sprachfluß, Perspektivenwechseln und haarsträubenden Kulminationen.
 China Miéville hat zwei große Interessen: Zum einen ist er in England als Sozialist politisch aktiv und hat sein Studium an der London School of Economics mit »Between Eqaul Rights« abgeschlossen. Zum anderen ist er ein echter Trash- und Monsterfan, der Rollenspielenzys als Unterhaltungslektüre verschlingt. Miéville nennt sich selbst einen Autor von ›Weird Fiction‹ und ihm ist nicht daran gelegen dem Leser tröstende Fantasy-Träume zu liefern, sondern er nutzt lieber die verstörenden, befremdenden Fähigkeiten des Genres. Mit traumwandlerischem Gefühl für Spannung, gute Dialoge und unterschiedlichste Athmosphären geschrieben, ist »Perdido Street Station« etwas, an das man fast nicht mehr glauben mochte: spekulative, provozierende Fantasy, schwindelerrend in seiner Erfindungswut und alles andere als tröstlich.
China Miéville hat zwei große Interessen: Zum einen ist er in England als Sozialist politisch aktiv und hat sein Studium an der London School of Economics mit »Between Eqaul Rights« abgeschlossen. Zum anderen ist er ein echter Trash- und Monsterfan, der Rollenspielenzys als Unterhaltungslektüre verschlingt. Miéville nennt sich selbst einen Autor von ›Weird Fiction‹ und ihm ist nicht daran gelegen dem Leser tröstende Fantasy-Träume zu liefern, sondern er nutzt lieber die verstörenden, befremdenden Fähigkeiten des Genres. Mit traumwandlerischem Gefühl für Spannung, gute Dialoge und unterschiedlichste Athmosphären geschrieben, ist »Perdido Street Station« etwas, an das man fast nicht mehr glauben mochte: spekulative, provozierende Fantasy, schwindelerrend in seiner Erfindungswut und alles andere als tröstlich.
Sehr zu dessen Wohl und zum verblüfftem Vergnügen des Rezensenten.
•••
Hier zu einer Liste der Molochronik-Einträge, die sich mit Miéville (mehr oder weniger) und seiner Art von Phantastik befassen.
Ricardo Pinto: »Der Steinkreis des Chamäleons«, Band 1 & 2 oder: Vertriebene im ummaurten Garten der Götter
Eintrag No. 262
Zuerst erschienen in »
MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert. —
EDIT: Um Autorenportrait ergänzt und Formatierung verbessert am 31. Mai 2008.
•••
 — Die Gebieter herrschen schon seit langer Zeit über die ›Drei Lande‹. Laut ihren Legenden stammen sie von den Sternen. Ihre Macht gründet sich auf den Fleischtribut den die Bevölkerung entrichtet und auf eine erbarmungslose Justiz, die nicht knauserig mit Verstümmelungs-, Blendungs- und Kreuzigungsurteilen ist. Nur unter ihresgleichen dürfen die Gebieter, die Auserwählten, ihre Gold- und Schmuckmasken ablegen. Erblicken Untergebene ihre unverhüllten Gesichter — … siehe Justiz. Reinheit und Makellosigkeit der Abstammung ist für die Gebieter von zentraler Bedeutung, so tragen sie die Blutwerte ihrer Eltern (Seriennummer läßt grüßen) als Narben auf dem Rücken, was auch zur rituellen Indentifizierung dient.
— Die Gebieter herrschen schon seit langer Zeit über die ›Drei Lande‹. Laut ihren Legenden stammen sie von den Sternen. Ihre Macht gründet sich auf den Fleischtribut den die Bevölkerung entrichtet und auf eine erbarmungslose Justiz, die nicht knauserig mit Verstümmelungs-, Blendungs- und Kreuzigungsurteilen ist. Nur unter ihresgleichen dürfen die Gebieter, die Auserwählten, ihre Gold- und Schmuckmasken ablegen. Erblicken Untergebene ihre unverhüllten Gesichter — … siehe Justiz. Reinheit und Makellosigkeit der Abstammung ist für die Gebieter von zentraler Bedeutung, so tragen sie die Blutwerte ihrer Eltern (Seriennummer läßt grüßen) als Narben auf dem Rücken, was auch zur rituellen Indentifizierung dient.
Soweit empfiehlt sich »Der Steinkreis des Chamäleons« schon mal als Lektüre für alle, die in der Fantasy gerne und ausführlich die Schattenseiten menschlicher Kultur durchgespielt bekommen (und denen z.B. die Kulturbeschreibung in Michael Moorcocks »Elric von Melniboné« zu flüchtig war).
 Angesiedelt in einer vorgeschichtlichen Zeit (mit Dinosauriern), begleitet der Leser die Bildungsreise des jugendlichen Karneol aus dem Hause Suth. Mit einem Teil seines Gefolges hat sich Karneols Vater auf eine Insel im Eismeer ins Exil begeben, fern vom paradiesischen Machtzentrum des Vulkankraterpalastes von Osrakum. Doch andere Gebieter kommen über das Meer und bewegen den Vater, eine wichtige Rolle bei der anstehenden Wahl des neuen Gottkaisers einzunehmen. Mit dem Verlassen der Insel endet Karneols behütete Kindheits- und Jugendwelt abrupt. In schmerzlichen Lektionen lernt er auf dem Weg nach Osrakum halbwegs, was seine Stellung als Gebieter eigentlich bedeutet; was dieser ›Job‹ an Distanziertheit, Selbstkontrolle und grausamen Kalkül verlangt. In Osrakum schließlich setzt er unwissentlich eine alte Prophezeiung in Gang.
Angesiedelt in einer vorgeschichtlichen Zeit (mit Dinosauriern), begleitet der Leser die Bildungsreise des jugendlichen Karneol aus dem Hause Suth. Mit einem Teil seines Gefolges hat sich Karneols Vater auf eine Insel im Eismeer ins Exil begeben, fern vom paradiesischen Machtzentrum des Vulkankraterpalastes von Osrakum. Doch andere Gebieter kommen über das Meer und bewegen den Vater, eine wichtige Rolle bei der anstehenden Wahl des neuen Gottkaisers einzunehmen. Mit dem Verlassen der Insel endet Karneols behütete Kindheits- und Jugendwelt abrupt. In schmerzlichen Lektionen lernt er auf dem Weg nach Osrakum halbwegs, was seine Stellung als Gebieter eigentlich bedeutet; was dieser ›Job‹ an Distanziertheit, Selbstkontrolle und grausamen Kalkül verlangt. In Osrakum schließlich setzt er unwissentlich eine alte Prophezeiung in Gang.
Ricardo Pinto war lange Zeit ein Designer für Computerspiele (unter anderem des Klassikers »Carrier Command«), und das ist den aberwitzigen Landschaften, bombastischen Architekturen und der perfide ausgeklügelten Gesellschaftshierarchie von »Der Steinkreis des Chamäleons« anzumerken. Pinto verfügt über viele originelle Ideen für seine Welt; weniger innovativ ist der Aufbau und Stil des Buches. So gerät manche Wegstrecke der beschwerlichen Reise(n) etwas langatmig und auch Karneols beständige Weigerung, sich gemäß seiner Stellung als Gebieter zu verhalten, zeitigt Längen. Da bin ich nun mal durch klassische Reiseberichte und alte Meister anspruchsvoll geworden im Lauf der Zeit. Doch werden diese etwaigen Längen durch intensive Abschnitte vollends ausgewogen, wenn Karneol neue Bauten und Stätten der Drei Lande ›besichtigt‹ (Panoramen!) oder anderen Gebietern begegnet (Mischung aus Duell und Konversation!).
 Zwei Beispiele für wuchtige Phantastik-Bilder: So wird das Ausmaß der grausamen Gebieterkultur Karneols bei seiner Ankunft in Osrakum deutlich, wenn er erkennt, daß der Kieselstrand am Eingang des Hauses seiner Familie aus Abermillionen kleiner handgeschnitzten Figuren besteht. Oder die Bibliothek der Weisen — einer bis auf den Tastsinn verstümmelten Priesterkaste — in Osakum. Fenster und lichtlos (die Weisen orientieren sich in der Bibliothek anhand von Markierungen auf dem Steinboden), bewahrt sie das Wissen hunderter Generationen auf Perlschnüren; Größe, Form, Gewicht, Oberflächenstruktur und Temperatur (Koralle ist wärmer als Metall) einer aufgeschnührten Perle bestimmen dabei die Bedeutung des ›Schrift‹-Zeichens.
Zwei Beispiele für wuchtige Phantastik-Bilder: So wird das Ausmaß der grausamen Gebieterkultur Karneols bei seiner Ankunft in Osrakum deutlich, wenn er erkennt, daß der Kieselstrand am Eingang des Hauses seiner Familie aus Abermillionen kleiner handgeschnitzten Figuren besteht. Oder die Bibliothek der Weisen — einer bis auf den Tastsinn verstümmelten Priesterkaste — in Osakum. Fenster und lichtlos (die Weisen orientieren sich in der Bibliothek anhand von Markierungen auf dem Steinboden), bewahrt sie das Wissen hunderter Generationen auf Perlschnüren; Größe, Form, Gewicht, Oberflächenstruktur und Temperatur (Koralle ist wärmer als Metall) einer aufgeschnührten Perle bestimmen dabei die Bedeutung des ›Schrift‹-Zeichens.
Bemerkenswert aber ist noch etwas ganz anderes. Ricardo Pinto selbst bekennt sich offen zu seiner Homosexualität und scheut sich nicht, sie zu einem bedeutenden Thema seiner Trilogie zu machen. Bei seinen Erkundigungen in Osakrum trifft Karneol auf Osidian, einen der beiden Gottkaiseranwärter. Zusammen tollen sie vergnügt durch die verbotenen Gärten von Osrakum, bis üble Intriganten sie aus der Machsphäre des Hofes entfernen und mit diesem Cliffhanger endet der erste Band »Die Auserwählten«.
In »Die Ausgestoßenen« finden sich der milde und mitfühlende Karneol und sein hochmütiger und grausamer Geliebter Osidian unter Wilden in dem von gigantischen Maueranlagen umspannten und unterteilen Bewachten Land wieder. Mit der Verschleppung aus dem Garten Eden endet die unbeschwerte Liebe der beiden. Osidian ist nicht wie Karneol gewillt, sich den Sitten des sie aufnehmenden Stammes anzupassen. Der verhinderte Gottkaiser sinnt vermehrt auf Rache gegen seinen nun inthronierten Bruder und macht sich nur insofern Gedanken um die Menschen des Stammes, wie er sie für seine Zwecke einsetzten kann.
Auch wenn Pinto als Stilist und Dramaturg mehr hergeben könnt, als Weltenbauer überzeugt er mich. Auf seiner Homepage bietet er interessante Einblicke in seine Notizen und Skizzen zur Welt der Drei Lande. Ob die Geschichte den ganzen Aufwand und die ca. 1800 Seiten wert sein wird, wird sich erst mit dem Erscheinen des dritten Bandes zeigen. Mit vielen kenntnissreichen Anlehnungen an alte und (sogenannte) primitive Kulturen schafft es Pinto, eine magische Vorwelt (ohne Magie) zu erschaffen, die sich nicht hinter klassischen Phantasien von vergessenen vorgeschichtlichen Reichen verstecken muß.
•••
Der Steinkreis des Chamäleons (The Stonedance of the Chameleon); aus dem Englischen von Wolfgang Kerge; jeweils drei Karten, gebunden mit Lesebändchen.
- »Die Auserwählten« (The Choosen, 1999): 603 Seiten, Klett-Cotta, Stuttgart 2001; ISBN: 978-3-608-93241-6
- »Die Ausgestoßenen« (The Standing Dead, 2002): 624 Seiten, Klett-Cotta, Stuttgart 2002; ISBN: 978-3-608-93242-3
Jürgen Lodemann: »Siegfried und Krimhild« oder: Aus der Mitte Europas
Eintrag No. 259
Zuerst erschienen in »
MAGIRA 2003 — Jahrbuch zur Fantasy«, herausgegeben von Michael Scheuch und Hermann Ritter. Für die Molochronik z.T. gekürzt bzw. erweitert. —
EDIT: Um Autorenportrait ergänzt und Formatierung verbessert am 31. Mai 2008.
•••
Die älteste Geschichte aus der Mitte Europas
im 5. Jahrhundert notiert, teils lateinisch, teils in der Volkssprache,
ins irische Keltisch übertragen
von Kilian Hilarus von Kilmacduagh
im 19. Jahrhundert von John Schazman ins Englische,
ins Deutsche übersetzt, mit den wahrscheinlichen Quellen
verglichen und mit Erläuterungen versehen
von Jürgen Lodemann
So lautet der komplette Nebentitel dieser großartigen Neufassung der Geschichte des Nibelungenlieds. Kilian und Schazman sind dabei ebenso fiktiv, wie die durch sie auf Lodemann gekommene Urfassung der Nibelungen.
 Zwanzig Jahre Recherchen und Schreibarbeit hat Jürgen Lodemann (1936) in den Roman »Siegfried und Krimhild« investiert. Er ist sonst eher bekannt als Gründer der SWF-Bestenliste, einer meinungsgeben Plattform im deutschen Literaturbetrieb.
Zwanzig Jahre Recherchen und Schreibarbeit hat Jürgen Lodemann (1936) in den Roman »Siegfried und Krimhild« investiert. Er ist sonst eher bekannt als Gründer der SWF-Bestenliste, einer meinungsgeben Plattform im deutschen Literaturbetrieb.
Da freu ich mich freilich, wenn ein solch repektabler Autor noch dazu mit den nötigen Schreibmuskeln gesegnet geduldig der Forderung Goethes nachkommt, aus den Nibelungen ein spannendes Volksbuch zu machen. Früh schon erkannten damals begeisterte Leser, daß man diese »älteste Geschichte aus der Mitte Europas« in einer Liga mit den großen Stoffen der Antike anzusiedeln kann.
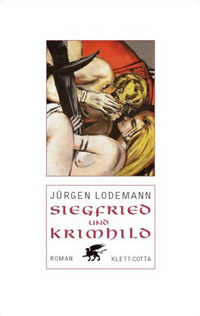 Jedoch: Krasse Verdrehung wie der Mär von der Nibelungentreue der Nazis oder völlige Entleerung wie bei der Wormser Festspiel-Wurschtigkeit läßt bis heute für viele eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Epos anrüchig und suspekt erscheinen. Obwohl ihm das von einigen Kritikern attestiert wird, stellt Lodemanns Buch aber keine simple Gegenüberstellung von widersprechenden Weltauffassungen dar.
Jedoch: Krasse Verdrehung wie der Mär von der Nibelungentreue der Nazis oder völlige Entleerung wie bei der Wormser Festspiel-Wurschtigkeit läßt bis heute für viele eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Epos anrüchig und suspekt erscheinen. Obwohl ihm das von einigen Kritikern attestiert wird, stellt Lodemanns Buch aber keine simple Gegenüberstellung von widersprechenden Weltauffassungen dar.
Das seit Umberto Ecos »Der Name der Rose« bewährte (postmoderne) Verfahren der Vermengung von Fakten mit fiktiven Quellen nutzt Lodemann, um seine politischen und dramatischen Spekulation enger am Ideal historischer Authenzität entlang zu gestalten.
Die Szenenfolge der Geschichte stehen ja fest: Siegfrieds Heldentaten im Dienste des Wormser Hofes; seine Liebe zu Krimhild und die Beihilfe, die er ihrem Bruders Gunther bei der Brautwerbung um Brünhilde leistet; die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Bräuten Krimhild und Brünhild; der Verrat an Siegfried und seine Ermordung durch den Wormser Heermeister Hagen; der Wahnsinn der trauernden Krimhild und ihre Heirat mit Etzel; Krimhilds Rache an den Mördern Siegfrieds und das Blutbadfinale im Saalbrand. So klar die Taten beschrieben sind, so unklar bleiben größtenteils bis heute die Beweggründe der Figuren, die Hintergründe der Geschehnisse. Eine (eindeutige) Urfassung aus der Zeit der Ereignisse wird zwar von der seriösen Forschung inzwischen als sehr wahrscheinlich angenommen, aber (noch) ist sie nicht gefunden worden. So schildern die drei bedeutendsten der uns bekannten Quellen aus der Zeit um 1200 bereits zeitgeschichtlich gefärbte Versionen der Geschichte, z.B. lassen sie Siegfried mal als naiven Gutmenschen, mal als heidnischen Tölpel erscheinen.
Die Deutung der Ereignisse, die Lodemann anbietet, ist so unerhört und abwegig nicht. Auf der einen Seite stehen die lateinisch-christlichen Herren, auf der anderen die Heiden von jenseits der Reste des römischen Reiches. Das Machtstreben der heiligen Mutter Kirche und die Nulltoleranz gegenüber naturreligiösen Freidenkern bietet eine Schnur, auf der Lodemann die einzelnen Stationen des Nibelungenliedes überzeugend aufzufädeln weiß. Die politische These und Tendenz des Buches manifestiert sich vielleicht am klarsten in der einzigen großen Hinzudichtung von Lodemann, Bischof Ringwolf, dem eigentlichen Machthaber zu Worms.
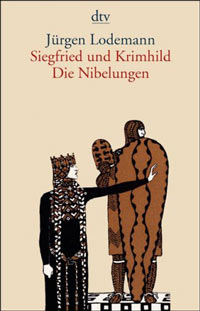 Der zweifarbige Schriftsatz (wie eine Simultanübersetzerstimme folgen in Rot die Übersetzungen etwa lateinischer Begriffe, sowie geographische, geschichtliche, mythologische und ethymologische Erläuterungen) ist gewöhnungsbedürftig, macht das Buch aber nebenbei zu einer unterhaltsamen gegenwartsbezogenen Gesellschaftskritik. Zumindest ich kann nicht sagen, daß Lodemann sich ein endgültiges, einseitiges Urteil gönnt sich , vielmehr hütet er sich aus den geschilderten Gegensätzen einen manichäischen Konflikt zu machen und läßt das Heldentaten-Buch, die Megatragödie melancholisch und ehrfürchtig ausklingen.
Der zweifarbige Schriftsatz (wie eine Simultanübersetzerstimme folgen in Rot die Übersetzungen etwa lateinischer Begriffe, sowie geographische, geschichtliche, mythologische und ethymologische Erläuterungen) ist gewöhnungsbedürftig, macht das Buch aber nebenbei zu einer unterhaltsamen gegenwartsbezogenen Gesellschaftskritik. Zumindest ich kann nicht sagen, daß Lodemann sich ein endgültiges, einseitiges Urteil gönnt sich , vielmehr hütet er sich aus den geschilderten Gegensätzen einen manichäischen Konflikt zu machen und läßt das Heldentaten-Buch, die Megatragödie melancholisch und ehrfürchtig ausklingen.
Diese Nibelungen sind mehr als eine willkürliche Vermengung von wilden Helden- und blutrünstigen Rachegeschichten. Bemerkenswert ist zudem, mit welch großer Sprachfreude und atemberaubender Vorstellungskraft »Siegfried und Krimhild« geschrieben ist. Hier wird spannend und kenntnisreich sichtbar gemacht — und nichts anderes bedeutet das Wort ›phantastisch‹.
•••
Siegfried und Krimhild: Zweifarbige Typographie; 886 Seiten.
Gebunden mit Lesebändchen; Klett-Cotta, Stuttgart 2002; ISBN: 978-3-608-93548-6
Taschenbuch bei DTV, München 2005; ISBN: 978-3-423-13359-3
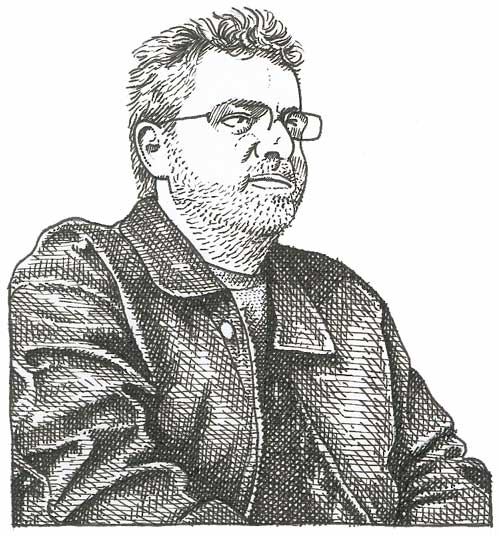 Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.
Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.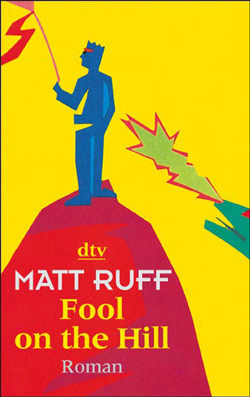 »Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.
»Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.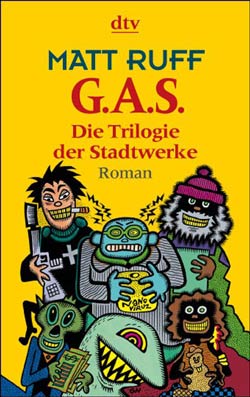 Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).
Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist). Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das
Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das 2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!
2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!

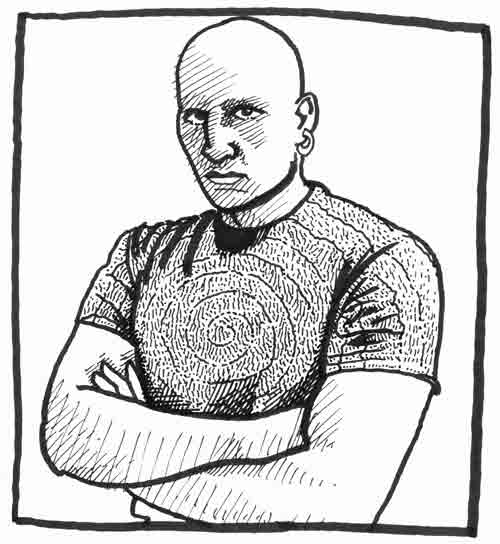
 »›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.
»›Once Upon A Time In Bas-Lag‹, mindestens!« könnte ich flapsig trailern. Denn das Superbreitwandpanorama des Romans erzählt davon, wie das Vorankommen eines Dampfrosswundermaschinendings die Entfernungen nichtet; wie einst isolierte Orte durch Schienen vernetzt werden; und dass mit dem Anschluss an das pumpende Herz des monströsen Zivilisationsmolochs New Crobuzon nicht nur Fortschritt, Neues, Nachrichten und lebhafter Handel in einstige Ödnisse strömen, sondern auch Korruption, Ausbeutung, Intrigen, sowie soziale und bellezistische Konflikte. Ganz ähnlich wie in dem melodramatischen Todestanz von Sergio Leone kann man anfangs ‘ne ganze Weile die ungewöhnliche Informationsfülle an Kleinigkeiten und die angespannten Situationen von »Der Eiserne Rat« nur rätselnd mitverfolgen. Da ich glaube, dass die Komplexität und Tiefe des Romans schier undurchschaubar sind, wage ich es, in folgender Inhaltsskizze einige hoffentlich hilfreiche Spoiler zu platzieren.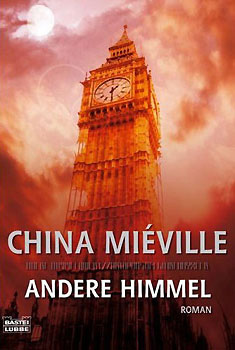
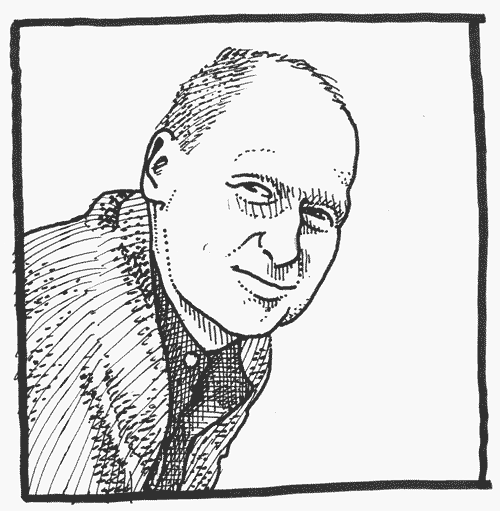
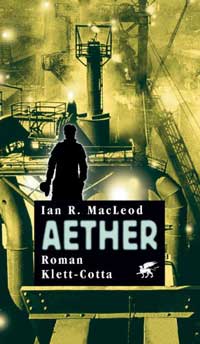
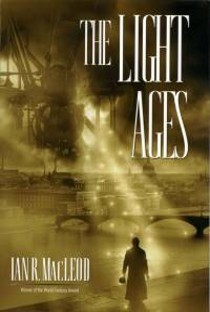 Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters
Ian R. MacLeod schafft es bewundernswert, auf mehreren Ebenen spannend zu erzählen und anregende Phantastik aufzuführen. »Aether« lässt sich als Abenteuergeschichte lesen, mit Robert als Helden, der die Geheimnisse seiner Herkunft, des Aethers und der Gildenherrschaft aufdecken will. Da die buchstäblich zauberhafte Anna Winters 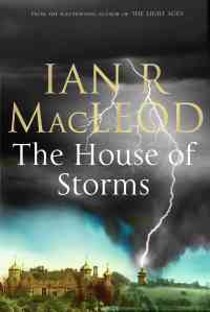
 Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹
Wenn man die üblichen Grenzen zwischen ›Trash‹ und ›Literatuuur‹ mal vergisst, ist es erstaunlich festzustellen, dass hierzulande gescheiter und lustvoller Genre-Fantasy betrieben wird, als man bei übler Laune schlecht reden kann. Da geb’ ich lieber Zeitung von einer mir neuen heimischen Fantasy-Hoffnung, und freue mich denn ‘nu auch besonders, wenn Lorenz Jäger für die noble FAZ den ›Schwert aber Nix-Magie‹-Fantasyroman eines jungen Berliner Buch- und Comicautors lobt. Der immer nach neuen Krassheiten gierende Äktschn-Freak in mir nimmt Jägers ›Warnung‹ Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages.
Die zweite Hälfte des Romanes widmet sich dem Turnier selbst, das mit seiner ›programmhaft‹-linearen Szenenfolge einen schönen Kontrast zur Sprunghaftigkeit der ersten Hälfte bildet. Mit großem Gestus schließt Meißner gekonnt das Zusammenlaufen der Schicksalsfäden beim Auslosen der ersten Runde ab. Beeindruckend, wie viele mögliche Entwicklungen nun vom Ausgang der Kämpfe abhängen. Da wird naiv, verbissen oder fatalistisch gehofft. Pragmatischere Teilnehmer nehmen das Ganze mehr als Job, andere als spirituelle Prüfung, oder kompensieren mit der Konkurrenzgeilheit ihre verworrenen Triebe. Einige Nebenfiguren aus den Vorgeschichten der Teilnehmer sind mit von der Partie, in den feinen Logen, inmitten des launischen Pöbels, oder auch hinter den Kulissen. Da sind freilich welche, die versuchen, ihr eigenes krummes Ding durchzuziehen, andere geraten in immer tiefere Verzweiflung im Verlauf des ›Einer wird gewinnen‹-Tages. Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt
Eintrag No. 356 — Dieses Jahr habe ich einen Tagesabstecher auf die Leipziger Buchmesse gemacht, hauptsächlich um mal als Fan dabeizusein, wie der Engländer Neil Gaiman (1960) sein neuestes Buch bei uns vorstellt 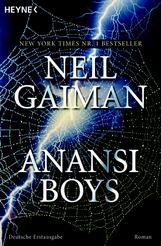 Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.
Zur allgemeinen Werks-Orientierung: »Anansi Boys« führt den Weltenentwurf von »American Gods« (2001) fort, aber die Bücher bilden keine Serie und sind sich in Tonfall und Färbung eher unähnlich. Man kann beide je für sich genießen. Miteinander verglichen, kommt der dickere »Amercian Gods« düsterer und dreckiger, »Anansi Boys« fröhlicher und komischer daher.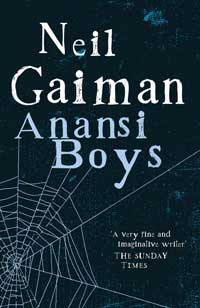 Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.
Bemerkenswert finde ich eine Besonderheit der britischen Originalausgabe von Headline Review: einen Anhang mit Exclusive Material, das leider nicht in der deutschen Ausgabe zu finden ist. Da wird 21 Seiten lang Faksimile-Einsicht in die handschriftliche Erstfassung gewährt.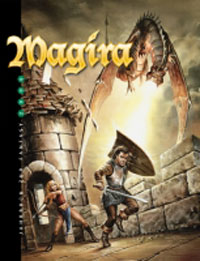
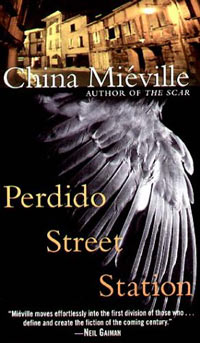 Es beginnt mit zwei Aufträgen.
Es beginnt mit zwei Aufträgen. China Miéville hat zwei große Interessen: Zum einen ist er in England als Sozialist politisch aktiv und hat sein Studium an der London School of Economics mit »Between Eqaul Rights« abgeschlossen. Zum anderen ist er ein echter Trash- und Monsterfan, der Rollenspielenzys als Unterhaltungslektüre verschlingt. Miéville nennt sich selbst einen Autor von ›Weird Fiction‹ und ihm ist nicht daran gelegen dem Leser tröstende Fantasy-Träume zu liefern, sondern er nutzt lieber die verstörenden, befremdenden Fähigkeiten des Genres. Mit traumwandlerischem Gefühl für Spannung, gute Dialoge und unterschiedlichste Athmosphären geschrieben, ist »Perdido Street Station« etwas, an das man fast nicht mehr glauben mochte: spekulative, provozierende Fantasy, schwindelerrend in seiner Erfindungswut und alles andere als tröstlich.
China Miéville hat zwei große Interessen: Zum einen ist er in England als Sozialist politisch aktiv und hat sein Studium an der London School of Economics mit »Between Eqaul Rights« abgeschlossen. Zum anderen ist er ein echter Trash- und Monsterfan, der Rollenspielenzys als Unterhaltungslektüre verschlingt. Miéville nennt sich selbst einen Autor von ›Weird Fiction‹ und ihm ist nicht daran gelegen dem Leser tröstende Fantasy-Träume zu liefern, sondern er nutzt lieber die verstörenden, befremdenden Fähigkeiten des Genres. Mit traumwandlerischem Gefühl für Spannung, gute Dialoge und unterschiedlichste Athmosphären geschrieben, ist »Perdido Street Station« etwas, an das man fast nicht mehr glauben mochte: spekulative, provozierende Fantasy, schwindelerrend in seiner Erfindungswut und alles andere als tröstlich.