Sonntag, 26. Juli 2009
Michael Chabon: »Gentlemen of the Road«, oder: Juden mit Schwertern im Reich der Chasaren.
Eintrag No. 580 — Vier Tage frei. Da kann ich nicht die ganze Zeit mit dummen »GTA IV«-Multiplayergedaddel vertändeln oder mich mit der Übersetzung der Annotationen zum vierten »Sandman«-Sammelband abrackern (die übrigens in den nächsten Tagen folgt, hurrah!). Heute also eine Empfehlung zu ‘nem kurzweiligen (wenn auch sprachlich durchaus anspruchsvollem) Abenteuerroman des Amerikaners Michael Chabon (*1963), den ich im Laufe der vergangenen Woche als Arbeitsweglektüre fertiggelesen habe.
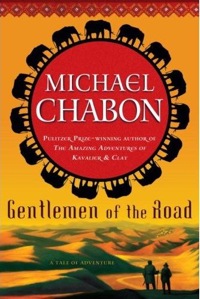 Um sich schnell zu orientieren, was »Gentlemen of the Road« bietet, reicht der Arbeitstitel (»Juden mit Schwerten«) und die vorangestellte Widmung (»Für Michael Moorcock«). — Juden mit Schwerter deshalb, weil der Roman etwa 950 n.d.Z. im Reich der zum Judentum konvertierten Chasaren, an der Westküste des Kaspischen Meeres, angesiedelt ist. Die Chasaren, ursprünglich ein nomadisch/halbnomadisches Turkvolk, hatten für einige Jahrhunderte eines dieser aus den Nebeln der Geschichte kommendes und wieder verschwindendes Königreich. Wenig ist bekannt. Sie kloppten sich mit den Arabern, pflegte ganz gute Beziehungen mit Byzanz, etwas heiklere Beziehungen mit den Rus von Novgorod und profitierten vom Vielvölkergewusel der Seidenstraße. Im 8. oder 9. Jahrhundert nahm die adelige Elite die jüdische Religion an (ob das Volk auch wechselte ist umstritten) und kannte eine Kaiser-(Bek) und Papst-(Khagan)artige Trennung von weltlicher und geistlicher Autorität. — Wie die Faust aufs Aug passt es, dass Chabon diesen Roman Michael Moorcock widmete. Ist doch Moorcock ein Großmeister der Schwert & Magie-Fantasy (egal, ob diese nun in magischen Zweitweltschöpfungen angesiedelt ist, oder in abenteuerlich aufgebrezelten historischen Epochen). Allein schon die beiden Helden von Chabon gemahnen an das Vorbild: da ist einmal der (schwarze), bärengroße, geselligere Amram aus Abyssinien, der eine runengeschmückte, langstielige Wikingeraxt genauso kunstvoll führt, wie die Figuren des Schatrandsch-Bretts (einem Vorläufer des heutigen Schach); und zweitens der hagere, bleiche Zelikman, letzter Überlebender einer bei einem Progrom getöteten jüdischen Arztfamilie aus dem (dunklen, nebligen, kalten, waldreichen und unkomfortablen) fränkischen Reich, der mit einer Aderlassklinge (sozusagen als Rapier-Vorläufer) ficht, mit seinen Pharmakas Heilung, Betäubung und Tod herbeizaubern kann und zwischen der Äktschn düster brütend an seiner Bhang(=Hasch)-Pfeiffe zuzelt.
Um sich schnell zu orientieren, was »Gentlemen of the Road« bietet, reicht der Arbeitstitel (»Juden mit Schwerten«) und die vorangestellte Widmung (»Für Michael Moorcock«). — Juden mit Schwerter deshalb, weil der Roman etwa 950 n.d.Z. im Reich der zum Judentum konvertierten Chasaren, an der Westküste des Kaspischen Meeres, angesiedelt ist. Die Chasaren, ursprünglich ein nomadisch/halbnomadisches Turkvolk, hatten für einige Jahrhunderte eines dieser aus den Nebeln der Geschichte kommendes und wieder verschwindendes Königreich. Wenig ist bekannt. Sie kloppten sich mit den Arabern, pflegte ganz gute Beziehungen mit Byzanz, etwas heiklere Beziehungen mit den Rus von Novgorod und profitierten vom Vielvölkergewusel der Seidenstraße. Im 8. oder 9. Jahrhundert nahm die adelige Elite die jüdische Religion an (ob das Volk auch wechselte ist umstritten) und kannte eine Kaiser-(Bek) und Papst-(Khagan)artige Trennung von weltlicher und geistlicher Autorität. — Wie die Faust aufs Aug passt es, dass Chabon diesen Roman Michael Moorcock widmete. Ist doch Moorcock ein Großmeister der Schwert & Magie-Fantasy (egal, ob diese nun in magischen Zweitweltschöpfungen angesiedelt ist, oder in abenteuerlich aufgebrezelten historischen Epochen). Allein schon die beiden Helden von Chabon gemahnen an das Vorbild: da ist einmal der (schwarze), bärengroße, geselligere Amram aus Abyssinien, der eine runengeschmückte, langstielige Wikingeraxt genauso kunstvoll führt, wie die Figuren des Schatrandsch-Bretts (einem Vorläufer des heutigen Schach); und zweitens der hagere, bleiche Zelikman, letzter Überlebender einer bei einem Progrom getöteten jüdischen Arztfamilie aus dem (dunklen, nebligen, kalten, waldreichen und unkomfortablen) fränkischen Reich, der mit einer Aderlassklinge (sozusagen als Rapier-Vorläufer) ficht, mit seinen Pharmakas Heilung, Betäubung und Tod herbeizaubern kann und zwischen der Äktschn düster brütend an seiner Bhang(=Hasch)-Pfeiffe zuzelt.
Ohne festes Ziel, außer der Flucht vor den sie plagenden Traumata ihrer unglücklichen Vergangenheiten, sind sie als Trickbetrüger im Chasarenreich unterwegs und geraten dort in vertrackte Machtkampf- und Rachewirren. Da sollen Amram und Zelikman als Leibwache die Vergeltungsabsichten eines durch den Ursurpator Buljan gestürzten Chasarenprinzen, Alp, und dessen Schwester, Filaq, unterstützen. Trotz der Kürze geht es abwechslungsreich rund: es gibt unter anderem plündernde und mordende Rus-›Wikinger‹, Flüchtlingsströme, Pestkranke, Entführungen und nächtliche Befreiungen, Untertauchen und Erholung in einem Hurenhaus, Brettspielpartien um Leben und Tod, weit herumgekommende Kriegselephanten (mal nett, mal brutal), Vierteilungsvorbereitungen, nächtliches Eindringen in heilige Bibliotheken, Verkleidungstricksereien und Männer, die sich als Frauen entpuppen, Gebetsrunden für für dahinsiechende Kranke und Lagerfeuergastfreundschaft. Kurz: alles was ein ordentlicher Abenteuergarn braucht.
Krass (im, für mich, angenehm-erstaublichen Sinne) fand ich Chabons sprachliche Überinstrumentierung, die allerdings für einen kurzen Roman, der ja ein exotisches Flair haben soll, passt. Da strickt Chabon schon mal so lange Sätze mit vielen (für mich zumindest) seltsamen Vokabeln, dass mir ganz Lovecraft’isch zumute wurde und ich mich nebenbei ein wenig um Kulturgeschichte kümmern musste. Aber Chabons rüschenreicher Sti bringt auch süffige Dialoge hervor, so zum Beispiel (Seite 155):
»We’re glad to hear it {that Filaq is healed and only in want of a sword}«, Amram said, »but Zelikman and I have talked it over and come to the conclusion that you can’t possibly kill Buljan in his present estate. He is too powerful, too strong, too well protected and too well armed. I understand that you want revenge, Filaq. It is an impulse I know and respect. But it must not be heeded. It must be deferred. Now I can see that you’re about to open that big mouth of yours and pronounce the word ›coward‹, and so I have to warn you that if you offer such mistaken analysis of my character und that of my friend, who though admittedly prone to brooding and self-doubt is braver than any man I have ever known, excepting myself, I will be under an immediate obligation to kick your narrow pink ass.«
Gerade wegen der arabesken und zisilierten Sprache bin ich gespannt, wann dieses Büchlein (endlich) auf Deutsch erscheint, und wie es sich dann macht. Und freilich noch gespannter bin ich, ob die sehr gelungenen Zeichnungen von Meister Gary Gianni für die deutsche Ausgabe übernommen werden (ich prophezeie mal pessimistisch: werden sie nicht).
•••
Michael Chabon: »Gentlemen of the Road« mit einer Karte, Illustrationen von Gary Gianni; einem Nachwort des Autoren & Anmerkung zu den Chasaren; 15 Kapitel auf 196 Seiten; Del Rey Taschenbuch 2008; ISBN: 978-0-345-50850-8.
Dienstag, 21. Juli 2009
Vorschau auf »Magira – Jahrbuch zur Fantasy 2009«
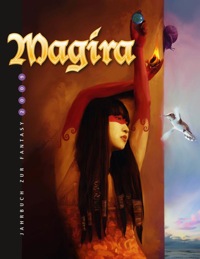 Eintrag No. 579 — Im August ist es wieder so weit: das neue »Magira« wird erscheinen. Gute Nachricht für alle, denen meine Werksübersicht zu, nebst Interview mit Matt Ruff letztes Jahr zu ›wenig‹ war: es wird diesmal wieder eine ausführliche (38 Seiten lange!) Sammelrezi von mir geben, »Wonniglich verirrt im Labyrinth der Phantastik«, als Schlußschmankel des Bandes, mit Empfehlungen zu Ju Honisch (»Das Obsidianherz«), China Miéville (»Un Lun Don«), Max Brooks (»Operation Zombie«), Nick Harkaway (»Die gelöschte Welt«), Hal Duncan (»Vellum«), Thomas Pynchon (»Gegen den Tag«) und Mark Z. Danielewski (»Das Haus«), wie gewohnt mit Introdubilo und Überleitungen, Fußnoten und Portraits.
= erweiterte Fassung meiner Molochronik-Rezi.
Eintrag No. 579 — Im August ist es wieder so weit: das neue »Magira« wird erscheinen. Gute Nachricht für alle, denen meine Werksübersicht zu, nebst Interview mit Matt Ruff letztes Jahr zu ›wenig‹ war: es wird diesmal wieder eine ausführliche (38 Seiten lange!) Sammelrezi von mir geben, »Wonniglich verirrt im Labyrinth der Phantastik«, als Schlußschmankel des Bandes, mit Empfehlungen zu Ju Honisch (»Das Obsidianherz«), China Miéville (»Un Lun Don«), Max Brooks (»Operation Zombie«), Nick Harkaway (»Die gelöschte Welt«), Hal Duncan (»Vellum«), Thomas Pynchon (»Gegen den Tag«) und Mark Z. Danielewski (»Das Haus«), wie gewohnt mit Introdubilo und Überleitungen, Fußnoten und Portraits.
= erweiterte Fassung meiner Molochronik-Rezi.
Ich freue mich schon besonders auf folgende Beiträge:
- »Werner Arends Bücherkiste«, jedes Jahr eine der besten Rundschauen auf das zurückliegende anglo-amerikanische Neuerscheinungsjahr;
- die beiden erstmalig auf Deutsch erscheinenden Kurzgeschichten von Karl Edward ›Kane‹ Wagner: »Misericordia« und »Der Andere«;
- Robert Musas Filmbetrachtungen zu »Hellboy II – Die Goldene Armee« und »Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen«;
- das ausführliche Interview von Erik Schreiber mit Thomas Plischke (auch wenn ich mit den Ambosszwergen nicht glücklich wurde, schätze ich Plischke als einen umtriebigen und engagierten Kommentator);
- den Essay » Als die Fantasy die Erde verließ« von Thomas Gramlich (hab zwar keine Ahnung, worum es da geht, aber ich bin neugierig und weiß, dass Gramlich immer feine texte liefert).
Hinweis: auf der »Magira«-Shop-Seite gibt es derzeit günstige Paketangebote (solange der Vorrat reicht).
Montag, 20. Juli 2009
Zweimal David B.: »Der Tengu« und »Nocturnal conspiracies«
Eintrag No. 578 — Endlich komme ich dazu, mal etwas gegen den Mißstand zu unternehmen, dass sich bisher in der Molochronik nur Empfehlungen für anglo-amerikanische Comics finden (nebenbei spiegelte diese Ausschließlichkeit überhaupt nicht den Bestand und Mix meiner Comic- und Bildromanbibliothek wider. Da finden sich in etwa Halbe-Halbe Franko-Belgisches und Anglo-Amerikanisches, mit einem ›Exoten‹-Segment Spanier, Italiener, Japaner und Südamerikaner. Ach ja: und eine Handvoll deutschsprachige Comics.)
2008 erhielt David B. für seine zweibändige autobiographische Familien-/Brüdergeschichte »Die heilige Krankeit« (Band 1.: »Geister«; Band 2.: »Schatten«) den Max & Moritz-Preis des Comicsalons von Erlangen. Darin erzählt David B. ergreifend davon, wie es ist, mit einem an Epilepsie leidenden Bruder groß zu werden, was für Irrwege die Familie auf der Suche nach Heilung unternimmt, und trotz des realistisch-nüchternen Grundtons gönnt sich das Comic phantastische Visualisierungen, macht mit den Mitteln der Bildsprache anschaulich, welche emotionellen Auswirkungen die Krankheit auf David B. und seine Familie hatte.
Doch um diesen Comic, mit dem David B. zurecht den Respekt der ›literarischen‹ Comicleserkreise erwarb, soll es hier nicht gehen. Stattdessen möchte ich kurz zwei frühere Arbeiten des Künstlers vorstellen, in denen David B. mal ungebändigte Abenteuerphantastik, mal berauschend rätselhafte (Alpt)Träume hochleben läßt.
 Das deutschsprachige Debüt von David B., »Der Tengu«, bescherte uns die Edition Moderne (ich danke Andrea, dass sie diesen Band einst in unser Heim holte). »Der Tengu« ist eine hinreissend ungestüme, wilde Liebeserklärung des Franzosen an die japanische Mythologie und deren Haudrauf-Romantik, komplett mit Schwertgemetzel, Schießereien, Überfällen, Zaubermänteln und vielen vielen grotesken Monstern.
Das deutschsprachige Debüt von David B., »Der Tengu«, bescherte uns die Edition Moderne (ich danke Andrea, dass sie diesen Band einst in unser Heim holte). »Der Tengu« ist eine hinreissend ungestüme, wilde Liebeserklärung des Franzosen an die japanische Mythologie und deren Haudrauf-Romantik, komplett mit Schwertgemetzel, Schießereien, Überfällen, Zaubermänteln und vielen vielen grotesken Monstern.
Alle hundert Jahre steigen aus den Eingeweiden der Erde die verschlagene Füchsin und der vorsichtige Pilz an die Oberfläche, um Japan mit ihren gesichtslosen Eierkopfkriegern und Dämonenkämpfern heimzusuchen. Ihnen auf der Spur sind unzählige Polizisten und ein namenloser alter Dämonenjäger-Mönch, der sich einen Dreck um die Ehrenregeln der Mönchskaste kümmert und also mit Sichel- & Morgensternkette, sowie mit Samuraischwert herumwirbelt, sowie ganz heiß darauf ist, eine möglichst große Kanone in die Finger zu bekommen. Mit von der Partie ist der junge Schwertmeisterschüler Yashu, der einzige Überlebende eines schrecklichen Geschlachtes, das der schreckliche Parashurama angerichtet hat. Seit Samurais das Dorf von Parashurama niedergemacht haben, ist dieser bärtige Hüne mit seinem Tarnmantel auf Rache aus und will alle Samuraischulen des Landes vernichten. Yashu wiederum will sich für die Zerstörung seiner Schule an Parashurama rächen und trifft dabei auf den stets Streiche anrichtenden Berggeist Tengu. Der Tengu wurde von seinem Meister, dem ehrwürdigen weisen Eremiten Shidei, verjagd, weil der Tengu für heilloses Chaos in einem Dorf sorgte, indem er den Reis der Bevölkerung zum Sprechen brachte. — Beispiele für das köstliche Phantastikgeblödel gefällig, wenn die plappernden Reiskörner durch die Körper der Dorfbewohner strolchen und ihre Wanderung kommentieren? In einer Sprechblase die aus einem Ohr kommt, lesen wir: »Hier gehts nach draussen«; aus der Nase: »Seht mal, hier ist Licht«, vom Scheitel: »Seht euch das an! Da oben ist ein großer leerer Saal«, aus dem Magen: »Ich weigere mich, von solchen Innereien voller Geschwüre verdaut zu werden!«
Die Geschichte ist ein einziges atemloses Hauen und Stechen, die verschiedenen chaotisch durch das Land hetzenden Parteien stellen sich Fallen, tricksen sich aus, klauen sich Zauberartefakte und stellen sich Fallen. Eine extrem kurzweilige Wonne und erfrischend zu lesen, weil David B. diesen Tumult nicht mit dem üblichen (über)dynamischen Stil der meisten Manga- oder Äktschn-Comics inszeniert, sondern alles mit bewundernswert klaren, lustig stilisierten Schwarz/Weiß-Zeichnungen darbietet.
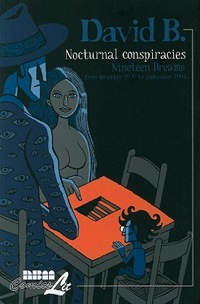 Auch wenn die Zeichnungen von »Nocturnal conspiracies« unverkennbar im gleichen Stil wie »Der Tengu« gehalten sind (jedoch: die flächig gehaltenen S/W-Kontraste und geometrisch vereinfachten Formen werden durch sparsame Grau- und Blautöne angereichert), unterscheidet sich die Stimmung dieses Bandes erstaunlich. Die neunzehn Traumprotokolle entführen die Leser in ein undurchschaubares Reich mal beunruhigend-verstörender, mal zärtlich-rätselhafter Begebenheiten. Selten habe ich so getreulich anmutende und dabei immer noch intuitiv verstehbare Traumgeschichten gelesen. Kurz: phantastische Poesie vom Feinsten!
Auch wenn die Zeichnungen von »Nocturnal conspiracies« unverkennbar im gleichen Stil wie »Der Tengu« gehalten sind (jedoch: die flächig gehaltenen S/W-Kontraste und geometrisch vereinfachten Formen werden durch sparsame Grau- und Blautöne angereichert), unterscheidet sich die Stimmung dieses Bandes erstaunlich. Die neunzehn Traumprotokolle entführen die Leser in ein undurchschaubares Reich mal beunruhigend-verstörender, mal zärtlich-rätselhafter Begebenheiten. Selten habe ich so getreulich anmutende und dabei immer noch intuitiv verstehbare Traumgeschichten gelesen. Kurz: phantastische Poesie vom Feinsten!
Auf der Website des englischen Verlages NBM gibt es die komplette zehnte Geschichte, »The Bed«, als Leseprobe.
Hier meine Schnellübersetzung:
Seite 1: Traum vom 18. September 1991. / Ich bin in einem Obstgarten und werde von einem Killer verfolgt. / Ich flüchte, verstecke mich im hohen Gras und hinter den Bäumen.
Seite 2: Ich bin in der Nähe der Mauer, die den Obsthain umfasst. / Ich bin im Efeu, das die Mauer bedeckt. / Wie in einem Bett lasse ich mich darin nieder. Der Killer kann mich nicht sehen.
Seite 3: Von der Mauer aus kann ich einen arabischen Prinzen sehen, wie er einem seinen Helfer etwas überreicht. / Es sind Früchte. Pflaumen, glaube ich. / {Prinz:}»Ich gebe kein Geld, denn es korrumpiert.« / Ich bin in gleichen Palast, aber in einem Gebetsraum. Der Prinz ist auch dort.
Seite 4: Er wendet sich der Mihrab {einer nach Mekka gerichteten Nische} zu. Ich weiß, dass er meine Anwesenheit nicht verraten wird. {David B.:} »Ich kann auf die Großzügigkeit dieses Prinzen zählen.« / Ich verlasse das Gebäude. / Ich bin auf einer Landstraße. / An ihrem Ende sehe ich eine zerklüftete Küste.
Seite 5: Ich laufe auf den Felsen. Ich weiß, dass ich einen Ort erreichen muss. / Hinter mir sehe ich einen Stier. / {David B:} »Das ist der Wächter der Küste! Er ist hinter den Flüchtenden her!«
Seite 6: {David B:} »Er wird sich schwer damit tun, über die Felsen zu laufen.« / Ich laufe so schnell ich kann, springe von Felsen zu Felsen.
Seite 7: Ich blicke zurück, um zu sehen wie der Stier sich sehr vorsichtig vorwärts bewegt. Er hat Angst auszurutschen. / Ich bin in Sicherheit, er wird mich nicht einholen. / Tatsächlich, ich habe ich mein Ziel erreicht, eine Öffnung in den Felsen, geformt wie ein Bett.
Seite 8: Ich nehme die Zeitschrift. / Ich gleite in das Steinbett. / Ich bin gerettet.
In vielen der Geschichten treten wie in »The Bed« geheimnisvolle Agenten, Spione und Mörder auf, und nur selten sind deren Ziele (z.B. Weltherrschaft) klar benannt, aber immer sind sie dem Protagonisten David B. auf den Fersen. Auch menschenfressende Monster gibt es nicht zu knapp, jedoch finden sich auch unvorhergesehene Rettungen und Wunder ein. — Aufgrund der bisweilen verstörenden Natur einiger brutaler und/oder erotischer Szenen empfiehlt sich dieses Album nicht als Lektüre für allzu junge Leser.
Es ist nicht verwunderlich, dass ich über eine Empfehlung des amerikanischen Meisters moderner ›Magischer Realismus‹-Fantasy, Jeff Vandermeer, auf diesen Band gestoßen bin.
Leider liegt dieser Band (noch) nicht auf Deutsch vor. Ich hoffe, das ändert sich bald.
•••
David B.:
- »Der Tengu«: (fr. 1997 »Le Tengû carré«), aus dem Französischen übersetzt von Martin Bude; 164 x 243 mm, Schwarz/Weiß; 14 Kapitel auf 144 Seiten; Edition Moderne 1999; ISBN: 3-907055-30-6.
- »Nocturnal conspiracies – Ninteen Dreams from december 1979 to september 1994«: (fr. 2005 »Les Complots nocturnes«), aus dem Französischen ins Englische übersetzt von Joe Johnson; 151 x 229 mm, Schwarz/Weiß mit Grau- & Blautönen; 19 Geschichten auf 124 Seiten; NBM ComicsLit 2008; ISBN: 1-56163-541-3.
Sonntag, 19. Juli 2009
Kurznotiz zu Gustave Flaubert: »Die Versuchung des heiligen Antonius«
 Eintrag No. 577 — Habe ich diese Woche als Diogenes-Taschenbuch aus dem Ramsch gefischt. 1874 erschien die endgültige Fassung dieses vision- und trugbildgesättigten Drama-Romans, an dem Flaubert etwa 40 Jahre gebosselt hat, und den er selbst als Höhepunkt seines Schaffens betrachtete. — Wegen seines (wie Thomas Mann meint) »polyhistorischen Nihilismus« erregte das Buch einiges Aufsehen und den Groll der bürgerlichen Kritik, denn (wiederum Mann) er ist »nicht nur ein phantastischer Katalog aller menschlichen Dummehiten {…} auch der Irrsinn der religiösen Welt wird lückenlos vorgeführt«.
Eintrag No. 577 — Habe ich diese Woche als Diogenes-Taschenbuch aus dem Ramsch gefischt. 1874 erschien die endgültige Fassung dieses vision- und trugbildgesättigten Drama-Romans, an dem Flaubert etwa 40 Jahre gebosselt hat, und den er selbst als Höhepunkt seines Schaffens betrachtete. — Wegen seines (wie Thomas Mann meint) »polyhistorischen Nihilismus« erregte das Buch einiges Aufsehen und den Groll der bürgerlichen Kritik, denn (wiederum Mann) er ist »nicht nur ein phantastischer Katalog aller menschlichen Dummehiten {…} auch der Irrsinn der religiösen Welt wird lückenlos vorgeführt«.
Die klassische Legende über den Heiligen Antonius führt drei große Bedrängungen des um Tugendhaftigkeit ringenden Asketen vor: (i) die Versuchung durch schöne Frauen, am deutlichsten durch die Erscheinung der Köigin von Saba; (ii) die angsteinflössende Heimsuchung durch furchterregende Monster; sowie (iii) die Verführung durch das Angebot von Macht und Reichtum.
Als Anhang liefert die Diogenes-Ausgabe einen Fan-Brief von Ernest Renan an Flaubert vom September 1874, sowie einen Text von Paul Valéry aus dem Jahre 1942.
Der Brief von Renan spendet einige geradezu glühende Verteidigung der phantastischen Hervorbringenen künstlerisch gestalteter Einbildungskraft:
Die große Trösterin des Lebens, die Einbildungskraft, hat ein besonderes Vorrecht, das aus ihr, alles wohl erwogen, das kostbarste aller Geschenke macht; das liegt daran, daß ihre Leiden Wollüste sind. Mit ihr ist alles Gewinn. Sie ist die Grundlage für die Gesundheit der Seele, die wesentliche Voraussetzung für die Fröhlichkeit. Sie macht, daß wir den Wahnsinn der Wahnsinnigen und die Weisheit der Weisen genießen.
Denn, so meine Folgerung, ohne die bereichernde Hilfe der Einbildungskraft bliebe der Wahnsinn etwas beispielsweise unangenehm Schreckliches, und die Weisheit, von mir aus, etwas zeigefingerwedelnd Langweiliges.
Wunderbar, wie Renan schließlich die kleinkrämerische Kritik gegenüber phantastischen Schöpfungen kommentiert, wenn er schreibt:
Daß der Zug der Träume der Menschheit für Augenblicke einem Maskenzug ähnelt, ist kein Grund dafür, sich ihre Darstellung zu verbieten. Arme Menschheit! {…} jedermann durchlebt seine Stunden des Zwiefels; in solchen Stunden tröste nur Farbe und Bild. Und das ist keine eitle Schwärmerei. Die Einbildungskraft hat ihre Philosophie. {…} In Sachen Kunst stellt einzig die bürgerliche Plattheit etwas Unmoralisches dar. Welcher Irrtum, die kraftvolle Ausübung unserer natürlichen Fähigkeit {der Einbildungskraft} als Krankheit zu bezeichnen! {…} Die Arbeit der Einbildungskaft ist gesund, so wie es für ein Land gesund ist, gute Militärs, gute Maler, gute Philosophen, gute Arbeiter auf jedem Gebiet zu haben.
•••
Gustave Flaubert: »Die Versuchung des heiligen Antonius« (fr. 1874), Übersetzung von Felix Paul Greve (1907-1909) revidiert von Franz Cavigelli (1979); Drama-Roman in sieben Akten; Anhang mit Texten von Ernest Renan & Paul Valéry & einem Glossar; 215 Seiten; Diogenes Taschebuch 1979; ISBN: 3-257-20719-0
Samstag, 18. Juli 2009
Thomas von Steinaecker in der »F.A.Z.« über Kapitalismus und den Roman
(Eintrag No. 576; Woanders, Kapitalismus, Phantastik) — Ich bin ganz fassungslos vor Begeisterung darüber, wie gut und wie nahe meiner ›Linie‹ Artikel »Das dünne Eis der Fiktion« (Teil der Serie »Zukunft des Kapitalismus«) aus der Feder von Thomas von Steinaecker (zuletzt hervorgetreten mit dem Roman »Geister«) in der F.A.Z. vom 14. Juli ist. Er rüttelt mit seinem Text an dem Roman-Ideal der letzten Jahrzehnte, dessen …
… bevorzugter Stil der des vermeintlichen Realismus {ist}; vermeintlich deshalb, weil sich seine Stoffe, sein Vokabular und seine Struktur auf die Erfassung der Oberfläche eines unmittelbaren Umfelds konzentrieren. Aber nicht nur dessen phantastische Grundierung gerät dabei aus dem Blick, sondern auch der Sinn für Zusammenhänge.
Steinecker beginnt seine Gedankengangargumentation sehr luzide (und erstaunlich knapp gehalten) bei Daniel Defoe und dessen »Robinson Crusoe«, der bereits sehr eindringlich vor den die Phantasie Leichtgläubiger verführenden Scheinerfindungen von Projejktemachern warnte. Die aktuelle Krise des Kapitalismus beruht laut Steinaecker wesentlich auch auf einer »explosiven Zunahme von Phantasien auf allen Seiten«, mit Bankern, Anlegern und Schuldern, die durch ihr Treiben die »Börse als Traumfrabrik« erscheinen lassen.
Man beachte, wie Steinaecker auf das seit »Star Trek: The Next Generation« vertraute Holodeck zurückgreift, um die schlagartige (Spekulations)-Desillusionierung zu veranschaulichen.
Dienstag, 14. Juli 2009
Vorschau »Magira 2009«: Novik, Farmer, Wagner
Erstellt von molosovsky um 08:08
in
Portrait
(Eintrag No. 575; Portrait) — Im August soll (wenns pünklich sein wird) das nächste »Magira – Jahrbuch zur Fantasy« erscheinen, und ich biete hier als kleinen Anreitzer eine erste Lieferung dafür gezeichneter Portraits.
Naomi Novik

Philip Jose Farmer (für den Nachruf)

Karl Edward Wagner (deutsche Erstveröffentlichung von Kurzgeschichten im kommenden »Magira«)

Montag, 13. Juli 2009
»Deutscher Phantastik Preis 2009«: Die Hauptrunde
Erstellt von molosovsky um 11:36
in
Alltag
(Eintrag No. 574; Alltag, Literatur, Phantastik, Preis) — Wie ich erwartet habe, schaffte es die Molochronik nicht in die »Deutscher Phantastik Preis«-Hauptrunde in der Sparte ›Beste Internet-Seite‹. Da bin ich nicht geknickt. Arg verwirrt hätte es mich, wenn ich unter die letzten fünf Kandidaten gekommen wäre. — Denn mal ehrlich: ich bin wohl ein unbequemer Phantastik-Fachdepp. Ich klingle zuweilen eitel mit Worten und Anspruchsdenke; schlamper aber dabei frei Schnauze herum; gebe mich gerne elitär; und mache keinen Hehl aus meiner Verachtung von Wohlfühl- und Serienphantastik. So krank und verschroben kann die beim DPP abstimmende Klientel gar nicht sein, um mich auf einen der vorderen Plätze zu wuppen. — Gefreut hat mich die Shortlist-Erwähnung trotzdem: Danke nochmals!
Aber ich will wie auch schon bei der Vorrunde kundtun, für was ich mich entschieden habe.
- Bestes deutschsprachiges Romandebut: Ich bleibe bei meiner Favoritin Ju Honisch und ihrem History-Fantasyroman »Das Obsidianherz«. Eine Empfehlung von mir wird Sommer/Herbst kommenden »Magira 2009« erscheinen.
- Bester internationaler Roman: Auch wenn es irgendwie ungeschickt ist, für den dritten Band eines Zyklus zu stimmen, geht meine Stimme an Neal Stephenson für »Principia«, sozusagen stellvertretend für den ganzen »Barock-Zyklus«.
- Bester Grafiker: Bei der Auswahl bleibt mir eigentlch nix anderes übrig, als Dirk Schulz zu wählen. Immerhin kann der Mann selber zeichnen, ödet mich nicht an mit Photoshopgeklicke oder kreuzbraves Gepinsel.
- Bestes Sekundärwerk: Jetzt bin ich mal so frech und stimme für eine Publikatio, bei der ich selber mitmache, also »Magira – Jahrbuch zu Fantasy«.
- Beste Internet-Site: Keine leichte Wahl, denn so richtig superdoll finde ich keinen der zur Auswahl stehenden Kandidaten. »Bibliotheka-Phantastika« hat zwar ein lebhaftes Forum, aber auf der Hauptsite tut sich seit einiger Zeit nix Neues. »Zauberspiegel-Online« und »Geisterspiegel« sind mir zu heftchenserien- und trashgesättigt um wählbar zu sein. »Phantastik-Couch« ist mir zu unkritisch und glattgebügelt. Bleibt also »Fantasyguide«, auch wenn die ein schreckliches Layout haben. Aber immerhin geben sich dort einige Autoren (nicht unvergeblich) Mühe, ein bischen Kontroverse und Diskussion in der Phantastikgemeinschaft anzuregen. — Und endgültig preiswürdig ist das »Fantasyguide«-Team für mich, weil sie sich mit großem Engagment der Neuausgabe der von Jorge Luis Borges zusammegestellten Anthoreihe »Die Bibliothek von Babel« gewidmet haben
Sonntag, 12. Juli 2009
Duck & Cover!! Die Vodafone-Vogonen wollen befähigen
(Eintrag No. 573; Gesellschaft, Woanders, Werbung, »Netz Zwei Null Drei Vier und Alle Schunkeln!!!«) — Ums kurz zu machen. Habe mich hinreissen lassen, auch meine zwei Pfennig Gedanken zum Rehlaunsch einer Marke zu schreibseln.
Das entsprechende Ifänt hat Andrea köstlich in »die kraft und die herrlichkeit in ewigkeit amen« dokumen-kommentiert:
Also Reklame. Kostet zwar mehr als jemand, der mal ans Telefon geht, belästigt aber gleich viel mehr Menschen, weil die Republik damit zugepflastert wird. Und was ist zu sehen auf der Reklame? Leute, die ins Internet schreiben. Für die hat sich Vodafone auch einen neuen Namen ausgedacht, Generation Upload nennt man das jetzt, das hat vermutlich auch ganz schön was gekostet.
… Don Alphonso hat in der F.A.Z. unter »Vodafone lädt auf und eckt an« zusammengefasst:
Ein Spektakel auf allen Kanälen, das zukünftigen Werbern als 200 Millionen teures Beispiel dienen wird, wie man sich im Internet umfassend, oder wie man in der Branche sagt, 360 Grad, den Ruf ruiniert.
… und hier hat Mirco Lange dann seinem Ärger Luft gemacht, wie gemein die Netz-Fundamentalisten über die armen Vodafonevogonen herziehen:
Aber zurück zum eigentlichen Thema, zur “Generation Polemik”. Ich finde die aktuelle Situation in Deutschland einfach nur bedauerlich. Wir haben keine Kultur des Respekts vor Engagement. Keine Kultur der Anerkennung. Keine Kultur der Differenzierung. Überall wird sofort Raffgier und rein wirtschaftliches Interesse vermutet, streng nach dem Motto: “Vodafone tut ja nur so, als ob sie sich öffnen, damit sie uns besser bescheißen können – aber nicht mit uns!” {…} Ich finde, Vodafone hat Anerkennung verdient. Sie haben keine Anerkennung für eine tolle “Social Media Aktion” verdient, die war tatsächlich schlecht. Und ich halte die Testimonials auch für nicht unbedingt glücklich gewählt.
Ein Gedankenpferd hat mich wohl getreten, dass ich nun ausgerechnet in Herrn Langes Talkabout-Blogeintrag meinen Senf abgelassen habe.
Hier das Allgemeine meiner Gedanken, damit Ihr Molochronikleser Euch den Weg sparen könnt:
Wenn ein Großunternehmen wie Vodafone eine Absichtserklärung aufwändig in den Raum strahlt, heißt das ja noch nix. Mit der PR-Veranstaltung hat Vodafone sich mit ihrem vogonenhaften Auftreten, dem geballten Bullshit
-Denglisch auf jeden Fall zur leicht treffbaren Zielscheibe gemacht. Was nun nach der stilistisch (für manche) peinlich bis schleimig wirkenden Absichtserklärung folgt, bleibt abzuwarten.
Es ist wohl nicht übertrieben anzunehmen, dass ein kommerzieller Großbetrieb wie Vodafone zuvörderst an Geld und Marktanteilen interessiert ist. Es wurde ja auch klar geäußert: der Kunde soll im Mittelpunkt stehen, weil zufriedene Kunden die besten Aquirierer neuer Kunden sind usw. Wiegesagt: ob das gelingt bleibt abzuwarten. Für viele ist aber der Auftritt, weil nicht authentisch, bisher schon mal in die Hose gegangen. Muss ja auch nicht sein, dass Vodafone sympathisch rüberkommt. Reicht ja schon, wenn Leistung und Service stimmen.
{…}
{S}oweit ich zu verstehen glaube was › Corporate Social Media‹ sein soll (denn auf die schnelle finde ich dazu nichts erhellend Erklärendes), bin ich dem Konzept gegenüber seeehr skeptisch. Klingt für mich nach einem weiteren Versuch, als Großunternehmen die Kunden gleich selber einzuspannen was Werbung und Marktforschung betrifft. Der Start des Blogs macht keine Hoffnung: irgendwelche Tüdel-Konzerte und Formel 1. Danke, aber solch seichter Schmu ist der Grund, weshalb ich im Netz nur sehr selektiv unterwegs bin und seit 15 Jahren kein TV gucke
Was Vodafone macht, ist mit 180 Millionen Aufmerksamkeit heischen. Nebenbei: Warum denkt keiner daran, die Steuern auf Werbung zu erhöhen. Ganze U-Bahn-Stationen in Frankfurt sind zugekleistert mit den Vodafon-Gedöns. Ich finde das einfach nur obszön. — Mit so viel Kohle kann man, auch als Unternehmen a la Vodafone, Klügeres machen
Ach ja: wo sind eigentlich die konkreten Produktangebote? Davon bekomme ich nirgendwo etwas mit. Es geht Vodafone derzeit wohl nur darum zu posaunen: »Wir empowern jetzt die Netzgemeinschaft, so die uns denn will«.
Und gebashed werden ist nun mal die Gefahr für alle, die sich breitbeinig mitten in der schönsten Gesellschaft an den Flügel setzten und drauf los klimpern. Natürlich ist es schön, wenn jemand Musik machen möchte, denn Musik ist etwas zutiefst Feines. Aber dann sollte man auch musikalisch sein, ein Instrument spielen können und die Mukke spielen, die zur jeweiligen Gesellschaft passt. Oder um bei Douglas Adams-Metaphern zu bleiben: ›die Netzgemeinschaft‹ ist eher Zaphod Beeblebrox, und Vodafone führt sich halt auf wie Vogonen. Kein Wunder, dass Zaphod genervt abschätzig reagiert.
Wahrscheinlich bin ich durch langjähriges »Dilbert«-Lesen einfach taub geworden für solche Werbeaktionen.
Mittwoch, 8. Juli 2009
Molos Übersetzung von Daniel Chandlers: »Eine Einführung in die Genre-Theorie«
 Eintrag No. 572 — Vor etwa vier Jahren habe ich angefangen, diesen Text von Daniel Chandler zu übersetzen. Aus verschiedenen Gründen habe ich die Arbeit zur Seite gelegt. Damals hatte ich das Gefühl, noch nicht gut genug zu sein, um so einen ›trockenen‹ literaturtheoretischen Text brauchbar ins Deutsche zu übersetzen. Vergangene Woche aber bin ich in einem meiner Archive wieder wieder über das Dokument gestolpert, habe in den letzten Tage daran herumgefeilt und biete es nun also für deutsche Leser an.
Eintrag No. 572 — Vor etwa vier Jahren habe ich angefangen, diesen Text von Daniel Chandler zu übersetzen. Aus verschiedenen Gründen habe ich die Arbeit zur Seite gelegt. Damals hatte ich das Gefühl, noch nicht gut genug zu sein, um so einen ›trockenen‹ literaturtheoretischen Text brauchbar ins Deutsche zu übersetzen. Vergangene Woche aber bin ich in einem meiner Archive wieder wieder über das Dokument gestolpert, habe in den letzten Tage daran herumgefeilt und biete es nun also für deutsche Leser an.
Solch ein einführender Überblick zum Thema Genre hat meiner Meinung nach im deutschen Netzel bisher gefehlt (mir ist zumindest nichts Vergleichbares, frei Zugängliches auf Deutsch bekannt). — Immerhin grassieren die ärgsten Irrungen und Vorurteile. Zum Beispiel, dass sich Genres klar und eindeutig voneinander abgrenzen, bzw. einzelne Texte sich problemlos einem Genre zuordnen lassen, ähnlich der biologischen Unterteilung von Pflanzen und Tieren; oder dass Genres sich durch einen Kriterienkatalog bestimmter inhaltlicher Ein- und Ausschluss-Merkmale definieren lassen.
Hier nun lediglich eine Zusammenfassung. Wenn Ihr den ganzen Text von Daniel Chandlers »Eine Einführung in die Genre-Theorie« lesen mögt, dann klickt oben auf das Bild, oder hierher, um das PDF herunterzuladen.
- Das Problem der Definition
Zweifel — Tradition der Typologie — ›Keine neutrale Angelegenheit‹ — Vier Hauptprobleme (Ausdehnung, Normativismus, monolithische Definitionen, Biologismus) — Konventionen — ›Empiristisches Dilemma‹ — ›keine diskreten Systeme‹ — Familienähnlich- und Prototypenhaftigkeit — Eine Frage der Absicht — Genre sind ›Prozesse der Systematisierung‹ — Machtkämpfe zwischen Genres — A-historische Suche nach ›Idealtypen‹ — Drei Merkmale evolutionärer Genre-Entwicklung (kumulativ, konservativ, Ausdifferenzierung) — Gefahr des Essenzialismus — Genres als Verkörperung bestimmter Werte und Ideologien — Marxistische Sicht auf Genre: Instrument gesellschaftlicher Kontrolle — Absichten von Genres — Die ›rhetorische Dimesion‹ — Mitteilungsmodus und idealer Leser — Gesellschaftliche Prägung — Nutzen von Genres für Massenmedien — Wirtschaftliche Vorteile von Genres — Minderwertigkeit von Genretexten — Intertextualität — Schablonen — ›Kein Text ist ohne Genre‹.
- Innerhalb von Genres arbeiten
Genres als stillschweigende Verträge — Kreative Spannung und Effizienzsteigerung — Genres als Bezugsrahmen und Schablonen — Genrekenntnisse als ›kulturelles Kapital‹ — Studien über Kinder und Genres — Soziale Zugänge zu Genres — Vertrautheit und Abweichung — Arten der Beteiligung — ›Verwendung und Zufriedenstellung‹ — Erkennen von Vertrautem — Hinauszögerung und Vorfreude — ›Kognitive‹ Befriedigung — ›Wiederholung und Variation‹ — Urteile fällen — Austausch mit interpretierender Genre-Gemeinschaft — ›universelle Dilemmas‹ und ›moralische Konflikte‹.
- Die Konstruktion des Publikums
Erschaffung der Leserschaft — Verbreitung hegemonieller Ideologie — Konstruktion von Verschiedenheit und Identität.
- Vorteile der Genre-Analyse
Textualität, Lesart und gesellschaftlicher Zusammenhang — Gleichmacherei entgegenwirken — Historische Perspektive — Routinen und Formeln aufweisen.
- Hilfreiche Handreiche für eigene Genre-Analysen
- Allgemein
- Zum Mitteilungs-Modus
- Beziehungen zu anderen Texten
- Appendix 1: Taxonomie von Genres
Vier Arten des Handlungsverlaufes (Exposition, Argument, Beschreibung, Erzählung) — Fiktionale und Nicht-fiktionale Genres — Wissen und imaginäres Vergnügen — Hybridformen — Abbildung: TV-Genres.
- Appendix 2: Textmerkmale von Genre-Film und -Fernsehen
Narration — Charakterisierung — Grundthemen — Setting — Ikonographie — Techniken — Stimmung und Tonfall — Thema und Form.
- Quellen und empfohlene Lektüren
Montag, 6. Juli 2009
Mal was neues, meint die freundliche Welt: Urban Fantasy
(Eintrag No. 570; Woanders, Phantastik, Fantasy, Urban Fantasy) — Schon wieder »Die Welt«. Diesmal jedoch mit einem ihrer Artikel aus der Reihe: »Wir erklären Euch die Phantastik«. (Wohl ein Beitrag aus der Elternratgeberreihe: »Was ist das für ein seltsamer Quatsch, den meine Kinder lesen?«)
Wieland Freund darf da im Text »Dumbledore fährt jetzt U-Bahn« kund geben, dass ›Urban Fantasy‹ die neueste Modewelle sei. Und Urban Fantasy liegt nach Freund vor, wenn die …
Pseudo-Mythologie der herkömmlichen Fantastik in die Metropolen getragen wird.
Aber, Freund liefert auch diesen schönen Satz:
»Zur sogenannten High oder Epic Fantasy {…} verhält sich die Urban Fantasy wie einstmals die Rolling Stones zu den Beatles.«
Passt aber irgendwie nicht. — Ich schlag mal den Vergleich vor, dass High/Epic Fantasy ist Enja und Clannad und Urban Fantasy ist Pouges und Bellowhead.
Kleine Korrektur: Jeff Vandermeers Roman »Shriek« spielt mitnichten zur Gänze in der fiktiven Zweitschöpfungswelt-Metropole Ambra. Es gibt in »Shriek« zum Beispiel ein Schlüsselkapitel, das im Waldumland der Kleinstadt Stockton spielt; ein anderes spielt in der mittelgroßen Stadt Morrow.
Seufzen lässt mich folgendes:
Ohnehin: die Keimzelle der Urban Fantasy zu suchen, ist in etwa so schwer, wie dieses fantastische Sub-Genre von anderen zu unterscheiden. Wo etwa fängt die Urban Fantasy an und wo hört der sogenannte Steampunk auf {…}
Da wird wieder mal stillschweigend so getan, als ob anständige Genrebegriffe klar abgrenzbar und eindeutig zu sein haben (und alles andere ist irgendwie subversiv, oder was). Nochmal: Genrebegriffe sind selten klar und einfach zu bestimmen, aber so gut wie immer eine Vereinfachung und Zurechtbiegung. Und: Einzelne Werke können sehr wohl mehreren Genres angehören. Wenn sich also gewisse Urban Fantasy wie Science Fiction lesen, ist das kein Problem, sondern ein ›Blickwinkel wechsel dich‹-Angebot.
Wiederum arg versimpelt:
Und auch Neil Gaiman {…} schreibt nicht explizit über Städte.
Und was ist mit Gaimans erstem Roman »Neverwhere«? Was mit seinen vielen »The Sandman«-Kapiteln und Handlungssträngen die in Städten spielen (ich erwähne nur Heft 51, weil ganz besonders exemplarisch: »The Tale of Two Cities« aus dem »Worlds’ End«-Sammelband).
Dann macht Freund Werbung für Jugendbuchneuerscheinungen die wohl nur erwähnenswert sind, weil sie vom gleichen britischen Lektor vermittelt wurden, der auch Rowling entdeckt und Funke ins Englische gewuppt hat.
Ansonsten aber keine Erwähnung von Michael de Larrabettis »Die Borribles«; kein Verweis darauf, wie Pratchett mit seiner Scheibenweltmetropole Ankh-Morpork reale Urbanitätseigenheiten (vor allem die Londons) satirisch-phantastisch aufs Korn nimmt; kein Wörtchen über Miéville und seine heftige Auseinandersetzung mit Städten in der Phantastik (mit London in »King Rat« und »Un Lun Don« und jüngst mit zwiestädtischen In- & Nebeneinander in »The City & The City«). — Dass in der »Die Welt« womöglich über solche Einflüsse und Entwicklungen berichtet wird, wie sie die »World of Darkness«-Rollenspiele darstellen, erwarte ich ja schon gar nicht mehr.
Also dann: bis zum nächsten Versuch, was rundum gescheites über Fantasy zu schreiben.
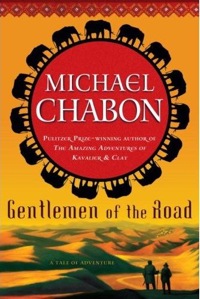 Um sich schnell zu orientieren, was »Gentlemen of the Road« bietet, reicht der Arbeitstitel (»Juden mit Schwerten«) und die vorangestellte Widmung (»Für Michael Moorcock«). — Juden mit Schwerter deshalb, weil der Roman etwa 950 n.d.Z. im Reich der zum Judentum konvertierten Chasaren, an der Westküste des Kaspischen Meeres, angesiedelt ist. Die Chasaren, ursprünglich ein nomadisch/halbnomadisches Turkvolk, hatten für einige Jahrhunderte eines dieser aus den Nebeln der Geschichte kommendes und wieder verschwindendes Königreich. Wenig ist bekannt. Sie kloppten sich mit den Arabern, pflegte ganz gute Beziehungen mit Byzanz, etwas heiklere Beziehungen mit den Rus von Novgorod und profitierten vom Vielvölkergewusel der Seidenstraße. Im 8. oder 9. Jahrhundert nahm die adelige Elite die jüdische Religion an (ob das Volk auch wechselte ist umstritten) und kannte eine Kaiser-(Bek) und Papst-(Khagan)artige Trennung von weltlicher und geistlicher Autorität. — Wie die Faust aufs Aug passt es, dass Chabon diesen Roman Michael Moorcock widmete. Ist doch Moorcock ein Großmeister der Schwert & Magie-Fantasy (egal, ob diese nun in magischen Zweitweltschöpfungen angesiedelt ist, oder in abenteuerlich aufgebrezelten historischen Epochen). Allein schon die beiden Helden von Chabon gemahnen an das Vorbild: da ist einmal der (schwarze), bärengroße, geselligere Amram aus Abyssinien, der eine runengeschmückte, langstielige Wikingeraxt genauso kunstvoll führt, wie die Figuren des Schatrandsch-Bretts (einem Vorläufer des heutigen Schach); und zweitens der hagere, bleiche Zelikman, letzter Überlebender einer bei einem Progrom getöteten jüdischen Arztfamilie aus dem (dunklen, nebligen, kalten, waldreichen und unkomfortablen) fränkischen Reich, der mit einer Aderlassklinge (sozusagen als Rapier-Vorläufer) ficht, mit seinen Pharmakas Heilung, Betäubung und Tod herbeizaubern kann und zwischen der Äktschn düster brütend an seiner Bhang(=Hasch)-Pfeiffe zuzelt.
Um sich schnell zu orientieren, was »Gentlemen of the Road« bietet, reicht der Arbeitstitel (»Juden mit Schwerten«) und die vorangestellte Widmung (»Für Michael Moorcock«). — Juden mit Schwerter deshalb, weil der Roman etwa 950 n.d.Z. im Reich der zum Judentum konvertierten Chasaren, an der Westküste des Kaspischen Meeres, angesiedelt ist. Die Chasaren, ursprünglich ein nomadisch/halbnomadisches Turkvolk, hatten für einige Jahrhunderte eines dieser aus den Nebeln der Geschichte kommendes und wieder verschwindendes Königreich. Wenig ist bekannt. Sie kloppten sich mit den Arabern, pflegte ganz gute Beziehungen mit Byzanz, etwas heiklere Beziehungen mit den Rus von Novgorod und profitierten vom Vielvölkergewusel der Seidenstraße. Im 8. oder 9. Jahrhundert nahm die adelige Elite die jüdische Religion an (ob das Volk auch wechselte ist umstritten) und kannte eine Kaiser-(Bek) und Papst-(Khagan)artige Trennung von weltlicher und geistlicher Autorität. — Wie die Faust aufs Aug passt es, dass Chabon diesen Roman Michael Moorcock widmete. Ist doch Moorcock ein Großmeister der Schwert & Magie-Fantasy (egal, ob diese nun in magischen Zweitweltschöpfungen angesiedelt ist, oder in abenteuerlich aufgebrezelten historischen Epochen). Allein schon die beiden Helden von Chabon gemahnen an das Vorbild: da ist einmal der (schwarze), bärengroße, geselligere Amram aus Abyssinien, der eine runengeschmückte, langstielige Wikingeraxt genauso kunstvoll führt, wie die Figuren des Schatrandsch-Bretts (einem Vorläufer des heutigen Schach); und zweitens der hagere, bleiche Zelikman, letzter Überlebender einer bei einem Progrom getöteten jüdischen Arztfamilie aus dem (dunklen, nebligen, kalten, waldreichen und unkomfortablen) fränkischen Reich, der mit einer Aderlassklinge (sozusagen als Rapier-Vorläufer) ficht, mit seinen Pharmakas Heilung, Betäubung und Tod herbeizaubern kann und zwischen der Äktschn düster brütend an seiner Bhang(=Hasch)-Pfeiffe zuzelt.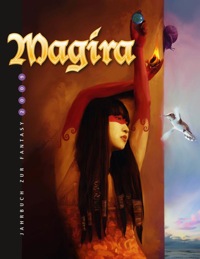

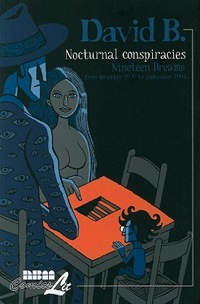
 Eintrag No. 577 — Habe ich diese Woche als Diogenes-Taschenbuch aus dem Ramsch gefischt. 1874 erschien die endgültige Fassung dieses vision- und trugbildgesättigten Drama-Romans, an dem Flaubert etwa 40 Jahre gebosselt hat, und den er selbst als Höhepunkt seines Schaffens betrachtete. — Wegen seines (wie Thomas Mann meint) »polyhistorischen Nihilismus« erregte das Buch einiges Aufsehen und den Groll der bürgerlichen Kritik, denn (wiederum Mann) er ist »nicht nur ein phantastischer Katalog aller menschlichen Dummehiten {…} auch der Irrsinn der religiösen Welt wird lückenlos vorgeführt«.
Eintrag No. 577 — Habe ich diese Woche als Diogenes-Taschenbuch aus dem Ramsch gefischt. 1874 erschien die endgültige Fassung dieses vision- und trugbildgesättigten Drama-Romans, an dem Flaubert etwa 40 Jahre gebosselt hat, und den er selbst als Höhepunkt seines Schaffens betrachtete. — Wegen seines (wie Thomas Mann meint) »polyhistorischen Nihilismus« erregte das Buch einiges Aufsehen und den Groll der bürgerlichen Kritik, denn (wiederum Mann) er ist »nicht nur ein phantastischer Katalog aller menschlichen Dummehiten {…} auch der Irrsinn der religiösen Welt wird lückenlos vorgeführt«.


