Archiv: #7Tage7Cover/#7Days7Cover
Neuer »molochronik reloaded«-Eintrag mit den gesammelten Tweets zur #7Tage7Cover/#7Days7Cover-Twitter-Challenge.
Neuer »molochronik reloaded«-Eintrag mit den gesammelten Tweets zur #7Tage7Cover/#7Days7Cover-Twitter-Challenge.
•••
Andrea Diener — bekannt als Kommentatorin des Bachmann-Wettlesens, Reisenotizen-Bloggerin, eine der vernünftigen Stimmen bei der FAZ, und als WRINT-Weltenbummlerin — hat nach einigen arbeitsreichen Jahren nun wohl wieder mehr Zeit für sich, und also ein eigenes ›Spaßprojekt‹ begonnen: »Tsundoku«, ein Bücherpodcast. Neuste Folge ist am Sonntag online gegangen — »TSU005: Zen und Zebrafische«.
Ich empfehle auch schwer die beiden Folgen, in denen Andrea Gäste empfängt: einmal »TSU002: Smartphone vs. Distelfink«, wenn sie mit Hanna Lühmann, und dann »TSU004: Ein bisschen wie wachträumen«, wenn sie mit Julia Bähr über Literatur babbelt. Ich beobachte wohlig, wie sich ein kleines Thema einschleicht (bzw. halt zufällig so ergibt): lobende Erwähnung von Phantastik-Literatur (für Leute, die eigentlich keine Phantastik mögen) zum Ende der Sendung (einmal Michael Ende, dann »Die Frau des Zeitreisenden« von Audrey Niffenegger).
•••
»Renegade Cut« (Englisch) von Leon Thomas ist eines meiner liebsten Video-Bloggs. Mai war bei ihm Kubrik-Monat und er hat feine, kleine Besprechungen zu »2001 — A Space Odyssey«, »Dr. Strangelove«, »Eyes Wide Shut« und »The Shining« zusammengestellt.
Nicht verpassen sollte man seine vierteilige Analyse von »A Clockwork Orange« Teil Eins, Zwei, Drei, Vier.
•••
Wie gerufen, auasi als kleiner Nachklapp zu meiner ausführlichen Empfehlung des brillanten Comics »The Thrilling Adventures of Lovelace & Babbage«, kommt dieser Auftritt der Schöpferin Sydney Padua bei »Talks at Google«:
•••
Meine lebende Lieblings-Feministin (und Unruhestifterin, Kulturkritikerin) Laurie Penny (von der ich einen Text ihrer Begegnung mit dem späten Terry Pratchett übersetzt habe »Sex, Tod und Natur«; und ich empfehle nachdrücklich ihre Streitschriften »Fleischmarkt« und »Unsagbare Dinge«), hat einen dringend nötigen Text für ›The New Statesman‹ (Englisch) geschrieben: »What’s wrong with political correctness?«.
•••
Seit ewig und drei Tagen wird wurde das italienische Autorenkollektiv Wu Ming (ehemals Luther Blissett) bei uns von den Verlagen ignoriert, obwohl ihr Debütroman »Q« als Taschenbuch bei Piper vielfache Neuauflagen erfahren hat. Es freut mich, dass nun mit ›Assoziation A‹ ein kleiner Verlag endlich die Eier hat, diesem Ignoranz-Übel entgegen zu wirken und nun die vorzüglichen Werke von Wu Ming auf Deutsch veröffentlicht. Es geht los mit »54«, einem wüsten Mix aus Thriller, Spionage- & Mafia-Farce, wenn Cary Grant, Tito, Heroinschmuggler und Partisanenschicksale aufeinandertreffen.
Thekla Dannenberg hat eine schöne Empfehlung für die Krimi-Kolumne ›Mord und Ratschlag‹ des ›Perlentauchers‹ geschrieben: »Keine Moral ohne Eleganz«.
Zur leicht überarbeiteten Fassung der Besprechung in meinem neuen Blog ›molochronik reloaded‹.
Der geschätzte Übersetzer-Kollege Markus Mäurer fragt in seinem Blog ›TranslateOrDie‹ für einen kommenden Artikel für ›Phantastisch‹, wie es mit dem Leseverhalten bezüglich deutsch- & englischsprachiger Titel auf dem Gebiet der Fantasy & Science-Fiction aussieht.
Hier meine Antworten.
Habe vor einigen Tagen spät Nachts noch die weitergeleitete Frage einer Leserin beantwortet, warum ich an einer bestimmten Stelle meiner Übersetzung von Ted Chiangs Story »Geschichte Deines Lebens« aus dem Band »Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes« der Begriff ›Groschen‹ und nicht ›Cent‹ verwendet habe. — Überraschenderweise waren Golkonda-Herausgeber Hannes & Karlheinz von meiner Antwort so erfreut, dass sie als Newsblog-Eintrag auf der Verlagsseite verbreitet wurde.
Antwort auf die Frage einer Leserin: »Warum ›Groschen‹ & nicht ›Cent‹?« t.co #Golkonda #Übersetzung #TedChiang
— molosovsky (@molosovsky) April 16, 2014Ich will meine Antwort den MoloChronik-Lesern nicht vorenthalten und biete sie also auch in meiner mir eigenen Textformatierung hier an:
•••••
Frage: Warum wird ›Groschen‹ verwendet und nicht ›Cent‹? (Seite 43, Zeile 16 in »Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes«)
 Antwort: Gerehrte Fragestellerin.
Antwort: Gerehrte Fragestellerin.
GOtt sei Dank eine Frage nach einer Übersetzung-Detail-Entscheidung, die ich beantworten kann. (Es ist nämlich keineswegs so, dass ich jede einzelne Übersetzungs-Entscheidung, die auf meinem Mist gewachsen ist, im Nachhinein selbst noch nachvollziehen könnte.)
Warum an der genannten Stelle ›Groschen‹ und nicht ›Cent‹?
Kurze Antwort: Weil im Original eben nicht ›cent‹ steht, sondern ›one slim dime‹.
Aber: ›one slim dime‹ hieße wortwörtlich eigentlich in etwa ›ein mickriges / lausiges Zehn-Cent-Stück‹. Im deutschsprachigen Raum gab es in Österreich vor der Einführung des Euro noch Groschen; in der BRD (in der ich groß geworden bin) war umgangssprachlich damit ein 10-Pfennig-Stück gemeint. Trotzdem nicht ganz das Gleiche wie ein amerikanisches 10-Cent-Stück.
Also längere Antwort: Wichtiger als das wörtliche Übersetzen einzelner Ausdrücke an und für sich ist bei einer Übersetzung von Prosa, Erzählungen, Romanen (zumindest meiner Ansicht nach), die Stimmung, den Rhythmus, den Erzählton zu treffen und möglichst viele der kulturellen, sozialen, zwischenmenschlichen, psychologischen etc. Anspielungen, Anklänge in die deutsche Fassung rüberzuholen, wie nur geht.
Die Stelle im Original:
Wesentlich scheint mir hier, dass Gary — etwas albern, aber das macht ihn ja liebenswert — ein kleines Rollenspiel beginnt, absichtlich ironisch dramatisiert (um die Spannung zu mildern, sich gleich einer ganz großen, nicht nur wissenschaftlichen, neuen Sache gegenüber wieder zu finden) und sich des altertümlichen Sprachgehabes eines Jahrmarktschreiers bedient. DAS rüberzubringen lag mir am Herzen, und dass die Erzählerin mit ihrer eher beiläufigen, zurückhaltenden Art dennoch bei diesem Rollenspiel mitmacht, indem sie umgangssprachlich (›one slim dime‹) antwortet.
Deshalb also in der deutschen Fassung:
Trotzdem, so könnte man beharren, ist ›one slim dime‹ eben eigentlich ›ein Groschen‹, ja ganz genau eben ›ein 10-Pfennig-Stück‹. Aber wie klingt das als Satz?
Letztendlich entscheide ich mich oftmals, was besser klingt, solange es im Grunde eher mehr als weniger inhaltlich stimmt. Buchstäbliche Bedeutung ist eben nicht alles beim Übersetzen.
Ich hoffe, diese Antwort ist hilfreich.
Herzliche Grüße Alexander Müller / molosovsky
Damien Walter is a ›Twitter buddy‹ of mine, Scottish author of reviews and essays, buddhist agent provocateur against all dumb mainstream notions, jester, mocker & critic at the court of the fantastic genres.
In short: check out his website and follow his columns for »The Guardian«.
Today he shared his love for Herrmann Hesse — an author whose achievments I can respect, but I personally quite despise his writings, especially his prose style — but instead of scoffing about Damiens fondness for Hesse, I replied by hinting at a curious quote from Hesse about Edgar Allan Poe.
@damiengwalter He wrote one of my favorite quotes about the death of fantastica ≈ »The hype about Poe & Co will be gone in a few years.«
— molosovsky (@molosovsky) 6. April 2014So here is my quick translation vom German to English of the mentioned quote of Herrmann Hesse (In »Gesammelte Werke Band 12; Schriften zur Literatur II«, Werkausgabe edition Suhrkamp; Hrsg. von Volker Michels, Frankfurt 1970; Seite 283):
The german literature of our days is full of »fantastical« fictions, from which only that of Meyring have a certain depth. The father of this genre, Poe, remains unmatched. Poe, the lonely, impoverished american journalist truly was a marked man, a Cain with the sign of a genius. The whole literature of horror & the fantastic following after Poe will be gone swiftly. Poe may be Americas greatest poet even above Whitman.
»A History of Literature in Reviews and Essays«, 1922

•••••
Willkommen bei meinem Jahresrückblick zu den edelsten Zeitverschwendungen, der explosivsten Unterhaltungsmunition, lindernsten Seelenmedizin & potentesten Bewusstseinshanteln des Jahres 2013.
Überflüssig zu erwähnen – aber sicherheitshalber hier noch extra betont –, dass dies meine persönlichen Favoriten des Jahres 2013 sind, & ich deshalb mit GOttgleicher Objektivität alle anderen Bestenlisten zunichte mache. Wenn Eure Lieblinge hier nicht aufgeführt werden, könnt Ihr ja zur Abhilfe Haare raufen & mit den Zähnen klappern. Vielleicht bringts ja was.
Titel, die ich nicht gesehen, gelesen, gehört oder gespielt habe, bleiben natürlich aussen vor. Vor allem bei den Filmen & Games wurde ich vieler Sachen, die mich brennend interessiert hätten, 2013 noch nicht habhaft (ganz besonders bitter beklage ich, dass der neuste in Deutschland anlaufende Ghibli-Zeichentrickfilm »Der Mohnblumenberg« in der ach so mondänen Metropole Frankfurt grad mal eine Woche in den Kinos war).
Die Sortierung folgt diesmal dem Alphabet (nach Autorennachnamen oder Titel), die Reihenfolge stellt also in sich keine Wertung dar (besondere Hervorhebungen wurden in die Kurzbeschreibung integriert).
•••••
Zum ersten Mal die Sparte ›Games‹ & hier kommt die alphabetische Sortierung voll sinnvoll zum Zug, denn mich bei diesen Titel entscheiden zu müssen, welches nun die anderen überragt, ist mir unmöglich. Alle Gold!
•••••
von Laurie Penny
12. November 2012: Terry Pratchett nutzt seit über 40 Jahren Science Fiction und Fantasy, um feinsinnige Satiren zu schaffen. Doch der Beginn einer Alzheimer-Erkrankung zwang ihn, sich mit einer unbequemen Frage auseinanderzusetzen – was wird geschehen, wenn er nicht mehr in der Lage sein wird zu schreiben?
Ich sitze in einem Kaffeehaus an der Hauptstraße von Sailsbury und ein gebrechlicher, alter Mann mit großem schwarzem Hut erzählt mir gerade, dass er sterben wird. »Keine Medizin kann das verhindern«, sagt Sir Terry Pratchett, 64, Nationalheiligtum, Autor von bisher 54 Büchern, Fürsprecher der Sterbehilfe und berufsmäßiger morbider Drecksack. »Zu wissen, dass man sterben wird, ist der erste Schritt zur Weisheit, nehme ich mal an«, erklärt er.
Diese Geschichte handelt vom Tod. Damit ist nicht der personifizierte Tod gemeint, dieser knöchrige, auf unbeschreibliche Weise stets grinsende Kerl mit der Sense, den funkelnden blauen Augen, der flucht und immer lieb zu Katzen ist und in fast jedem der über 30 Romane zählenden Scheibenwelt-Reihe von Pratchett einen Auftritt hat. Diese Geschichte handelt von der unangenehmen kleinen Tatsache des Todes, dieser sich auf Leben und Werk Pratchetts auswirkenden ›Widrigkeit‹, seit der Autor 2007 mit posteriorer kortikaler Atrophie, einer seltenen Form frühmanifestem Alzheimers, diagnostiziert wurde.
Vor 45 Jahren begann Pratchetts Schriftstellerlaufbahn. Mit über 80 Millionen weltweit verkaufter Bücher ist er Großbritanniens zweiterfolgreichster Autor. »Die Farben der Magie« (»The Colour of Magic«), sein erstes Buch der Scheibenwelt-Reihe, erschien 1983 noch als lupenreiner Vertreter der komischen Fantasy. Der Roman beschreibt den unscheinbaren Zauberer Rincewind der über die Scheibenwelt hetzt, die auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte durch das Weltall getragen wird. Die nachfolgenden Bücher entwickelten sich zu etwas Komplexerem, das mehr Tiefe an den Tag legte. Im Laufe der Reihe fanden die Romane zu einer prägnanten, beissend satirischen Stimme. Die meisten erfolgreichen Science Fiction- und Fantasy-Autoren müssen früher oder später ihre eigene Politik ins Auge fassen, denn es geht eine gewisse moralische Verantwortung damit einher, Millionen von Lesern zu einem aus dem Nichts geschaffenen Universum einzuladen. Schriftsteller wie Ursula K. Le Guin, Robert Heinlein und China Miéville nutzten ihre fantastischen Werke ausdrücklich als Spielwiese für politische Thesen, indem sie ausgedachte Welten beschreiben, die alternative Entwicklungsmöglichkeiten der Menschheit vorstellen.
Pratchett hat den entgegensetzten Weg eingeschlagen. Er begann mehr wie jemand zu schreiben, der weiß, dass der faszinierendste Ort im bekannten und vorstellbaren Universum das Hier und Jetzt ist. Er nutzt nerdige Fantasy und Situationskomik als Mittel, um Geschichten über Rassismus und religiösen Hass, Krieg und Bigotterie, Liebe und Sünde und Sex und Tod, immer wieder über den Tod zu erzählen, eingebettet in Ersatz-Abenteuer von sprechenden Hunden, Zombie-Revolutionären, Werwölfen die Verbrechen bekämpfen, Zahnfeen, Krokodilgöttern und ulkigen kleinen Typen, die nicht ganz geheuere Würstchen an der Straßenecke feil bieten.
Um so seltsamer seine Bücher wurden, um so mehr glich ihr Klang und ihre visuelle Szenerie dem Großbritannien des späten zwanzigsten und frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts: Mann trifft auf Frau trifft auf Geschlechterrollen herausfordernden Zwerg; anständige Leute werden durch ihre eigene Feigheit in den Untergang getrieben; Priester verbreiten Lügen und blutsaugende Anwälte ziehen bei allem die Strippen, wobei allerdings auf der Scheibenwelt Anwälte tatsächlich Vampire sind.
»Terry verfügt einfach über ein großes Können beim Beschreiben von Menschen«, sagt Neil Gaiman, Mitautor und enger Freund von Pratchett. Gemeinsam haben die beiden 1990 den Bestseller »Ein gutes Omen« (»Good Omens«) verfasst. »Er hat ein gutes Händchen, wenn es um unverfälschte, menschliche Gefühle geht, und reiht sich damit hervorragend in die Tradition humoristischer englischer Literatur ein.«
»Man kann seine Sachen mit den klassischen Werken von P. G. Wodehouse oder Alan Coren vergleichen – diese Autoren haben den Stil der komischen Literatur geprägt – und Terry ist ein Meister auf diesem Feld. Außerdem beherrscht er sämtliche Sprachbilder einer Vielzahl verschiedener Genres und weiß, wie man sie einsetzt. Anfangs hat man Terry mit Douglas Adams verglichen, weil auch der über Dinge schrieb, die auf anderen Welten spielen, aber am meisten ähnelt er Wodehouse – allerdings ist Terrys Spannweite größer.«
Wie vielen Freunden von Pratchett fällt es Gaiman schwer, über dessen Krankheit zu reden, sogar so schwer, dass er sich uns über Skype anschließt, da ihm E-Mail zu kalt und karg ist. »Ich finde es großartig, dass Terry seinen Alzheimer verdammt noch mal zu seinem Verbündeten gemacht hat«, sagt Gaiman. »Ich liebe es, dass er seinen Alzheimer dazu nutzt, um die ›Dignity in Dying‹-Bewegung {Deutsch etwa: ›Sterben mit Würde‹ — AdÜ} bekannter zu machen.«
Alzheimer ist immer grausam, und die besondere Art, die man bei Pratchett diagnostizierte, zeichnet sich durch einen außerordentlich brutalen, ironischen Zug aus. Tastaturen kann Pratchett gar nicht mehr bedienen, und auch mit einem Stift weiß er nur noch wenig anzufangen. Seine letzten vier Bücher verfasste er vollständig als Diktate und mit der Hilfe von Rob Wilkins, der seit zwölf Jahren sein Assistent ist.
»Tippen kann ich gar nicht mehr, weshalb ich ›Talking Point‹ und ›Dragon Dictate‹ verwende«, sagt Pratchett, während Rob uns in einem überraschend großen, goldenen Jaguar zum Kaffeehaus fährt. »Das Programm wandelt gesprochene Rede in schriftlichen Text um«, erklärt er, »und es gibt eine Sprach-Ergänzung, die von einigen Leuten entwickelt wurde.«
Wie unterscheidet sich das nun davon, mit den eigenen Händen zu schreiben?
»Tatsächlich geht es so viel leichter«, sagt er. Ich zögere, und er bemerkt meine Skepsis.
»Überleg doch mal! Wir sind Affen«, sagt Pratchett. »Wir reden, und zwar ziemlich gern. Wir sind nicht auf die Welt gekommen um …«, er dreht sich zu mir und macht Klacker-di-klacker-Bewegungen, wie ein muffiger Opa, der das Internet für Quatsch hält, »… zu machen.« Für Technologie hegt Pratchett fürwahr so viel Leidenschaft, wie es sich für einen Fantasy-Schriftsteller gehört. Als sich vor einigen Jahrzehnten des Internet für Nicht-Spezialisten öffnete, blühten rasch Gemeinschaften wie ›alt.fan.pratchett‹ {seit 1992 — AdÜ} auf, in denen sich Leser treffen und Geschichten miteinander teilen konnten. »Du musst natürlich schon ein Stück weit ein Nerd sein, um damit zurecht zu kommen«, sagt er. Argwöhnisch beäugt er mich. »Wenn du kein Nerd bist, will ich gar nicht mir dir reden. Du hast doch sicherlich wenigstens schon mal das Gehäuse deines Computers aufgeschraubt, oder?«
Ich befürchte, dass das Interview gleich echt vorbei ist, wenn ich zugebe, mit einem Mac zu arbeiten und Angst davor habe, die Garantie einzubüßen. »Ist auch egal. Aber die Algorithmen sind faszinierend«, sagt er. »Ich habe denen alles zukommen lassen, was von meiner Schreiberei in elektronischer Form vorliegt, und die haben über Nacht alles durchgerührt und ausgeklügelt, wie meine Worte klingen würden und klingen sollten.«
»Wir basteln uns Hilfsmittel«, sagt Rob. »Die Computersysteme sind so eingerichtet, dass sie sich am Morgen, wenn der Wecker klingelt, von selbst einschalten. Terry muss dann also nicht mehr nach dem Einschaltknopf suchen.«
Der große Diktator
Pratchetts Assistent hantiert mit dem Mobiltelefon, und biegt ein zu dem Kaffeehaus, in dem wir unser Treffen abhalten wollen. Man kann sich von Terry nicht wirklich ein stimmiges Bild machen, ohne Rob Wilkins zu beachten, dessen Namen ich versehentlich als ›Wilikins‹ niederschreibe, ganz so wie ein treuer Butler mit verborgenen Charaktertiefen heißt, der in vielen Scheibenwelt-Romanen vorkommt.
Rob ist in vielerlei Hinsicht ein urtypischer Pratchett-Fan. Er hat ein großes Herz, ist bis zum Überfluss erfüllt von der nerdigen Energie der ersten Immigranten-Generation, die in das digitale Universum aufgebrochen ist, trägt ein schlecht sitzendes schwarzes T-Shirt und ist treu bis zum Geht-nicht-mehr. Wenn es einen Grund gibt, warum sich Pratchetts lähmende Krankheit nicht auf den Fortlauf seiner Neuerscheinungen ausgewirkt hat, heißt er Rob. Jederzeit, ob Tag oder Nacht, kommt er zu Terrys Wohnhaus, um ein Diktat entgegenzunehmen oder ein Problem zu lösen, und Terrys Ehefrau hat sich daran gewöhnt, dass das für die Schriftstellerei nötig ist.
»Es ist toll, wenn es uns gelingt, ein Hilfsmittel zu basteln, denn das bedeutet, dass wir ein Gefecht gegen die Krankheit gewonnen haben«, sagt er und eilt davon, um die Getränke zu bestellen. Beide sprechen im Plural, ›wir‹ und ›uns‹, über ihre Arbeit, entsprechend lautet der Twitter-Feed des Schriftstellers ›@terryandrob‹. Die beiden wirken, als wären sie seit Kindheitstagen befreundet. Sie plaudern über Alzheimer, als handle es sich dabei um ein ausgesprochen kniffliges Level eines Videospiels, das sie unbedingt meistern wollen. »Es dauert nicht mehr lange, und das Hilfs-System ist so weit, damit Terry einfach nur mit der Sprache das Licht einschalten, die Vorhänge öffnen und derartige Dinge erledigen kann«, sagt Rob. »Das ist ein großer Spaß. Jeden Tag werden wir damit einen Kampf gegen die Krankheit gewinnen.« Er nickt. »So was machen wir gern.«
Während Pratchetts Auftreten ruppig und pragmatisch wirkt, ist Rob ein überschwänglicher Charakter, von der Sorte, der einen Journalisten den er gerade zum ersten Mal begegnet herzlich umarmt, wenn sich dieser auch als Fan zu erkennen gibt. In der von Pratchett präsentierten, mit einem BAFTA ausgezeichneten BBC-Dokumentation »Choosing to Die« {Deutsch etwa: »Den Tod wählen« — AdÜ} über die Arbeit der schweizerischen Vereins ›Dignitas‹, gibt sich der Autor kurz angebunden und ernst, während er zwei tödlich erkrankte Männern begleitet, die ihrem Leben freiwillig ein Ende setzten. Rob ist derjenige, der sich darüber aufregt, wie unfair das alles ist.
Seit er diagnostiziert wurde, hat sich Pratchett zu einem Aktivisten für würdevolles Sterben entwickelt. Er widmet alle Kraft die er aufbringen kann, um Vorträge zu halten und Programme zu gestalten, und will damit helfen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die derzeitige Lage zu schärfen. »Das Problem besteht darin, dass die Menschen heutzutage glauben, nicht mehr sterben zu müssen«, sagt er. »Frühere Generationen hatten noch ein Verständnis vom Tod, denn sie haben selbst eine gesunde Portion Tod erlebt. Noch in der viktorianischen Zeit war es gut möglich, dass man die Beerdigung vieler Geschwister erlebte, ehe man selbst ein fortgeschrittenes Alter erreichte.«
»Heute aber wissen die Leute nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollen, wenn sie zu einem Begräbnis gehen. In die Kirche gehen die meisten sowieso nicht mehr – dazu sind sie zu vernünftig –, aber bei einer Beerdigung weiß keiner mehr, was man singen soll, wann man sich erhebt, oder wo man sich hinstellt.«
Rituale sind in Pratchetts Welt etwas sehr Wichtiges. Er gehört nicht zu den Autoren, die jemals abgelehnt hätten, zum Ritter geschlagen zu werden. Stattdessen hat sich Pratchett eigens ein Schwert aus Meteoritenstahl schmieden lassen, denn wenn man schon in den Ritterstand erhoben wird, so dachte er sich, dann auch richtig.
Der Junge vom Land
Terry Pratchett wuchs in den Fünfzigern als Einzelkind in Buckinghamshire und Somerset auf. Lieder und Geschichten waren Teil seiner provinziellen Erziehung – Geschichten über Außerirdische und Reisen ins Weltall standen Seite an Seite mit Erzählungen über die anrüchigen Machenschaften holder Jungfrauen und ihrer Verehrer.
»Zur Science Fiction bin ich ja gekommen, weil ich mich ursprünglich für Astronomie interessiert habe«, sagt er. »Meine Mutter erzählte mir auf dem Weg zu Schule immer Geschichten. Sie begleitete mich den ganzen Weg über zweieinhalb Kilometer und ging dann weiter zur Arbeit.«
»Ich war ein Kind der Sozialwohnungen. Das Haus, in das ich hineingeboren wurde, hätte schon jemand der Stempeln ging nicht mehr betreten. In der Provinz arm zu sein bedeutet, dass man wirklich sehr arm ist. Mein Vater fing ab und zu einen Hasen, sammelte Pilze und Ähnliches, und konnte nur deshalb ein Auto durchbringen, weil er ein guter Mechaniker war.«
»Sie hatten keinen Schimmer, was für unglaublich gute Eltern sie waren. Ich selbst habe es nicht begriffen, bis ich erwachsen wurde. Eltern, die ihre Kinder vor der Glotze parken und sich selbst überlassen, sollte man die Rübe wegpusten.« Er gönnt sich das Privileg des in die Jahre gekommenen Brummbären, jedem einen knackigen Tod zu wünschen, oder, wenn man nicht seiner Meinung ist, einen frühen.
Vor über vierzig Jahren, als er begann Romane zu schreiben, waren Pratchett und seine Frau Lyn »Hippies, aber Hippies mit Jobs«, sagt er. »Ich trug einen Bart, in dem hätte sich Darwin verlaufen können, aber ich verdiente mein Geld als Korrektor einer Zeitung. In unserem kleinen Häuschen war gerade mal genug Platz für ein Kind. Rhianna ist ein Einzelkind, was vielleicht auch ganz gut so ist. Als Einzelkind gehst du entweder unter, oder du entwickelst dich zu einem Kämpfer. Rhianna ist eine Kämpferin.«
Rhianna Pratchett hat sich selbst bereits zu einer angesehenen Spiele-Autorin entwickelt. Kürzlich wurde bekannt, dass sie der kreative Kopf des Franchise-Neustarts von Lara Croft {»Tomb Raiber«, 2013 — AdÜ} ist, und sie wird als Co-Autorin die BBC Schreibenwelt-Serie »The Watch« betreuen, weshalb Fans wie ich sich vor Vorfreude bereits die Backe zerkauen. Meine wird wohl nie mehr ganz verheilen, nachdem ich eine ganz besonders aufregende Rollenbesetzung erfahren habe, über die ich absolut nichts sagen darf.
Unter der Leitung von Pratchetts neuer Produktionsgesellschaft ›Narrativia‹ wird »The Watch« die beliebte Saga der Stadtwache aus der Scheibenwelt dort fortsetzen, wo die Bücher aufhören, und Rhianna ist ein wichtiges Mitglied des Autorenstabes. Der Schriftsteller erzählt mir, wie zufrieden er ist, dass Rhianna die Scheibenwelt-Reihe fortschreiben wird, wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist. »Die Scheibenwelt ist bei meiner Tochter in guten Händen«, versichert mir Pratchett.
Rhianna ist umgeben von der Scheibenwelt ihres Vaters aufgewachsen und kennt sie in- und auswendig. Als ich ihm so zuhöre, wie er über seine Tochter spricht, merke ich, dass er zum ersten Mal die Möglichkeit anerkennt, irgendwann nicht mehr schreiben zu können.
»Das Großartigste an Terry, was mich an ihm meisten fasziniert, ist, wie sehr er das Schreiben liebt«, sagt Neil Gaiman. »Das ist nicht bei jedem Schriftsteller so – wir sind da verteilt über die ganze Bandbreite zwischen den Extremen. Aus Douglas Adams musste man die Romane herausquetschen wie den letzten Rest aus einer leeren Zahnpastatube. Und dann gibt es einen wie Terry, der lieber schreibt als sonst irgendwas zu machen. Seit ich ihn kenne – ich begegnete ihm, als er noch als Pressesprecher bei CEGB angestellt war –, hat er jede Nacht nach der Arbeit zuhause seine vierhundert Worte verfasst.«
Derzeit erscheinen noch Bücher von ihm in rascher Folge, wenn auch querbeet – als ob er Projekte abschließen wolle, bevor es zu spät ist. Nun erscheinen Geschichten, die lange in der Warteschleife kreisten. Im letzten Sommer {2012} kam »Die lange Erde« (»The Long Earth«) auf den Markt, ein in der nahen Zukunft angesiedeltes Hard-SF-Epos über Alternativwelten und Ressourcenverteilung. In diesem Winter {2012} erscheint »Dunkle Halunken« (»Dodger«), eine historisch-fantastische Geschichte aus dem viktorianischen London, in der Charles Dickens, Henry Mayhew und eine Handvoll Figuren aus den Werken von Dickens auf widerliche Weise zum Leben erweckt werden. Obwohl das Marketing sich an jungendliche Leser richtet, wurden die Geschichten mit ihren Verteilungskämpfen, den menschlichen Grausamkeiten und den in Kloaken-Strömen treibenden Leichen immer düsterer.
»Was soll man Kindern erzählen?«, fragt Pratchett, als wir noch im Kaffeehaus sind. »›Mach dich auf ein kurzes Leben gefasst‹«, sagt er und nimmt einen Schluck Tee. »Es läuft darauf hinaus, dass wir uns gegenseitig wegen der Rohstoffe die Schädel einschlagen werden, und die meisten Rohstoffe dafür verschwenden uns zu bekämpfen.«
»Neulich war ich in Indonesien, wo man Palmöl-Plantagen besichtigen kann. Wir sind mit dem Hubschrauber geflogen und die Plantagen erstrecken sich über den ganzen Horizont. Ist das Palmöl erstmal abgeerntet, bleibt nur Wüste zurück – und ich meine richtige Wüste: steiniger Boden, auf dem nichts mehr gedeiht. Schlamassel dieser Art werden wir mit unserem Leben bezahlen.«
Und in diesem Augenblick fängt er an zu singen, was ich nicht im übertragenen Sinne meine. Ruhig und deutlich beginnt er das alte englische Volkslied »The Larks They Sang Melodious« {Deutsch etwa: »Melodisch sangen die Lerchen« — AdÜ} anzustimmen. Er hat eine schöne Stimme. Sein zitternder Bariton hat nichts von seiner Kraft eingebüßt und es ist Terry piep egal, dass er die Aufmerksamkeit des halben Kaffeehauses auf sich zieht.
Zwei ganze Strophen singt Pratchett. Das Lied ist erfüllt von Feuerschein und Sehnsucht und Nostalgie nach wärmeren, jüngeren Tagen. Wenn man mit halbgeschlossenen Augen zuhört, kann man sich vorstellen, am Lagerfeuer einem älteren Verwandten zu lauschen, der von Liebe und Tod erzählt, keineswegs unwahrhaft, auch wenn einiges ein wenig ausgeschmückt worden sein mag. Wir sitzen aber nicht am Lagerfeuer, sondern in einer Starbucks-Filiale, trinken etwas schalen Tee, und »The Larks They Sang Melodious« wurde nicht geschrieben, um zu brasilianischen Dudel-Jazz gesungen zu werden.
»Alles rückt näher zusammen, wenn man gemeinsam singt«, sagt er. »Ich kenne die Lieder, die mein Großvater und mein Vater gesungen haben. Und Rhianna kennt die Lieder, die ich gesungen habe, denn heutzutage kann man fast alle Lieder, die jemals komponiert wurden, irgendwo bekommen.«
Er ist ein glühender Fan traditioneller Musik und berichtet stolz: »Maddy Prior hat mich mal geküsst. Nein, nein, du bekommst keinen Ärger, wenn du das aufschreibst«, sagt er und fragt: »Hast du je von Thomas Tallis gehört?« Ohne meine Antwort abzuwarten, fährt er fort: »Letztens bin ich durch meine Küche spaziert, das Radio war an und es lief gerade »Spem in alium« und ich sank nieder auf die Knie. Echt. Dabei ist es mir völlig schnurz, ob jemand in die Kirche geht.«
Ich erwähne nicht, dass nun alle Welt die Harmonien von Tallis und seine vierzigstimmige Motette kennt, weil sie in dem Bums-Bestseller »Fifty Shades of Grey« erwähnt werden.
»In dem Lied das ich gerade gesungen habe, dreht sich natürlich eigentlich alles um Sex«, sagt er grinsend.
Ist dies das Ende?
Sex und Tod und die blutroten Klauen und Fangzähne der Natur. Humor, der so schwarz ist wie der Hut eines Fantasy-Schriftstellers. Unangenehme menschliche Wahrheiten auf den Tisch knallen und ein klein wenig Feenstaub darüber streuen. Das war von Anfang an der Kern des Schaffens von Pratchett. Die garstigen Sachen mit Musik und Magie garnieren, um sie erträglicher zu machen, jedoch ohne dabei die Kinder auch nur eine Sekunde lang zu belügen. Die Kampagne für Sterbehilfe ist lediglich der folgerichtige, praktische Abschluss dieser Haltung.
»Lass uns von Harold Shipman reden«, sagt er, und ich weiß, dass Pratchett mich auf den Arm nehmen will. Ich bin nicht die erste, der die verblüffende Ähnlichkeit – struppiger, weißer Bart und scharfe Gesichtszüge – zwischen dem Fantasy-Autoren und Harold Shipman auffällt, der auch als ›Dr. Tod‹ bekannt ist. Der Hausarzt hat sich 2004 erhängt, nachdem heraus kam, dass er unzählige Patienten in ihren Betten umgebracht hat.
»Was Shipman getan hat war schrecklich. Alle anderen Ärzte haben wegen ihm ihren Mumm eingebüßt. Jetzt müssen alle Ärzte auf Biegen und Brechen jeden armen Kerl am Leben erhalten, egal wie sehr er leidet. Aber der Unterschied besteht darin, dass Shipman Leute umgebracht hat, die nicht krank waren!« Sich mit einem Mann, der höchstwahrscheinlich dem Tod näher ist als man selbst, über den Tod zu unterhalten ist ziemlich unangenehm, vor allem wenn man beginnt über die Feinheiten der Krankheit zu reden, die ihn auf die eine oder andere Weise ums Leben bringen wird. Doch Pratchetts ruppige ›so ist das nun mal‹-Haltung macht das Ganze erträglicher, in etwa so, wie wenn man ein Pflaster mit einem schnellen Ruck entfernt.
Ich fange an zu fragen: »Haben dir die Ärzte schon gesagt – ich meine –«, er unterbricht mich, noch ehe ich den Knoten in meiner Zunge lösen kann. »Ob mir die Ärzte schon mitgeteilt haben, wann ich sterben werde?« Auf einmal vermute ich, dass er in den letzten Monaten schon öfters unangenehme Sätze für Verwandte und Journalisten ergänzen musste.
Nein, bisher gibt es noch keinen absehbaren Zeitpunkt. »Wer nicht weiß, dass ich so eine Krankheit habe, würde es gar nicht bemerken«, sagt er leise. Das stimmt nicht ganz: Pratchett ist blitzgescheit, und in seiner Gegenwart möchte man sich am liebsten vergewissern, schön gerade zu sitzen und ob man seine Schnürsenkel auch ordentlich gebunden hat. Dennoch wirkt er zerbrechlicher als man von jemanden der 64 Jahre alt ist glauben möchte, und manchmal driftet er am Ende eines Satzes ab.
Und tatsächlich hat mich Rob, kurz bevor dieses Interview in Druck ging, kontaktiert, um zu berichten, dass Pratchett Anfang November {2012} in New York bei einer Buch-Tournee fast an etwas, was sie für einen Herzinfarkt hielten, gestorben ist. Die beiden waren nach einem Besuch von Ground Zero mit einem Taxi auf dem Rückweg zum Hotel, erzählt Rob: »Auf einmal ging es Pratchett sehr schlecht. Wir saßen auf der Rückbank des Taxis und ich merkte, dass er sehr angestrengt atmete.« Wenige Minuten darauf verlor Terry das Bewusstsein.
In einer schriftlichen Schilderung des Zwischenfalls, den er veröffentlichen möchte, meint Terry, sich nicht mehr an viel erinnern zu können, außer »dass ich mich elend fühlte, mir sehr kalt war, obwohl mir der Schweiß das Gesicht herablief. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren und bin scheinbar einfach weggedämmert. Rob fragte mich die ganze Zeit, ob es mir gut geht, und versicherte mir, dass die Fahrt nicht mehr lange dauern würde … bei allem, was dann geschah, muss ich mich auf Rob berufen.«
Was geschah, war, dass Pratchett zusammenbrach. »Ich musste mich auf den Rücksitz des Taxis knien und Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Finger in den Hals und all das. Er wäre fast gestorben.«
Schnell wurde der Autor in ein Krankenhaus gebracht, aber er erholte sich rasch wieder. Die Ärzte erklärten ihm, dass er Herzflimmern erlitten hatte, verursacht durch die kumulativen Wirkungen der verschiedenen Medikamente, die man ihm wegen seines hohen Blutdrucks verschrieben hat. Der hektische Tournee-Plan verschlimmerte die Sache. Jetzt spielt er den Vorfall herunter. »Ich habe mal gehört, dass Signier-Tourneen einen schneller ins Grab befördern als Drogen, Suff und wilde Weiber«, teilt er dem ›New Statesman‹ mit. »Nicht alles davon habe ich selbst ausprobiert.« Der Vorfall hat ihn dazu gebracht, zu erwägen, ob er es ruhiger angehen und mehr Zeit dem Schrieben und der Familie widmen sollte. Aber er genießt das Leben auf Achse zu sehr, um davon abzulassen.
Zuvor, bei unserem Treffen, habe ich Pratchett gefragt, wie sich seine gesundheitliche Verfassung auf seine Haltung zum Leben auswirkt.
»Es macht mich unglaublich wütend. Wut ist etwas Wunderbares. Sie hält dich auf Trapp. Ich bin wütend auf die Banker und auf die Regierung. Sie sind verdammt unnütze Ärsche. Ich weiß genau, was Oma Wetterwachs (eine nüchterne Hexe, die sich nichts bieten lässt und die in einigen Scheibenwelt-Romanen auftritt) zu David Cameron sagen würde. Sie würde ihn wegfegen mit den Worten: ›Mit dir kann ich nichts anfangen‹. (Solche wir er) machen nichts, außer Anwälten in den Hintern zu kriechen. Warum wird niemand aufgeknüpft?«
Alle Scheibenwelt-Bücher durchzieht eine gewisse Krassheit. Befürchtet er nicht, mit seinen Auseinandersetzungen über den Tod die Kinder zu verschrecken? Ganz und gar nicht. Wenn etwas Pratchetts Beiträge zum Genre der Bücher für junge Erwachsene in den Regalen der Buchhandlungen auszeichnet, dann seine Bereitschaft, die jungen Leser mit einigen der grauenvollen Tatsachen des menschlichen Daseins zu konfrontieren, mit all der albernen Ernsthaftigkeit die man von einem sterbenden Satiriker erwarten darf, dessen persönliches Wappen ein lateinisches Motto ziert, das auch in seinen Romanen auftaucht: »›Noli timere messorem‹ – fürchte nicht den Schnitter.«
{SPOILER!!!} In seinem neuestem Jugendbuch »Das Mitternachtskleid« {»I Shall Wear Midnight«} gibt es eine längere Szene, in der die junge Heldin zuerst den Selbstmord eines Mannes verhindern muss, der kurz zuvor seine unverheiratet schwangere, dreizehnjährige Tochter derart schlimm verprügelte, dass diese eine Fehlgeburt hatte – und dann beerdigt die Heldin den Fötus. {ENDE SPOILER} Nicht gerade Harry Potter. Und dennoch verschlingen die Kinder diese Bücher, denn zu den Dingen, die Pratchett begriffen hat, gehört, dass Kinder zwar gerne Geschichten lesen, es aber nicht mögen, wenn man sie belügt.
Es bereitet ihm keinerlei Sorgen, dass junge Leser möglicherweise ihren Lieblings-Autor im Fernsehen offenherzig über seinen eigenen Tod reden hören. »Kindern Angst zu machen ist eine edle Sache«, sagt er. »Ich erzähle Kindern mit Freuden, dass sie sich auf ein kurzes Leben einstellen sollen. Folgendes ist jedoch dabei wichtig: man darf Kinder durch den finsteren Wald führen, aber man muss sie dann auch wieder zum Licht lotsen.«
 So sehr ich dem Autor auf fast jeder Seite zustimme bei seiner Abrechnung mit dem degenerierten System der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, muss ich leider gestehen, dass sein Buch auf mich den Eindruck macht, kaum mehr als ein schneller Rundgang durch die vielfältigen empörenden Probleme der ›Nimmersatten‹ zu sein. Das kreide ich dem Autoren nicht an, sondern glaube, dass dies der Größe des Themas bei begrenztem Umfang des Buches (240 Seiten) geschuldet ist. — Anders gewendet: kompakter, gut zu lesender Überblick darüber, dass etwas schwer nicht stimmt bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
So sehr ich dem Autor auf fast jeder Seite zustimme bei seiner Abrechnung mit dem degenerierten System der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, muss ich leider gestehen, dass sein Buch auf mich den Eindruck macht, kaum mehr als ein schneller Rundgang durch die vielfältigen empörenden Probleme der ›Nimmersatten‹ zu sein. Das kreide ich dem Autoren nicht an, sondern glaube, dass dies der Größe des Themas bei begrenztem Umfang des Buches (240 Seiten) geschuldet ist. — Anders gewendet: kompakter, gut zu lesender Überblick darüber, dass etwas schwer nicht stimmt bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Es gibt nun mal so viel galoppierenden Schwachsinn bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass Siebenhaar auf kaum mehr eingehen kann, als die logistischen, finanziellen und politischen Missstände. Was leider weitestgehend fehlt, sind Wortmeldungen oder kritisches Abklopfen, wie bei ARD und ZDF Programminhalte und -entscheidungen versemmelt werden (und warum das Programm so schlecht ist; wie Drehbücher verpfuscht werden; warum Gemmen im Spätprogramm versauern).
Aber die Lektüre der Generalkritik lohnt sich, und zusammengedampft und um eigene Gedanken ergänzt klaube ich folgende Kernforderungen und Reformvorschlägen heraus:
Kleines Extralob gebührt Siebenhaars Augenmerk für die Lokalitäten, an denen sich Entscheider, Beweger und Schüttler der Öffentlich-Rechtlichen zum Plausch und Stelldichein verkehren, und was da so gereicht wird. Teure Hotels, Restaurants, Hinterzimmer, Sekt, edle Häppchen.
Gelesen als eBook. Vier von fünf zornesroten Goodreads-Sternchen.
ZUCKERL:
•••••
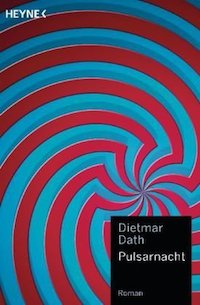 Dath ist ein Autor, den zu besprechen für mich sehr schwer ist.
Dath ist ein Autor, den zu besprechen für mich sehr schwer ist.
Einerseits: seine Sprache & seine Ideen bezaubern mich; ich finde toll, welche Probleme in seinen Romanen verhandelt werden; ich mag seinen Humor (auch wenn ich nicht immer sicher bin, ob ich den auch korrekt erkenne). — Andererseits: bei wenigen Autoren habe ich derart große Probleme was die Handlungsstruktur angeht; manche Abschnitte (vor allem ruhige, die Zwischenmenschliches schildern) gehen mir bald gehörig auf den Zeiger, obwohl sie für sich selbst genommen eigentlich sehr schön sind, aber innerhalb des Romangefüges wirkt dieses Raunen im Imax-Format, diese mit großem Ernst vorgetragenen ›poetisch-zwischenmenschlichen‹ Bemühungen, diese Handlungsstillstandzonen ohne entsprechend geschickt platzierte Aussichten, blöderweise wie sommerliches Auf-dem-Fleck-Wanderungen durch Weichkäsefelder.
Die eigentliche Schwierigkeit für mich einen Dath-Roman zu besprechen rührt aber daher, dass ich gegenüber diesem Autor einen ansehnlichen Minderwertigkeitskomplex schiebe, weshalb ich auch schnell zu der Annahme neige, dass ich schlicht zu doof bin, um wirklich was Gescheites zu seinen Büchern von mir geben zu können (egal, ob im Guten oder Schlechten). Aber trotzig hält mein Instinkt dagegen, dass Dath zwar ein brillanter Essayist, auch ein bewundernswerter Prosalyriker ist, aber als Erzähler vor lauter Programmatik und Hirn sich selbst dabei im Wege steht (oder ganz eigenwilliger Künschtler: stehen will), einfach nur ein wirklich souveräner Romanautor zu sein.
Der Plot, die Handlung von »Pulsarnacht« war für mich nur mäßig spannend. Es gibt viele Figuren die für mich kaum Profil entwickeln, da sie sich überwiegend alle sehr ähnlich sind. Die paar Figuren, die sich wunderbar als Protagonisten geeignet hätten, werden nach dem ersten von sechs Teilen zum Hintergrundensemble degradiert (absoluter Höhepunkt für mich: Weltraumsoldatin Saskia verbringt nach einem Einsatz einige Zeit mit Hardcore-Entspannung, also Saufen, Ficken, Schlägereien. Das kommt in Daths kräftiger, biegsamer und köstlicher Sprache so doll rüber, dass ich hoffe, Dietmar möge doch bitte irgendwann einfach einen – für seine Verhältnisse – ›platten‹ Abenteuergarn liefern. Braucht ja kein langes Großwerk zu sein. Ein kleines 200-Seiten Romänchen würde mir vollends reichen zum deutschsprachigen Genre-Glück.)
Eine gut geknüpfte Handlung ist für mich nicht allzu deutlich zu erkennen, denn auf der einen Seite wird das, was sich eigentlich als typische Space Opera-Handlung anbietet (siehe Titel: »Was ist die Pulsarnacht?«) mit zu viel Geheimnisgetue und zu vage dargeboten, um für mich zugänglich oder spannend zu sein. Zudem wird die zweite wichtige Handlungsebene, die ich erkennen konnte, welche sich um die Beziehungen ehemaliger politisch-militärischer Gegner eines Bürgerkrieges rankt, von der zugrundeliegenden Theorie-Pflicht, die der Autor sich abgesteckt hat (und die er in einem Nachwort offenbart, was ich für ein heikles Unternehmen halte, und deshalb zu schätzen weiß) erstickt.
Dennoch gebe ich »Pulsarnacht« gerne 4 ›Goodreads‹-Sterne, weil Dath zu lesen auch diesmal bei mir zu interessanten rauschartigen Zuständen geführt hat. Die Denkanregungen welche »Pulsarnacht« bietet, gefallen mir, und ich habe mich oft amüsiert, auch wenn ich nicht durchwegs sicher bin, ob ich mich mit dem Autoren oder über ihn, oder an ihm vorbei amüsiert habe.
Wenn es um Weltenbau-Ideen geht, und wie man diese mal mit sprachlicher Wucht, mal mit schon lyrischem Schillern, mal mit kalaueraffinen Witz, mal mit grüblerischer Seelenschüferei zum Ausdruck bringt, kann es wohl derzeit keiner mit Dath aufnehmen. Das Gesamtgefüge mag nicht mein Gefallen finden, aber es gibt so viele einzelne glänzende Facetten – Stadtbeschreibung, Kampfsequenz, Dialog, eingestreutes Märchen, Schildung wirtschaftlich-politischer Geflechte, Technik-Babbel –, dass es mir schwer fällt, ignorant gegenüber der Errungenschaft des Romans zu bleiben. Womöglich werde ich ihn mir beizeiten schlicht ein zweites Mal vorknöpfen müssen, wissender darum, auf welche Details ich mein Augenmerk richten muss, um den größeren Zusammenhang der Handlung ergiebiger würdigen zu können. — (Spontane Schlussnotiz: »Es ist für mich 100 x vergnüglicher, mich mit den Romanzumutungen von Dath abzurackern, als Spaß zu haben mit den mundgerechten Schreibformel-Ergebnissen eines Eschbach«)
•••••
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar | ||||||