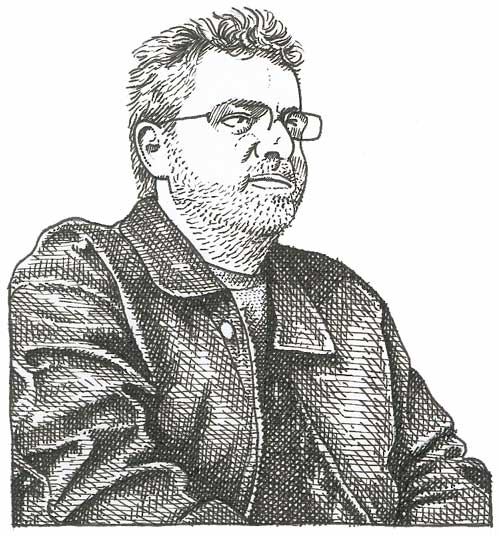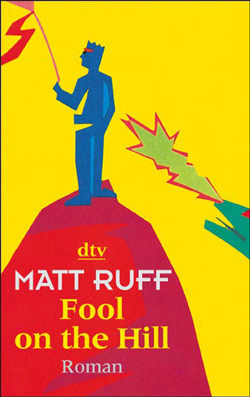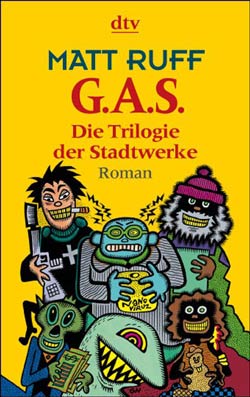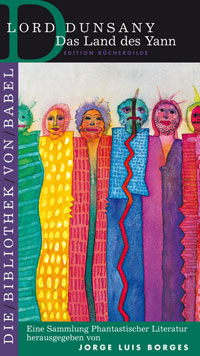Dienstag, 21. August 2007
Die wilden Welten von Matt Ruff (1): Ein persönlich gefärbter Werksüberblick
{07. November 2009: Der ürsprüngliche Eintrag über »Bad Monkeys« und die Romane von Matt Ruff wurde durch die erweiterte »Magira 2008«-Fassung ersetzt.
}
Für
»Magira 2008« habe ich anders als in den Jahren zuvor und danach keine Sammelrezension geliefert, sondern mich auf das Werk eines einzigen Autors – Matt Ruff – konzentriert.
Für die Molochronik-Leser habe ich diesen langen Beitrag in zwei Teilen aufbereitet. Hier könnt Ihr meinen persönlich gefärbten Werksüberblick zu den bisher vier Roman von Matt Ruff lesen. —
Teil zwei enthält mein Gespräch mit Matt, dass ich anläßlich seiner
»Bad Monkeys«-Deutschlandlesetour im Februar 2008 in Frankfurt führen konnte.
Wie immer habe ich den Herausgebern Michael Scheuch und Hermann Ritter, den Korrekturlesern und Layoutern von »Magira« für ihre Unterstützung zu danken. Besonderen Dank schulde zudem ich dem Hanser-Verlag für seine Aufgeschlossenheit, sich auf einen Amateur-Journalisten wie mich einzulassen, und natürlich danke ich Matt Ruff selbst für seine Großzügigkeit und seine Hilfe bei der Nachbearbeitung des Interviews.
Bei
Wieland Freund möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich seine Schriften stellvertretend im Folgenden als Sandsack für Argumentationsschläge missbrauche.
•••••
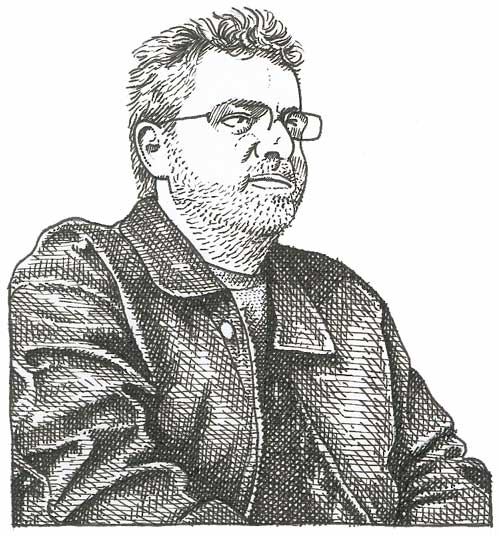 Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.
Eintrag No. 398 — Vier Bücher in zwanzig Jahren. Das ist an sich schon ein Bekenntnis des US-Autors Matt Ruff (1965), denn die Aufmerksamkeit, die man in der schnelllebigen Medienwelt für ein neues Buch erübrigt, schrumpfte in den letzten Jahrzehnten auf etwa drei Monate, sagen die Marktforscher. Schafft es ein Titel nicht, in dieser Zeit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es unter, wie es im Marketingunterholz heißt. Deshalb legt eine entsprechende Praxis des Literaturbetriebes Autoren nahe, möglichst stetig im Rhythmus von ein, zwei Jahren neue Werke auszustoßen, sonst, so heißt es entsprechend dieser Denke, drohe man unter zu gehen, vergessen zu werden. Doch es gibt Ausnahmen: Autoren und ihre Romane, die sich durch mündliche Empfehlungen eine treue Leserschaft erschließen können, Bücher, die nicht so recht in eine klare Vermarktungsschublade passen wollen (es sei denn, man bastelt eine eigene Schublade mit dem jeweiligen Autorennamen als Bezeichnung), so genannte Kultbücher.
Matt Ruff hatte es als 23-Jähriger das Glück, mit einem solchen Kultbuch zu debütieren: »Fool on the Hill« (1988). Wohl besser als gelehrige Beschreibungen, veranschaulicht wie ich finde Folgendes, was ein Kultbuch auszeichnet. Als ich vor gut 15 Jahren einem mit Herzeleid und Sinnkrise geschlagenen Freund eine deutsche Taschenbuchausgabe »Fool on the Hill« geschenkt habe, und wir uns nachdem er es gelesen hatte auf einer Fantasy-Con wieder begegneten, raunte mir dieser Freund dankbar zu, wie erstaunlich punktgenau dieser Roman tröstende Kraft und gemütserweiternden Perspektivwechsel gespendet hat. Ruff ist bei Weitem nicht der einzige moderne Phantast, der über die Macht und die Magie des Geschichtenerzählens schreibt, aber als mir mein Freund dann erzählte, dass er abwechselnd dachte, beim Lesen Wahnsinnig oder erleuchtet zu werden und zeitweise den Verdacht hegte, das ich Gott sei, merkte ich auf. Einmal, weil es selbst unter guten Freunden peinlich und beschämend ist, wenn man derart heftige Komplimente entgegenzunehmen hat, dann auch, weil dieses Gespräch auch für mich ein Aha-Erlebnis war. Mein Temperament als vorlauter Skeptiker und Fan des Abstrusen machen es mir schwer mit allzu tröstlichen oder idyllischen Stoffen warm zu werden. »Fool on the Hill« empfahl ich damals gerne, weil der Roman flotten Popkornspaß bietet und dennoch Tiefgang hat, weil er augenzwinkernd Popkulturanspielungen anbringt und auf überraschende Art aus dem System springt, Seitenschritte macht, die mich zu Grübelein und Gedankenwanderungen anregten. Mein Freund machte mir klar, wie wichtig diese Fähigkeit von Romanen sein kann, wenn uns Lesern durch sie reinigende Erregungen, tröstendes Kopfzurechtrücken zuteil wird.
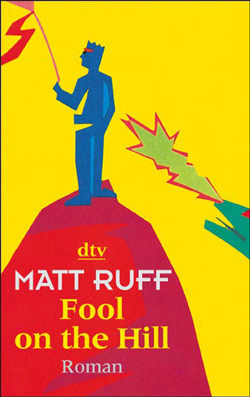 »Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.
»Fool on the Hill« ist ein ungestümer, leichtfüßig daherkommender Roman, dem es spielend gelingt, romantisches Herzeleid, philosophische Träumerei mit haarsträubenden Äktschn-Passagen und frechem Märchenflair zu vereinen. Die eindeutigste Gernebezeichnung, die man diesem Roman zusprechen kann, lautet ›postmoderne Fantasy‹, oder etwas einfacher ›kunterbuntes Schelmenstück‹. Entstanden ist der Roman als Abschlussarbeit des Studienfachs ›Kreatives Schreiben‹ in der Klasse von Alison Lurie an der Cornell Universität in Ithaca, New York, und diese Uni ist auch der Ort an dem die verschiedenen Handlungsstränge von »Fool on the Hill« angesiedelt sind oder zusammenfinden.
Worum geht es? Zentraler Held ist Stephen Titus George, ein Geschichtenerzähler, also ein Lügner, der eine Hilfsdozentenstelle an Cornell Uni inne hat; der sich optimistisch aber einsam nach der ganz großen Liebe sehnt; der beim Drachensteigenlassen mit Hunden über seine fehlgeschlagenen Liebelein plaudert; der gesegnet ist mit dem Talent durch seinem Tanz den Wind zu beschwören und nicht ahnt, dass er von niemand geringeren als einem über alle Geschehnisse des Romans wachenden griechischen Gott (ebenfalls ein Fabulator aus Leidenschaft) auserkoren wurde, ein Heiliger der Tagträumerei zu sein, ein Drachenbezwinger zur Bewahrung des chaotisch-friedlichen Miteinanders der Campus-Welt in der Nußschale. — »Fool on the Hill« erzählt aber auch die Geschichte von dem naiven Mischlingshund Luther und dem auf ihn aufpassenden Kater Blackjack, die sich von der Süd-Bronx aus aufmachen den Hundehimmel zu finden, und deren Queste, bei der sie den Groll von faschistoischen Hunderudeln auf sich ziehen, sie zur Ithaca-Uni führt. — Schließlich ist das Campusgelände auch die Heimstätte von kleinen Elfenwesen, unter ihnen tollkühne Modellflugzeugpiloten und -Schiffskapitäne, die nächtens Tiere aus dem medizinischen Versuchslabor zu befreien trachten und sich vor der Rückkehr des Koboldmagiers Rasferret und seiner Rattenarmee fürchten. Dieser in der Büchse der Pandora begrabene Wicht vermag Lebloses in golemartige Killermonster zu verwandeln, am schrecklichsten gelingt ihm das mit der horrorverbreitenden Gummibraut, dem Sexpuppenmaskottchen einer von Mittelerde begeisterten Studentengruppe des Tolkienhauses. Davor, daneben und dazwischen tummeln sich viele kleine Geschichten in der Geschichte wie die vom Mann mit der Phobie vor der Zahl 13, dem Einritt der subversiv-anachistischen Bohemier-Studentenkumpel von Stephen in ein Provinzkaff und ihr dortigers Gefecht mit einer Bikergang. Die vielleicht schönsten Eigenschaften von »Fool on the Hill« sind, dass der Roman trotz der ein oder anderen wackeligen Stelle überhaupt funktioniert, und der abenteuerliche, gerade mit der richtigen Priese Melancholie gesprenkelte Optimismus, mit dem der Roman seine Leser entlässt.
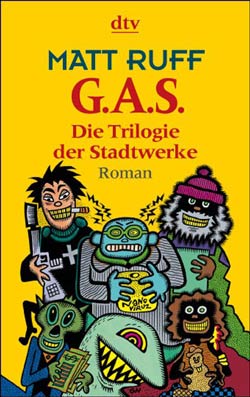 Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).
Ruffs zweiter Roman »G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerle« (»Sewer, Gas & Electric«, 1997), joungliert ebenfalls mit überraschend vielen verschiedenen Ideen und Themen und ist vielleicht sein unruhestiftenster, ›äktschn‹-reichster und womöglich am planlosesten wirkender Roman (obwohl seine Entfaltung überaus kühn kalkuliert ist).
Oberflächlich betrachtet wird den Lesern hier eine wendungsreiches ›Science Fiction Fantasy Verschwörungsthriller‹-Prosacomic geboten. Die atemberaubenden Tumultszenen von »G.A.S.« wirken auf mich, als ob sie einem der exzellenteren SF-Animes, wie »Akira« oder »Robot Angel«, entfleucht sind. »G.A.S.« ist, was die bitterböse Groteskerie seiner phantastischen Übertreibungen angeht, der satirischste und bittertste Roman von Ruff, was sich vor allem in den Ungeheuerlichkeiten des übertriebenen politisch-gesellschaftlichen Aspekten Weltenbaus niederschlägt. Aber Ruff gibt Acht, dass seine Sprache nicht ausser Rand und Band gerät, sondern er präsentiert seine schrägen Ideen und facettenreichen Diskurse des Buches mit lockerem Ton und lebendigen Reden.
Die Jahre 2023 angesiedelte, jedoch immer weider von Rückblenden unterbrochene Handlung, konzentriert zum einen auf New York, wo der reichste Mann der Welt, der Erfinder und Großindustrielle Harry Gant einen gigantischen neuen ›Babel Tower‹ errichtet hat, zum anderen auf Schauplätze in Florida, den Atlantik und Kalifornien. Gant hat sein unverschämt vieles Geld mit den sogenannten ›Elektronegern‹ verdient, Androiden die groß in Mode kamen, nachdem fast die gesamte schwarzhäutige Weltbevölkerung von einer mysteriösen Seuche ausradiert worden ist. Ein Wall Street-Konkurrent von Gant wurde, wie es scheint, von einem solchen Roboter dem die durch Isaac Asimov bekannten Sicherungen durchgebrannt sind gekillt, was natürlich ganz schlecht für Gants Geschäftsimperium wäre. Also engagiert er der Publicity wegen seine radikalliberale Ex-Frau, die sich zusammen mit einem fast 200 Jahre alten Veteran des Amerikanischen Bürgerkrieges aufmacht, den Mord aufzuklären. — Auch die bunte Ökoterroristentruppe um den begnadeten Saboteur-Künstler Philo Dufrense bereitet mit ihrem bunten Wunder-U-Boot ›Yabba-Dabba-Do‹ dem megareichen Industriekapitän Gant Probleme. Darüberhinaus sorgt ein mutierter Monsterhai namens Meisterbrau in den Kanalisationseingeweide von New York für Angst und Schrecken und irgendwo hinter den Kulissen heckt eine durchgeknalle Künstliche Intelligenz wegen eines Hörfehlers Pläne aus, die selbst Hartgesottenen eine Gänsehaut bescheren dürfte. — Der Roman knöpft sich kreuz und quer in diesem schnellgeschnittenen Gewusel sehr frech und engagiert verschiedene brachial-positivistische Gesellschaftsknetenwoller und ihre Großraumphantastik vor.
Egal wer »Hurrah, die Zukunft gehört uns!« ruft, ob Kapitalisten, christliche Pfadfinder, Geheimdienststrippenzieher oder die Verwalter des dunklen Vermächtnis von Disneyland, sie alle bekommen ihr Fett ab. Am aufregendsten ist dabei die in »G.A.S.« stattfindende Auseinandersetzung mit der bei uns weitestgehend unbekannten Ayn Rand, Erfinderin des ›Objektivismus‹, einer vulgär-materialistischen Kapitalismus- und Egoismusverherrlichung. Rand inspiriert bis heute als frappierend humor- und emphatiefreies Pinupgirl Chicago-Boys, Neocons & Neoliberale. Trotz all der munter-skurielen Abstrusitäten und der zahllosen schrägen Typen wird der Leser am Ende in eine etwas bedrückende Stimmung entlassen, was aber angesichts des seit Erscheinen des Romanes ehr heftiger als milder gallopierenden Infowar-Wahnsinns die angemessene Spötterei auf hegemoniestützende Märchen vom Ende der Geschichte ist. Also ist Vorsicht oder Lesewagemut gefordert, damit man beim Lesen nicht von auf mehrfache Schallgeschwindigkeit beschleunigten Salamis K.O. geschlagen wird.
Um die für meinen Geschmack beeindruckende Reifung von Matt Ruffs Schreiben zu beschreiben, die sein nächstes Buch markiert, will ich kurz innehalten, um über die Reize und Gefahren seiner, und allgemein über phantastische Fabulationen, zu sinnieren und zwar im mir eigentlich gar nicht behaglichen, ja sogar unsympathischen weil anmaßenden ›Wir‹-Modus.
{Wir-Modus an} Aufmerksame Beobachter der kulturellen Weltläufte sagen, dass um ums herum ein Paradigmenwechsel abläuft. Das geschriebene Wort wird verdrängt vom photographierten, vom gefilmten, vom digital zusammengezauberten Bild. Keinesfalls teile ich die Ansicht, dass die erzählende Literatur durch diese vermeintlich unheilvollen Entwicklung ins Abseits gerät. Aber wer allein und lediglich schreibend erzählt, sieht sich vor die Wahl gestellt, ob man sich auf Leser spezialisiert, welche die neuen Medien meiden um lieber in den pietätvollen Gefilden der Literatur zu bleiben, oder ob man es als Geschichtenerzähler wagt, sich den Herausforderungen durch Blockbuster-Kino, TV-Serien und Computerwelten zu stellen. Wir, die mit zweiterem als etwas Selbstverständlichem aufgewachsen sind, und denen die Freuden und den Wert des ersteren nahezubringen man sich bei unserer Erziehung mühte, tun uns zuweilen schwer damit, wie vom Kulturestablishment unsere Popkultur als nichtiger oder gar gefährlicher Tüdelkram in die Schämecke geschickt wird. Man verzeihe mir, wenn ich zur Veranschaulichung hier einen fragmentarischen Remix einer solchen Skeptik zu den Freuden popkulturellen Fabulierens präsentiere:
Ruff ist ein Bewohner des Weltinnenraums, dieser vollklimatisierten, bildschirmgepflasterten, in sich selbst verdrehten Zone. … ein Nerd … Ruff bedient sich, wo er will … wie gerne Kinder sich Höhlen bauen, um darin zu kuscheln … Ruff kuschelt auch … (Fantasy ist unter anderem ein Globalisierungsphänomen) … Politisch korrekt war das bei Lichte besehen nicht, doch hat Ruff die Gabe, es dem Leser so gemütlich zu machen, dass der lieber liest, als nachzufragen. … Bilderbuch-Liberaler. … Manchmal allerdings geht es eben durch mit dem politisch korrekten Matt, vor allem beim Rennen, Retten, Flüchten und Schlagen und Schießen und Bluten. Eigentlich kommt kein Ruff-Plot ohne Tom-und-Jerry-Finale aus. … Am Ende spielen alle Bücher des Matt Ruff im Weltinnenraum der Fiktion und alles Außerhalb ist ihnen ein fernes, kaum mehr verständliches Echo.
{01}Nicht alle von uns, die wie Matt Ruff selige Tage der Adolszenz mit Rollenspielen, Comics, Soap- und SF-Serien verbracht haben, bleiben ewig treudoof unkritisch gegenüber unseren mit Postern, Action-Figures und Franchise-Icons geschmückten Kuschelhöhlen. Trotzdem (oder durchaus auch weil) wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit mit solchen Dingen wie Superheldenbiographien, Trading Cards und nicht zuletzt Weltenbau vertändeln, haben wir ein Gespühr sowohl dafür entwickeln können, dass sich die Athmo des Inneren so mancher altehrwürdigen Elfenbeintürme der Großraumphantastik-Verwalter kaum unterscheidet von der unserer infantilen Höhlen, und wie sensibel die Kulturtechniken zur Entwicklung, Installation, Instandhaltung von, und des Austausches zwischen Parzellen des klimatisierten (sprich: künstlichen) Weltinnenraums der Fiktion ist. Auch wir Fans von zuweilem arg schriller und eskapistischer Phantastik können, wie es ein Kenner der Materie beschreibt, mittels dieser
zu den Wurzeln unseres Denkens und Verhaltens vorzustoßen, was den Einzelnen befähigt, wieder Herr zu werden über seine Entscheidungen.
Freilich kann man nun trefflich streiten darüber, welche Phantastik seriöse »distentzierende Erkenntnisakte«, und welche nur liederliche, gar schädliche Ablenkung und Betäubung fördert.{02} {Wir-Modus aus}
 Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das
Der 2003 erschienene dritte Roman von Ruff, »Ich und die Anderen« (»Set this House in Order«, 2003), ist sein bisher bester und beeindruckenster Roman, auch gemäß seines eigenen Urteils und dem so mancher Vertreter der literarischen Kreise. Ruff gelingt es brilliant sich mit diesem Buch als ernsthafter und seriöser Phantast zu etablieren, wenn das
{w}as die seriöse Phantastik vom bloßen Obskurantentum trennt, sei es von seinen literarischen oder auch von den heute ins Kraut schießenden pseudokultischen Ausprägungen, der Umstand {ist}, dass sie nicht einer Droge ähnlich wirkt, sondern den Leser durch die literarische Gestaltung der Angst in einen Zustand erhöhter Alarmbereitschaft versetzt.
{03}Der englische Nebentitel lautet ›A Romance of Souls‹, was man in etwa mit ›Eine Abenteuergeschichte von Seelen‹ eindeutschen kann, und das ist wortwörtlich gemeint. Hier geht es um zwei Menschen, die mit dem so genannten ›Multiplen Persönlichkeits Syndrom‹ geschlagen sind. In der Realität wird diese Diagnose noch ziemlich heftig debattiert, was nicht verwunderlich ist, handelt es sich doch bei Fragen dazu, wie denn genau unsere inneren Welten beschaffen sind und funktionieren noch um eine Problematik, die sich nicht mit der objektiven Phantasie ergründen lässt, auch wenn wir in Zeiten leben, in denen man täglich über neue Meldungen den Medien stolpern kann zur wissenschaftlich-instrumentellen Erforschung dieses dunkelsten aller Weltenterrains.
Während Andy über seinem Zustand Bescheid weiß und damit ganz passabel umzugehen gelernt hat, hat die von Black-Outs geplagte Penny keinen Schimmer davon, dass viele konkurrierende Teilpersönlichkeiten sich um ihren Körper kabbeln. Im Milieu der Seattle’schen New Economy begegnen sich Andy und Penny als Mitarbeiter einer IT-Spiele-Firma namens ›Virtuell Reality‹, und brechen später auf zu einem irrwitzigen Trip ins Herz der provinziellen USA, um die Vergangenheits-Geheimnisse von Andys Seelenzertrümmerung zu ergründen.
Obwohl dieses dritte Buch von Ruff meistens genauso verspielt und humorig wie seine beiden Vorgänger ist, mutet es seinen Lesern stellenweise extrem gruselige Passagen über innerfamiliäre Grausamkeit zu. Das taugt sicherlich nicht jedem, das schreckt sicherlich manche ab, doch Ruff bleibt anständigt, da er keine Spektakelausbeutung mit dem Thema Kindesmißbrauch und sadistische Eltern betreibt. Ich persönlich fand es da sehr angenehm und passend, dass »Ich und die Anderen« nicht so wirr und trügerisch wie »G.A.S.«, sondern wieder eher wie »Fool on the Hill« versöhnlich-aufrichtender ausklingt. Zudem ist es sprachlich weniger peppig und der dramaturgische Fluß merklich ruhiger als seine beiden Vorgänger.
 2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!
2008 ist der neuste Roman, »Bad Monkeys« erschienen. Nicht nur, weil er sein bisher kürzester, vielleicht auch sein elegantester Roman ist, halte ich »Bad Monkeys« für das womöglich beste Einstiegsticket zur Reise in die wilden Welten von Matt Ruff, sondern auch, weil ihm für mein Empfinden wie bei keinem seiner vorherigen Büchern hier eine besondere schwebende Balance, die sich meines Erachtens eben vorzüglich mit den Mitteln der Phantastik erreichen lässt, hervorragend gelungen ist: Einerseits mit sorgenvollem, berührendem Engagement gerade von statten gehende, verunsichernde Fehlentwicklungen der globalen Welt zu kommentieren, aber andererseits (für alle, die lieber mit ausgeschaltetem Gesellschafts- und Kulturkritik-Radarschirm lesen) schlicht einen aufregenden, fetzigen Abenteuerzirkus zu bieten, kompletto mit phantastisch-futuristischen Requisiten, schrillen Kostümen und reichlich Verfolgungshatz, ›Bullett Time‹-Geballer und ausgeklügelten Verhörungsduellen. Zudem zeichnet den Roman eine gewisse Heftigkeit aus, die vielleicht darin gründet, dass Ruff hier in für ihn ungewohnter Kürze ein äußerst dichtgesponnener, subversiver Garn gelungen ist, der einen im Fortlauf der Handlung in immer kürzeren Intervallen den Kopf in alle möglichen Blickachsen dreht. Mind Fuck galore!
»Bad Monkeys« ist einerseits ein Kammerstück, eine Charkterstudie, denn die Handlung setzt im Juno 2002 ein, im weißen Raum einer Gefängsnispsychatrie in Nevada, wo ein Dr. Vale die frischverhaftete Mörderin Jane verhört. Diese ›White Room‹-Kapitel sind kurz, auktorial erzählt, rekapitulien beziehungsweise leiten zu den längeren Kapiteln über, in denen Jane als Ich-Erzählerin ihre Lebensgeschichte als ›Bad Monkey‹-Agentin erzählt. Die Art des Verhörhumors läßt sich fein illustrieren anhand weniger Zeilen von S. 3:
»Worin besteht die Arbeit bei Bad Monkeys«, fragte der Arzt, »also was tun Sie? Böse Menschen bestrafen?«
»Nein. Normalerweise töten wie sie einfach.«
Jane ist eine packende, charismatische Erzählerin (obwohl: manche Rezensenten fanden sie unsympathisch. Am Ende des Romanes zu urteilen, ob Jane denn nun sympathisch oder unsympathisch, feige oder mutig, böse oder gut ist, gehört zu den aufregenden Angeboten, die Matt Ruff hier seinen Lesern macht) wenn sie von ihrer wilden Kiffer-Jugend im San Francisco der Siebziger und vom zunehmenden Klinsch mit ihrer Mutter berichtet; davon, wie sie ein netter Polizist zu Verwandten in die hinterletzte Provinz bringt, nachdem ihre Mutter vollends die Nerven verloren hatte, als Jane beim Dope-Anbau erwischt wurde. Schön sachte driftet dann die bisher realistische Welt ins die Gefilde der Verschwörungsphantastik, wenn die jugendliche Jane eine seltsame ›Natürliche Ursachen‹-Knarre findet, mit der man Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen kann, ein Artefakt einer namenlos bleibenden Organisation, von der Jane Jahre später für die Abteilung ›Bad Monkeys‹ rekrutiert wird.
Ganz besonders freut und beeindruckt mich, dass Matt Ruff mit diesem Roman eine hinreissende Homage auf Philip K. Dick — den (für mich) großartigsten Kurzgeschichten-Phantasten der zweitem Hälfte des 20. Jahrhunderts — vollbracht hat. Trotz aller Späßchen und Thrills pulsen die Erz-Fragen von P. K. Dicks Werk (»Was ist Menschlich?«, »Wer bin ich?« und »Was ist Wirklichkeit?«) stets merklich durch den Strang der »Bad Monkeys«-Erzählung. Was habe ich Seite um Seite gestaunt, wie eingängig »Bad Monkeys« ist, und doch zugleich wie verwickelt, mit seinen zig-ineinandergeschachtelten Finten. Der für mich schönste, alles zusammenfassende Weisheitsspruch aus »Bad Monkeys«, der zugleich auch wie kein anderer Satz die Essenz seiner vier Bücher herausdestilliert lautet »Omnes mundum facimus« (»Wir alle machen die Welt«).
••• Zu Teil zwei mit dem Interview.
•••
Flattrn Sie diesen Eintrag, wenn Sie der Meinung sind, dass er etwas wert ist.
•••
BIBLIOGRAPHIE:
»Fool on the Hill« (»Fool on the Hill« 1988); Übersetzung: Ditte König & Giovani Bandini, 576 Seiten; — Gebunden: Hanser (Erstausgabe, vergriffen), 1991; Zweitauendeins, ISBN: 3861504057; — Taschenbuch: DTV, 1993, ISBN: 3423117370.
»G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerke« (»Sewer, Gas & Electric – The Public Works Trilogy«, 1997); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 624 Seiten; — Gebunden: Hanser, 1998, ISBN: 3446192905; — Taschenbuch: DTV, 2000, ISBN: 3423207493.
»Ich und die Anderen« (»Set this House in Order – A Romance of Souls« 2003); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 600 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2004, ISBN: 3446205357; — Taschenbuch: DTV, 2006, ISBN: 3423208902.
»Bad Monkeys« (»Bad Monkeys« 2007); Übersetzung: Giovani und Ditte Bandini, 251 Seiten; — Gebunden: Hanser, 2008, ISBN: 3446230025 ; — Taschenbuch: DTV, 2009, ISBN: 3423211792.
•••
ANMERKUNGEN:
01 Wieland Freund:
»Kampfaffen in der Tiefgarage, eine Begenung mit dem Kinoerzähler Matt Ruff«, in »Die Welt« vom 09. Februar 2008. •••
Zurück
02 Paraphrase nach Winfried Freund: »Arbeitstexte für den Unterricht: Phantastische Geschichten«, Seite 90, Reclam 1979/2001. ••• Zurück
03 Ebenda, S. 92.••• Zurück
Samstag, 18. August 2007
Antwort auf einen »Offenen Brief an einen Atheisten«
(Eintrag No. 397; Großraumphantastik, Polemik, Diesseits, Ernsthaftigkeit) — Noch drei Tage bis zum 2000-Tage-Jubiläum der Molochronik. Entsprechend reflektiere ich über Sinn und Zweck meines Blogs und meines öffentlichen Meinungsschiebens und mir gehen vermehrt ernste Sachen durch den Kopf.
Im Forum der Brights stolperte ich über folgenden »Brief an einen Atheisten« auf den ich folgendes (mal auf die Schnelle) zu antworten weiß.
•••••
Lieber Hobby-Missionar Ingmar.
Alle Menschen, ob Religiöse oder Atheisten, gründen ihre Lebenshaltung auf ›Glauben‹. Immerhin verlassen wir uns zu etwa 9/10 auf Informationen zweiter, dritter Hand.
Die Nichtreligiösen spielen halt kein metaphysisches Ponzi-Schema mit einem Phantasie-Jenseits oder fiktiven Wesen. Wie schon andere hier (im Birghts-Forum) schrieben, sind Überwesen wie GOtt, Götter, Teufel usw ›Stimmen im Kopf‹ oder Teil der kollektiven Phantasie der Menschheit.
Der Schlüsselbegriff hierbei lautet meiner Meinung nach ›Verantwortung‹. Verrechne ich mein Handlen mittels einer fiktiven Jenseits-Bank, oder beziehe ich meine Haltung und Entscheidungen auf diese eine Lebenszeit? — Ich kann zwar gut verstehen, daß viele viele Menschen das ›heilige Zittern‹ erfasst, wenn sie derart mit Verantwortung konfrontiert werden und deshalb gerne jeden sich bietenden Strohhalm ergreifen, um diesen Druck zu mildern. Der Trick, Vergänglichkeit als Entlastung und Chance zu sehen, ist nun mal kein einfaches Manöver.
Persönlich bin ich aber lieber als Atheist ein ›Versager‹, als daß ich mich von solchen Machterhaltungs-Praktiken wie ›Sähe Angst und ernte Hoffnung‹, ›Teile und Herrsche‹ an der Nase herumführen lasse. Ich denke, kein noch so religiöser, vom Jenseits überzeugter Mensch würde mir 100000 Euro ›leihen‹, wenn ich als Rückzahlung verspräche, ihm im Jenseits dafür x-Jahrhunderte lang den Rücken zu massieren. Da kommt der andere Schlüsselbegriff zu dieser Angelegenheit ins Spiel: ›Vertrauen‹ = die eigentliche und wichtigste Grundwährung der Menschheit. Atheisten sind halt aus dem Fantasy-Pyramiden-Kettenbriefspiel ausgestiegen und ich für meinen Teil bin stolz auf diesen Schritt.
Als bekennender ›gläubiger‹ Maximal-Phantast finde ich z.B. Comic oder Phantastik-Genre-›Trash‹ und andere wundersame Sachen wie Monster, Garten Eden, Inferno, Limbus, Haus der Seelen, Wiederauferstehung usw ganz faszinierend. Wie aber mittels der Faszinationskraft solcher ›Ideen‹ realpolitisch auf der Kugeloberfläche Erde immer noch im Großen Maßstab Schindluder betrieben wird ist schlicht eine Schande. Die entsprechend hochmütige Einstellung von überzeugt religiös Gläubigen ist meiner Meinung der Abhängigkeit von Süchtigen (egal welcher Substanz) erschreckend ähnlich.
Mensch macht sich etwas vor, mehr nicht.
Ein zufriedenstellendes Leben und den Mut den eigenen Verstand zu gebrauchen ohne vom Gewissen niedergemosert zu werden wünscht,
der Geschichten erzählende Affe
Molosovsky.
Samstag, 11. August 2007
Dienstag, 7. August 2007
Sonntag, 5. August 2007
Lord Dunsany: »Das Land des Yann«
Eintrag No. 394
01. Oktober 2007: Eine Runde Fehlermerzung.
ZWEITE FOLGE VON MOLOS WANDERUNGEN DURCH
 DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
DER BÜCHERGILDE GUTENBERG
Endlich wachse ich rüber mit der zweiten Folge meiner (mindestens) zwölfteiligen Serie zur Büchergilde Gutenberg-Neuauflage der von Jorge Luis Borges zusammengestellten Anthologie-Reihe »Die Bibliothek von Babel«.
Hier geht’s zur ersten Folge (zum Borges-Band »25. August 1983«). Kommt nun an Bord und lest …
 Die Klage vorweg (dann ist sie vom Tisch), allein schon, um nachvollziehbarer zu machen, warum ich soooo begeistert bin über diesen neuen Auswahlband mit acht Stücken Dunsany'scher Kurz-Phantastik:
Die Klage vorweg (dann ist sie vom Tisch), allein schon, um nachvollziehbarer zu machen, warum ich soooo begeistert bin über diesen neuen Auswahlband mit acht Stücken Dunsany'scher Kurz-Phantastik:
Wenn man bedenkt, wie umfangreich Dunsanys Werk (Romane, Kurzgeschichten, Dramen, Lyrik), wie groß sein Repertoir ist, und vor allem, wenn man gewahr wird, wie enorm sein Einfluß auf die Phantastik die im folgte ist, dann läßt sich nur durch Heranziehen schweißtreibend deprimierender Spekulationen möglicherweise verständig erklären, warum so überaus wenig von ihm ins Deutsche übertragen und veröffentlicht wurde.
›CRAZY H.P.L.« HAT MICH VERFÜHRT
Ein bischen beklommen bin ich, über Lord Dunsany (1878-1957) zu schreiben, denn soviel ich auch darüber grüble, mir etwas Neues, Eigenes über ihn aus der Nase zu ziehen, so oft driften meine Gedanken immer wieder zurück zu einer meiner lebhaftesten Lesephasen. Vor gut zwanzig Jahren habe ich die Prosawelten des Amerikaners Howard Phillip Lovecraft für mich entdeckt, und wie so manch anderer männliche, verklemmte, nachtaktive Stubenhocker-Teenager verfiel ich in einen regelrechten Lese- und Identifizierungsrausch. Nicht nur versank ich in den Fiktionen von Lovecraft, deren Kosmisches Grauen und Wahnsinnsanfälligkeit ich bis heute als sehr sinnvolle und kräftige Kommentare über unsere tatsächliche Welt verstehe; ich ging zudem mit großer Leidenschaft darin auf, Sekundärliteratur über Leben und Denken Lovecrafts zu verschlingen. Mein Hineinversetzten in diesen seltsamen Eigenbrötler war für eine Weile schon von lächerlicher Heftigkeit, und so stakste ich mit meinem nach Ausweitung drängenden Gemüt durch die komischen Mischkulanzen aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, rationaler Kälte und melancholischer Wehmut, übersprudelnder Phantasie und pessimistischer Sicht auf die moderne Welt, die für Lovecraft typisch ist.
Entsprechend begeistert und ›gläubig‹ ließ ich mich damals von Lovecrafts Denken und Urteilen zur Phantastik leiten. Rückblickend betrachtet, war das gar nicht mal so schlecht. Klar: man sollte als Erwachsener immer auch ein kritisches Auge auf die Helden der eigenen Jugend und deren Einfluß haben. Aber ich lehne mich wohl keinen Milimeter zu ungehörig weit aus dem Fenster, wenn ich Lovecrafts Essay »Supernatural Horror in Literature« aus dem Jahre 1927 lobpreise: bis heute hat sich dieser schmale jedoch gehaltreiche Band seine orientierende und anregende Kraft bewahrt. Dort behandelt Lovecraft Dunsany im letzten von 10 Kapiteln: »Die modernen Meister«[01]:
Unübertroffen in der Zauberei einer kristallinen, singenden Prosa und von überragendem Rang in der Erschaffung einer prächtigen und sehnsuchtsvollen Welt irisierender, exotischer Visionen ist Edward John Moreton Drax Plunkett, Achtzehnter Baron Dunsany, dessen Geschichten und kurze Theaterstücke ein fast einzigartiges Element in unserer Literatur bilden. Als Erfinder einer neuen Mythologie und als Erdichter überraschender Volksmärchen steht Lord Dunsany im Dienst einer fremden Welt der phantastischen Schönheit, verschworen dem ewigen Kampf gegen die Roheit und Häßlichkeit der Wirklichkeit des Alltags.
Wie sollte ich vermögen, solch feine Literatur-Essay-Schreibe noch zu übertreffen, wie Lovecrafts Lob noch groß was hinzudichten?
»IM LAND DES YANN«
Aber zur Sache: Was für eine Suite an Dunsanyaden hat unser blinder Bibliotheksdirigent Borges für geneigte (angehende und bewanderte) Phantastik-Connaisseure zusammengestellt?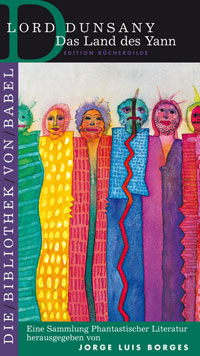 Eine repräsentative, sprich, muntere Prosa-Auswahl, mit sieben Geschichten und einem kurzen Einakter.
Eine repräsentative, sprich, muntere Prosa-Auswahl, mit sieben Geschichten und einem kurzen Einakter.
Ein paar Stellen aus Borges Vorwort die ich bemerkenswert finde: Jorge Luis tadelt (zu Recht!!!) Dunsany für seine Löwen-Abknallerei. Mittels eines Zitats deutet J.L. an, daß zur Güte von Dunsanys träumerischer Mythenbastelei wesentlich dessen ›typisch keltisches magisches Naturgefühl‹ beiträgt. Schließlich, daß Dunsany ein Musterbeispiel eines Dichters ist, der zwei Werke hinterläßt: das dichterische und das biographische, sprich: der Eindruck, den er als Mensch bei uns hinterlässt. Grad aus der Schaar der Phantasten kommen die Schöpfer selbst oftmals wie etwas fremdartige Charaktere aus einer myteriösen Welt daher. Dunsany wäre eine prächtige Ergänzung für jegliche »Liga der außergewöhnlichen Gentleman«, Baron, Märtyrer- und Raubritternachfahre, Soldat, Geheimagent, Kriegsveteran, Schachgroßmeister, Großwildjäger, Gänsekielnutzer, Weltenbauer und Erfinder von ungezähmten Märchen, der er war.
Gleich die Eröffnungsgeschichte »Am Rand der Gezeiten«[02] führt vor, wie man mit einem rahmenden ›alles nur geträumt‹-Bikini das Signal gibt, daß man als Autor mal nicht einfach eine weitere kleine aufregende Begebenheit abschnurrt, sondern lieber ein athmosphärisches, bild- und sinnenstarkes Prosagedicht ausbreitet. Auch wenn diese Phantasie darüber, wie eine Seele im Fegefeuer der cthonischen Entropie darbt, in Londons Themsegewässen angesiedelt ist, könnte sie in jeder Flußmündungsgroßstadt spielen. Und in Hafenstädten wimmeln die Agenten, und unser namenloser Protagonost alpträumt davon »eine gräßliche Untat begangen zu haben, so daß mir kein ehrliches Grab zuteil werden durfte« (S. 13). Die eigenen Freunde killen den Unbekannten und verscharren ihn zur Ebbe im Flußschlamm. Was nun folgt ist eine irrsinnige Raffung der Verfalls-Gezeiten, was sich aber alles andere als hektisch ausnimmt, sondern vielmehr morbide Grazie verströhmt.
»Das Schwert und das Idol«[03] ordne ich einer Text-/Genre-Gruppe zu, die sich ›Steinzeit‹- oder ›Vorgeschichts‹-Fantasy nennen könnte. Von Jack London (»Before Adam – Bison Frontiers of Imagination« 1906-07) an, über Roy Lewis (»Edward«, 1960), Umberto Eco (»Das Ding«, 1961), bis Alan Moore (»Hob’s Hog«, 1996), phantastisch mutet es allemal an, wenn unsere ›Ugha-Ugha‹-Vorfahren als Hauptfiguren in abenteuerlichen Geschichten auftreten, und oftmals dienen solche fiktiven Urzeitereignisse als Parabel über die Basis-Beschränktheiten des Menschen. Hat sich ja auch außer Technik und Frisurenmode kaum was geändert. — Dunsanys kurze Story kann als Einstiegslektion in die Kniffligkeiten gruppeninterner Informations- und Psychagogie-Kriegsführung verstanden werden. Auf der einen Seite die Menschen, die sich um ihr Lagerfeuer zusammendrängen, auf der anderen die gefährliche Umwelt, hier vertreten durch Wölfe. Innherhalb der Frühmenschengruppe konkurrieren Technikmeister und Glaubenshüter miteinander. Auch wenn Dunsany hier keine archäologisch korrekte Studie vorlegt, fabuliert er doch in knapper, unterhaltsamer Form offen darüber, mit welchen Selbstüberhöhungsgebahren die Militärtechnik-Machtinhaber Respekt einstreichen, und mit welch perfiden Illusionstricks die Proto-Priester die wundergläubige Gemeinde an der Nase herumführen. Für atheistische Brigths und religiöse Gläube gleichermaßen eine vergnügliche Leküre.
»Carcassonne«[04] kann jedem Phantastik-Interessierten als brilliante Anschauung dienen, wie die literarischen Zwischenschritte geartet sind, die bereits keine traditionellen Sagen, Legenden oder Künstmärchen mehr sind, aber auch noch nicht dem heute gebräuchlichen Schwarm an Fantasy-Questen angehören. Die durch die Katharer und Albigenserkreuzzüge geschichtlich berühmt-berüchtigte Stadt Carcassonne ist bei Dunsany ein magischer Sehnsuchtsort, bewacht von Drachen, beherrscht von einer schrecklichen, schönen Hexe. König Camorak von Arn und seine Krieger ergötzen sich am Harfnergesang eines namenlosen Sehers, und man beschließt, dessen Prophezeiung, daß niemand Cascassonne erreichen kann, heldisch widerlegen zu wollen. Dunsany glänzt als Stimmenmeister, und Friedrich Polakovics Übertragung ist schlicht wunderbar, wie man vielleicht schon anhand des folgenden Ausschnitts merkt (S. 41. Erinnert mich an Hans Dieter Hüschs wunderbare Mär über die Bäcker von Beumelburg):
Und Camorak hub an und sprach: »Vieles ist, das bedacht werden muß, denn viel Rats ist zu pflegen, und auch der Vorräte darf nicht vergessen werden. An welchem Tag also brechen wir auf?« Und all die Krieger riefen wie aus einem Mund: »Noch heute!« Und Camorak lächelte darob, denn er hatte die Männer bloß auf die Probe gestellt. So nahmen sie denn ihre Waffen von den Wänden: Sikorix, Kelleron, Aslof, Wole der Axtkämpfer. Und ferner Huhenoth und Friedbruch. Und auch Wolwuff, Kriegvater, Tarion, Lurth mit dem Schlachtruf und all die anderen. Und die lauernden Spinnen im lärmenden Saal ließen sich nicht träumen die Grabesruhe, der sie so bald sich erfreuen würden.
Hier spielen Drachen mit gefangen Bären wie Kätzchen mit der Maus, hier speien Berge Feuerbomben, erscheinen des Nachts Bäume herrschaftlicher als Könige und ich selbst fand besonders erfrischend, wie Dunsany nebenbei schlemisch vermerkt, wie das einfache Volk im Kuhstall über die Machokriegerqueste tratscht. Diese Erzählung bettelt geradezu danach, bei einer Fantasy-Con am Lagerfeuer vorgetragen zu werden. Auch wenn es hier (wie fast immer) gehörig unheimlich zugeht, bezaubert »Cascassonne« vor allem durch seine Sprachmelodik, und illustriert anschaulich, was H.P. Lovecraft über Dunsany schreibt:
So ist also Schönheit und nicht Entsetzen der Grundton von Dunsanys Werk.
Das titelgebende Hauptstück und der Höhepunkt des Bandes »Das Land des Yann«[05] ist meiner Meinung nach nun eine konzentrierte Vorwegnahme der bis heute wirksamen Hauptströmungen dessen, was wir Phantastik-Narren als gelungene ›Fantasy‹ bezeichnen. Der Leser begleitet (sozusagen als Tourist) einen Träumer bei seiner Reise mit der Sturmvogel auf dem großen Fluß Yann. Die Grenze zwischen Schlafen und Wachen verschwimmt dabei immer wieder, und mit zunehmender staundender Verblüffung lesen wir von den seltsamen Gebräuchen der Schiffsbesatzung, den befremdlichen Sitten der Städtebewohner an den Ufern des Yann. Auch hier macht Dunsany den ein oder anderen Jux über die Irrungen und Eigentümlichkeiten gläubiger Religions-Phantastik, z.B. wenn er schildert, wie die Sturmvogel-Crew den dräuenden Gefahren der Reise vorbeugt (S. 59):
Und dann knieten die Schiffsknechte nieder auf den Planken des Decks und begannen zu beten, doch beteten nicht alle auf einmal, sondern nur fünf oder sechs zur selben Zeit. Seite an Seite knieten sie nieder zu fünfen, zu sechsen, den es war Brauch, daß nur Männer verschiedenen Glaubens gleichzeitig ihre Götter anriefen, auf daß kein Gott vernähme, wie im selben Atem zwei Männer zu ihm beteten. Und hatte der eine sein Gebet beendet, so trat ein anderer des nämlichen Glaubens an seine Stelle.
Selten sind die Erzählungen, die derartig abwechslungsreich und spannend daherkommen, die auf so engem Raum so viel Bilderschätze und Rätsel bergen. Auch hier paßt wieder ein Zitat aus Lovecrafts Essay wie die Faust aufs Auge:
Dunsany liebt es, verstohlen und listig ungeheuerliche Dinge und unglaubliche Verhängnisse anzudeuten, wie es im Märchen geschieht.
Nun folgen die zwei kleineren Geschichten, mehr Anekdoten oder Gedankenspiele, »Die Wiese«[06] und »Der Bettler«[07]. Die erste baut auf dem Kontrast zwischen London (Stadt-Stress) und Wiese (Land-Idyll), und gönnt uns beunruhigent-empfindsamen Spekulationen darüber, daß wichtige und schicksalsträchtige Vorfälle einem Ort als Echo oder Vorklang anhaften mögen. Die zweite läßt einen kuriosen Bettlertrupp vom Piccadelli Rund zum Green Park prozessieren, wobei gesegnet wird, was absolut segenswürdig ist an unseren modernen Metropolen: Straßenlampen, Häuser, Bäume und Kanalabflüße.
»Das Bureau d'Echange de Maux«[08] unterbreitet uns die Idee, daß es in einer kleinen Gasse zu Paris einen Laden gibt, in dem man (freilich durch Entrichtung einer Vermittlungsgebühr) sein Unglück mit anderen tauschen kann, beispielsweise (S. 104):
Ich lernte, daß jedem sein eigenes Übel das ärgste auf Erden ist, und wie ihr eigenes Übel die Menschen so sehr beunruhigt, daß sie stets das entgegengesetzte Übel eintauschen wollen in dem kleinen, gräßlichen Laden. So tauschte ein Weib, dem es versagt war, Kinder zu haben, mit einem armen, halbirren Kind von zwölf Jahren. Und ein andermal hatte ein Mann seine Weisheit für Narrheit gegeben.
Besonders hier vermeine ich deutlich zu spühren, wie stark Dunsanys Einfluß auf heutige, gehalt- und ideenreiche Phantastik ist. Der ›Laden zum Tausch von Übeln‹ könnte ohne Probleme in einer der vorzüglichen Vertigo-Comics (z.B. »Sandman«, »Fables« oder »Lucifer«) oder bei zeitgenössischen Phantastik-Könnern wie China Miéville, Jeff Vandermeer oder Neil Gaiman auftauchen. (Nebenbei: man stelle sich vor, daß Joseph K. aus Kafkas »Der Prozess« sein Unglück in diesem Geschäft tauscht. Fragt sich nur, was das entsprechende Gegenteil einer anonymen Anklage ist.)
 Eine Kostprobe von Dunsanys zahlreichen Minidramen und Theaterwerken gibt abschließend »Eine Nacht im Pub«[08]. Irgendwie ergab es sich, daß ich dieses Stück über vier Diebe, die einem indischen Zyklopen-Götzen das Edelsteinauge geklaut haben und nun kaum ihr panisches Fingernagelknabbern kaschieren können, da rächende Kultisten ihnen auf den Fersen sind, wie ein Gruselcomic aufnahm; bzw. mich daran vergnügte, mir vorzustellen, wie Harry Rowohlt diese Geschichte vortragen würde. (H.P.L. schreibt passend: Auch Humor und Ironie sind oft gegenwärtig, um einen saftigen Zynismus zu verbreiten und das abzuwandeln, was sonst wohl eine naive Intensität besäße.)
Eine Kostprobe von Dunsanys zahlreichen Minidramen und Theaterwerken gibt abschließend »Eine Nacht im Pub«[08]. Irgendwie ergab es sich, daß ich dieses Stück über vier Diebe, die einem indischen Zyklopen-Götzen das Edelsteinauge geklaut haben und nun kaum ihr panisches Fingernagelknabbern kaschieren können, da rächende Kultisten ihnen auf den Fersen sind, wie ein Gruselcomic aufnahm; bzw. mich daran vergnügte, mir vorzustellen, wie Harry Rowohlt diese Geschichte vortragen würde. (H.P.L. schreibt passend: Auch Humor und Ironie sind oft gegenwärtig, um einen saftigen Zynismus zu verbreiten und das abzuwandeln, was sonst wohl eine naive Intensität besäße.)
Resumee: Dunsany beschenkt seine Leser mit einer Phantastik, die sich sowohl für’s musenhafte Sichtreibenlassen eignet, die aber auch unseren Möglichkeitssinn beim Blick auf die tatsächliche Wirklichkeit schärft. Oder, um abschließend noch einmal Lovecrafts Worte als Bürgen zu bemühen:
Seine prismatisch schillernden Städte und seine noch nie dagewesenen Riten kennzeichnet eine Sicherheit, wie sie allein Meisterschaft erzeugen kann, und das Gefühl tatsächlichler Teilnahme an seinen heimlichen Mysterien läßt uns schaudern. Für wahrhaft phantasierende Menschen ist er ein Talismann, ein Schlüssel, der das Tor zur reichen Schatzkammer des Traumes und der versprengten Erinnerungen öffnet, so daß wir ihn nicht nur einen Dichter nennen können, sondern ihn auch für einen Autor halten dürfen, der jeden Leser ebenfalls zum Dichter macht.
•••
LINK-SERVICE
- Thomas Harbach für »SF-Radio«: Lord Dunsany gehört mit William Morris zu den frühen britischen Autoren, die eine Wiederentdeckung längst verdient haben. — Genau.
- Oliver Kotowski für »Fantasyguide.de«: Der Band »Das Land des Yann« ist ein großer Gewinn für Leser, die sich für die Entwicklungslinien der neueren Phantastik interessieren {…} Doch auch für einfach nur an Wundergeschichten Interessierte sind Lord Dunsanys Kurzgeschichten immer noch lesenswert, sowohl wegen seiner wahrhaft phantastischen Wunder, als auch wegen seines gekonnten Umgangs mit Erzählmustern.