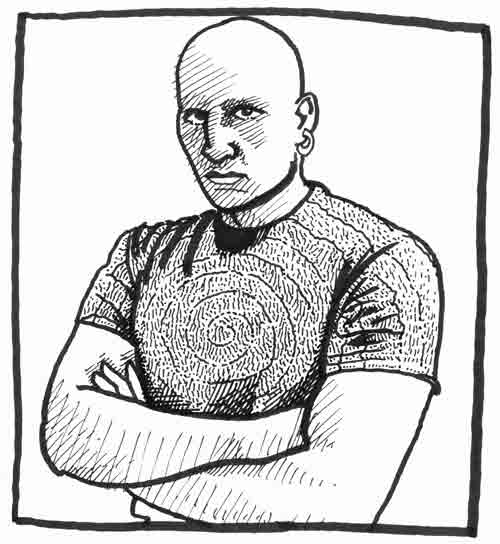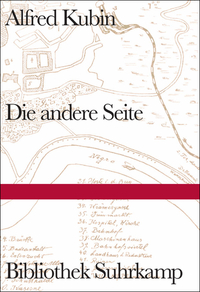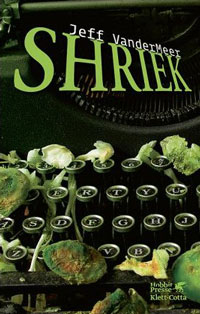Mal was neues, meint die freundliche Welt: Urban Fantasy
(Eintrag No. 570; Woanders, Phantastik, Fantasy, Urban Fantasy) — Schon wieder »Die Welt«. Diesmal jedoch mit einem ihrer Artikel aus der Reihe: »Wir erklären Euch die Phantastik«. (Wohl ein Beitrag aus der Elternratgeberreihe: »Was ist das für ein seltsamer Quatsch, den meine Kinder lesen?«)
Wieland Freund darf da im Text »Dumbledore fährt jetzt U-Bahn« kund geben, dass ›Urban Fantasy‹ die neueste Modewelle sei. Und Urban Fantasy liegt nach Freund vor, wenn die …
Pseudo-Mythologie der herkömmlichen Fantastik in die Metropolen getragen wird.
Aber, Freund liefert auch diesen schönen Satz:
»Zur sogenannten High oder Epic Fantasy {…} verhält sich die Urban Fantasy wie einstmals die Rolling Stones zu den Beatles.«
Passt aber irgendwie nicht. — Ich schlag mal den Vergleich vor, dass High/Epic Fantasy ist Enja und Clannad und Urban Fantasy ist Pouges und Bellowhead.
Kleine Korrektur: Jeff Vandermeers Roman »Shriek« spielt mitnichten zur Gänze in der fiktiven Zweitschöpfungswelt-Metropole Ambra. Es gibt in »Shriek« zum Beispiel ein Schlüsselkapitel, das im Waldumland der Kleinstadt Stockton spielt; ein anderes spielt in der mittelgroßen Stadt Morrow.
Seufzen lässt mich folgendes:
Ohnehin: die Keimzelle der Urban Fantasy zu suchen, ist in etwa so schwer, wie dieses fantastische Sub-Genre von anderen zu unterscheiden. Wo etwa fängt die Urban Fantasy an und wo hört der sogenannte Steampunk auf {…}
Da wird wieder mal stillschweigend so getan, als ob anständige Genrebegriffe klar abgrenzbar und eindeutig zu sein haben (und alles andere ist irgendwie subversiv, oder was). Nochmal: Genrebegriffe sind selten klar und einfach zu bestimmen, aber so gut wie immer eine Vereinfachung und Zurechtbiegung. Und: Einzelne Werke können sehr wohl mehreren Genres angehören. Wenn sich also gewisse Urban Fantasy wie Science Fiction lesen, ist das kein Problem, sondern ein ›Blickwinkel wechsel dich‹-Angebot.
Wiederum arg versimpelt:
Und auch Neil Gaiman {…} schreibt nicht explizit über Städte.
Und was ist mit Gaimans erstem Roman »Neverwhere«? Was mit seinen vielen »The Sandman«-Kapiteln und Handlungssträngen die in Städten spielen (ich erwähne nur Heft 51, weil ganz besonders exemplarisch: »The Tale of Two Cities« aus dem »Worlds’ End«-Sammelband).
Dann macht Freund Werbung für Jugendbuchneuerscheinungen die wohl nur erwähnenswert sind, weil sie vom gleichen britischen Lektor vermittelt wurden, der auch Rowling entdeckt und Funke ins Englische gewuppt hat.
Ansonsten aber keine Erwähnung von Michael de Larrabettis »Die Borribles«; kein Verweis darauf, wie Pratchett mit seiner Scheibenweltmetropole Ankh-Morpork reale Urbanitätseigenheiten (vor allem die Londons) satirisch-phantastisch aufs Korn nimmt; kein Wörtchen über Miéville und seine heftige Auseinandersetzung mit Städten in der Phantastik (mit London in »King Rat« und »Un Lun Don« und jüngst mit zwiestädtischen In- & Nebeneinander in »The City & The City«). — Dass in der »Die Welt« womöglich über solche Einflüsse und Entwicklungen berichtet wird, wie sie die »World of Darkness«-Rollenspiele darstellen, erwarte ich ja schon gar nicht mehr.
Also dann: bis zum nächsten Versuch, was rundum gescheites über Fantasy zu schreiben.
»Das Abenteuer Phantastik« aus »Kritische Ausgabe« (Sommer 2008)
 Eintrag No. 558
Eintrag No. 558
VORBEMERKUNG: Dieser Beitrag erschien in
»Kritische Ausgabe 01/2008: Abenteuer« und ich kann Marcel Diel gar nicht genug danken für sein enorm hilfreiches Lektorat. Noch immer bin ich ganz baff, dass dieser Text in so einem feinem Umfeld veröffentlicht wurde und ich habe
hier zum Erscheinen der »Abenteuer«-Nummer meine Freude und Begeisterung über einige der Beträge des Heftes mitgeteilt.
Um nun, ein Jahr nach Erscheinen des Textes, Euch Molochronik-Lesern (exklusiv) mehr bieten zu können, habe ich im Folgenden den Text um Fußnoten-Anmerkungen ergänzt. Es geht mir der Redlichkeit halber darum, meine Quellen zu offenbaren und um die These zu illustrieren, dass alle Texte immer auch ein Gespräch mit anderen Texten darstellen. Ich möchte nicht den Verdacht auf mich ziehen, ein originellerer Denker zu sein als ich bin.
Wer so viel Text nicht am Bildschirm lesen mag,
der kann sich mit dieser PDF-Version vergnügen.
•••
DAS ABENTEUER PHANTASTIK
Alle Leseerlebnisse reißen uns aus dem Fortlauf des Alltags. Wir treten heraus aus dem Zusammenhang des Hier und Jetzt und seiner Praxis-Zwänge und lassen uns auf eine zwischen Buchdeckel gebundene ›kleine Welt‹ ein, die nur mittels der magischen Kraft der Sprache in unserer Vorstellungskraft Gestalt annimmt. Dabei spielt es erstmal keine besondere Rolle, welches ›Wo‹ oder ›Wann‹ eine Geschichte beschwört: Ob man Kemal Kayankaya im zeitgenössischen Frankfurt bei seinen Detektivgängen begleitet oder mit Leopold und Stephen durch das Dublin des 16. Juno 1904 spaziert, ob man Quasimodos, Frollos, Pierres und Esmeraldas Schicksalswege im mittelalterlichen Paris verfolgt, ob man mit Frodo und Sam nach Mordor wandert, ob man die Marter von Winston Smith im Folterzimmer 101 des Ministeriums für Liebe miterleidet oder mit Hans Castorp bei seinem Sanatoriumsaufenthalt Ski fahren geht, niemals befindet man sich in der tatsächlichen Wirklichkeit, sondern immer tritt man durch einen Zauberspiegel in eine Welt der Sprache.[01] Die Leser entscheiden selber, ob sie die jeweiligen Angebote des Übertritts in eine narrative Welt als Ex-und-Hopp-Vergnügen nutzen, als Streichholz oder Fahrkarte die nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden, oder ob sie im Laufe der Zeit immer wieder zu bestimmten Schatzkästlein des Erzählens zurückkehren, um sich einen gediegenen eigenen Erinnerungspalast der Imagination einzurichten, den man als privates Hobby oder zum geselligen Austausch pflegt.[02] Grenzen zu verwischen scheint deshalb erstmal nötig, soll ein umfassender Blick auf das Abenteuer der Phantastik gewagt werden.
Immerhin herrscht einige Verwirrung zu dieser facettenreichen und umstrittenen Spielart der Literatur, was wohl schon darin gründet, dass ›phantastisch‹ und ›Phantastik‹ mit vielerlei Bedeutungen belegt werden, sich aber kaum jemals auf die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs besonnen wird. Etymologisch steckt nichts anderes hinter diesen Wörtern, als der Vorgang und die Gabe, Dinge ›sichtbar zu machen‹, ›sehen zu lassen‹, vor dem geistigen Auge der Vorstellungskraft ›erscheinen zu lassen‹. Durchaus nachvollziehbar sind dabei sowohl das Misstrauen und die Zurückhaltung, mit der Phantastik von den Kreisen der so genannten ernsten, hohen, relevanten Literatur beäugt wird, als auch die leidenschaftliche Begeisterung, mit der sich viele, darunter vor allem viele junge Leser des breiten Publikums willig auf die Abenteuer der Phantastik einlassen. Richtet man sein Augenmerk auf den Umstand, dass bei der Phantastik immer schon der Weltenbau selbst zum Gegenstand kreativer Machenschaften wird, ahnt man, dass diese seltsamen Fiktionen der Phantastik unerhörter- oder bezaubernderweise mehr zu leisten vermögen als die realistischen Erzählweisen der mimetischen Fiktionen. Die realistischen Modi mäßigen sich freiwillig dazu, lediglich zu erzählen, was ›geschehen ist‹ oder ›so hätte geschehen können‹. Jegliches Enerzählen, besonders aber die Phantastik nimmt sich außerdem heraus, von Dingen und Geschehnissen zu handeln, die so ›nie hätten geschehen können‹ oder die ›geschehen könnten, wenn …‹ oder reichert den Wirklichkeitsbau ihrer Fiktionen darüber hinaus merklich an mit Auswirkungen ästhetisch-ethischer Prämissen dazu, wie die Welt ›sein sollte‹ oder ›nicht sein sollte‹.[03]
Das Unternehmen, Phantastik kristallklar zu bestimmen mag löbliche Aspekte haben, und so berechtigt oder verständlich verschiedene Strömungen der entsprechenden Versuche scheinen, so beengend geraten dann am Ende die meisten ihrer Ergebnisse. Die sogenannten minimalistischen Definitionen ermöglichen zwar auf den ersten Blick die schlüssigere Handhabe, wenn sie einerseits eine tatsächliche, objektive ›die Welt ist, was der Fall ist‹-Wirklichkeit annehmen, um dann solche Fiktionen den phantastischen Gattungen zuzuordnen, in denen Unwirkliches, Irrationales, Wundersames, kurz: ›von der objektiven Faktenwirklichkeit abweichende‹-Seltsamkeiten ungestüm herumtollen.[04] Doch dieses Sprechen über Phantastik gerät schnell zu einer heiklen Angelegenheit, denn schenkt man der beunruhigenden Feststellung Glauben, dass vor allem die kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und historischen Wahrheiten immer und überall gleich, nämlich unbekannt sind, tritt die Phantastik eher früher als später als mächtigstes, zugleich aber zwielichtiges Fundament all unseres Wünschens und (Ver-)Handelns zu Tage. Deutlich zu kurzsichtig ist es nämlich, Fiktionen nur auf ihr Verhältnis zur objektiven Tatsächlichkeit der äußeren Welt abzuklopfen, und die trügerischen Sphären der ideologischen, kulturellen und inneren Erlebniswelten zu vernachlässigen. Für den jeweiligen Leser ist es erkenntnistheoretisch zweitrangig, ob die Protagonisten einer abenteuerlichen Geschichte auf Drachen und Einhörnern durch exotische Arkadien- und Inferno-Gefilde reisen oder ob der Weg des Helden in vermeintlich realistischen Abenteuern durch die Graubereiche führt, welche die himmlischen Luxus-Milieus der Reichen und Schönen mit denen der kriminellen Unterwelt verbinden.
Schließlich können sich alle Fiktionen, alle Erzählungen, seien sie realistisch-tatsächlichkeitsnah oder wundersam-seltsamkeitssüchtig, nur Fragmenten der sogenannten Wirklichkeit widmen und vermögen den Effekt einer mit Absolutheitsanspruch auftretenden Welterfahrung lediglich durch Tricks zu beschwören, und egal, ob sie mehr in den geplant konstruierten Häfen der Ratio und des Logos ankern oder frei in den Gewässern der Affekte und des Mythos flottieren, die individuellen Horizonte bleiben immer begrenzt und endlich. Damit sollen die mehr oder minder strengen strukturalistischen Erkenntnissätze der minimalistischen Sichtweise nicht komplett verschmäht werden, denn erst, indem sie konsequent die Belange existentialistischer Probleme verfehlen und die Flexibilität von Leserhaltungen übersehen, vermögen sie eben auf die blinden Flecken der Erkenntnisfähigkeit selbst aufmerksam zu machen. Die Redlichkeit der minimalistischen Definitionsmissionen gründet auf der Ernsthaftigkeit, die bei ihnen zu Tage tritt, wenn zugegeben werden muss, dass es zwar in der Vorstellung und Sehnsucht unzählige, ja unendlich viele Möglichkeiten gibt, aber eben nur so lange, wie man keine konkreten Entscheidungen treffen muss.
Der sogenannte maximalistische Ansatz zur Beschreibung dessen, was Phantastik ist, erkennt das Dilemma an, dass der Horizont des als gesichert gewähnten Wissens wenig stabil ist, und bietet eine größere Auswahl an locker verhandelbaren Schubladen zum Sortieren der phantastischen Erzählweisen an. Legt man zur groben Orientierung eine historische Zeitachse an das Spektrum der Phantastik, bietet sich die vertraute Fächer-Trias der Science-Fiction (Zukunftswelten), des Horrors (beängstigende Welten) und der Fantasy (Vergangenheitswelten) an, und bei allem, was sich nicht eins-zwei-drei dort einordnen lässt, kann man getrost den Schirmbegriff Phantastik anwenden. Der maximalistische Ansatz versucht also oft gar nicht erst, eine fitzelige Hierarchie anzubieten, dergemäß verschiedene Erzählweisen der Phantastik in unterschiedlicher Nähe oder Ferne zu der ziemlich abstrakten Idee eines Konsens-Realismus liegen. Der Preis, den der maximalistische Ansatz dabei entrichten muss, ist der Makel des Schwurbelns. Kein Zweifel: Beide Ideenschulen der Phantastik, minimalistische und maximalistische, kneten zurecht und vereinfachen dabei, aber letztere springt wenigstens beherzt ins lebhafte Fruchtwasser der erzählenden und bilderschaffenden, kurz: der mythischen Kreativität. Und mythisch wird es, sobald Menschen so unbescheiden sind und zur Sprache zu bringen trachten, was jenseits der Sprache liegt. Wenn also nicht geschwiegen wird, wovon sich nicht klar und wohldefiniert kommunizieren lässt. Egal, ob dabei als Mittel des Erzählens eine biegsame und registerreiche Sprache, das Über- und Untertreiben und Neuerfinden von Eigenschaften und Kausalitäten oder die metaphorische Transformation und Übertragung angewendet wird, im Grunde kommt am Ende immer Phantastik heraus. Ob es sich dabei im Speziellen um Grotesken, Satiren, Weltraumopern, heroische Romanzen, düstere Intrigen-Thriller oder historische Konspirationsstoffe handelt, mag eine reizvolle Denksportaufgabe sein, aber ernsthaftes Interesse daran, dass möglichst enge Genre-Eingrenzungen gelten, können nur Vermarkter stromlinienförmiger Formel-Fiktionen sowie jene haben, deren bevorzugte Nischen-Stoffe ohne Nobilitierungsstützen in der globalen Narrationskonkurrenz in die Stillstandszonen abgedrängt werden.
Soweit es sich übers Knie brechen lässt, kommt das gemeine Publikum besser mit dem maximalistischen Ansatz zurecht, denn es kann im Großen und Ganzen wohl unterscheiden zwischen den beunruhigenden Herausforderungen des in der politischen Wirklichkeit stattfindenden Zwistes der konkurrierenden ideologischen Phantasmen und der eigenen Wohlfühlpraxis, sich mit Hilfe einer erzählenten Fiktion vom Alltag zurückzuziehen, um neue Kraft zu schöpfen oder überschüssige Energien abzufackeln. Das Publikum ist gemeinhin zufrieden damit, sich bei der Lektüreauswahl zu orientieren an der groben Unterscheidung zwischen den realistischen Fiktionen, die auf dem Boden des gegeben Möglichen bleiben, und den phantastischen, die mit kräftigeren Prisen des Seltsamen das Staunen und Träumen im großen Maßstab ermöglichen.
Phantastik und Pathos haben dabei viel miteinander gemein, da beide mit ihrer Faszinationskraft die Gefühle und Leidenschaften in ihren Bann zu ziehen verstehen, und beide können dazu dienen, alte oder neue Gemeinschaftswelten zu propagieren.[05] Wie gesagt, ist es verständlich, wenn jene, die das Privileg genießen, als Sachwalter und Priester der Literatur zu agieren, aufgrund der mit dem Geschichtenerzählen einhergehenden Verantwortung dazu neigen, vor allzu heftigen Fiktionsmodi zu warnen. Natürlich wäre es eine feine, jegliche Gesellschaft von ziellosen Trieben entgiftende Angelegenheit, wenn alle Leser sich darauf beschränkten und Geschichten nur deshalb läsen, um in narrativen Imitationen des Lebens verstehen zu lernen, welche Ursachen und Folgen verschiedene Erfahrungen, Meinungen, Affekte und Handlungen haben.[06] Aber der distanzierte Blick auf die Figuren einer Erzählbühne allein ist eben nur wenigen genug, und so verlangt auf vielfache Weise auch das Bedürfnis nach Identifikation und Miterleben nach Befriedigung. Doch damit nicht genug, locken eben doch auch ganze Welten und warten darauf, durchwandert, gelesen erkundet, erobert zu werden, ohne dass man sich mit großen Aufwand äußerlich einem Lifestyle anpassen, geschweige denn, sich wirklich als Abenteurer in die Wildnis aufmachen muss. Lesend begibt man sich als modernes Langeweilopfer eben gern in Gefahr.
Leben findet immer nur im Moment des Jetzt und Hier statt, in einem auf dem Wirbel aus Zeit und Raum treibenden Augenblick, einer kleinen Welt der intimen, intensiveren Bande, durch welche die eigene Person mit der sie umfassenden Gruppe und Kultur verkettet ist. Hier teilt man Werte der überschaubaren Gemeinschaft, des Stammes, Clans, der Familie, der Arbeitskollegen, der Nachbarschaft. Hier herrschen die tribalistischen Werte, mit denen diese Untergruppen sich stabilisieren gegenüber den überwältigenden und unübersichtlichen Faktenstrudeln und Meinungsstürmen. Die entsprechenden Zusammengehörigkeitsmythen werden oftmals als spießig, altmodisch, beschränkt und einengend bezeichnet oder empfunden, wenn die ständige Beäugung durch die eigene ›Peer Group‹, durch den eigenen Stamm die Luft zum Atmen abschnürt, wenn Rücksichten in Belastungsprüfungen umschlagen, wenn die Vergleichs-Animositäten und wilden Gerüchte zu ›Bei uns hat man das immer schon so gemacht‹- und ›Wo kämen wir denn da hin‹-Kerkern werden. Hier drohen Puristen unterschiedlichster Couleur für ihre Zwecke das Individuum einzuspannen und gemäß ihren Prämissen organisieren und formatieren zu wollen.[07]
Glücklich in dem einbettenden Gefäß ihrer kleinen Welten bleiben jene, die niemals auszubrechen trachten aus ihrem Milieus. Wenn niemals Not und Mangel oder die Verführungen des Übermutes und des Leichtsinns sie nach eigenen kräftigen Sinnes- und Tatleistungen streben lassen, können sie ebenso gut bequem Hause bleiben im Nahen und Bekannten. Ja, gesegnet sind sie, wenn niemals der Hunger nach Abenteuer oder eine Gefahr sie aus dem übersichtlichen Gehege treibt und das Vertraute immerdar genug Sicherheit, Erfüllung und Kurzweil liefert.
Doch auf der begrenzten Kugeloberfläche des Planeten Erde mit seiner dünnen menschenfreundlichen Schicht wird der Platz immer enger, und die gegenseitige Umzingelung des Menschen durch den Menschen[08] bei seiner Suche nach Sicherheit und Innigkeit wird von Spannungen und Gefahren begleitet, erschüttert mit Konflikten die immer nur vorübergehenden Sicherheiten der kleinen Gemeinschaften und zwingt sie dazu, ihre Perspektiven, ihre kleinen Erzählungen anzupassen. Kein Wachstum ohne Schmerzen, keine Neuformungen und Verschmelzungen ohne Auflösung der althergebrachten Formen, und die damit einhergehenden Belastungsprüfungen lassen die Einfassungen der kleinen Gruppen undicht werden. Der hereinbrausende bedrohliche Sturm der Außenwelt zwingt die Aufmerksamkeit dazu, anzuerkennen, wie gering die Kontrolle über das tatsächliche Tohuwabohu ist.
Jenseits der Ränder der Nestgemeinschaft und noch vor der Wahnsinn evozierenden Unwirtlichkeit des kosmischen Grauens aber betritt man erst einmal die konfusere, relativierende Ebene des Gewirrs von Gruppen, einem Durch- und Mit- und Gegeneinander von vielen Untergruppen mit ihren jeweiligen Traditionen, Geschichten und Interessen. Die entsprechenden, arg in Verhandlung und deshalb Wandlung befindlichen Globalmythen werden von den Kleingruppen oftmals als flach, beliebig, leer degradiert. Da erklingen dann die Vorwürfe gegenüber der Moderne oder Postmoderne, nur substanzloses Einerlei zu bieten, man schreckt zurück vor den Gefahren des Nihilismus, der Entmutigung angesichts von Entfremdung durch zweckrationalistische Machenschaften. Betrachtet man von diesem wuseligen Bazaar des Pluralismus aus die kleinen Nischen-Welten der Untergruppen, erscheinen letztere bei all dem Halt, den sie zu bieten vermögen, schlimmstenfalls als engstirnig, bestenfalls als unterhaltsam schrullig.[09]
Zwischen den verschiedenen eng und weit gefassten Wirklichkeitsperspektiven stößt man auf zig Grenz- und Übergangsbereiche, die mal als firmere Barrieren, mal als fließendere Passagen erlebt werden, und alle Menschen sind mehr oder weniger ständig unterwegs auf einer ›Queste‹, um in eigener oder gemeinschaftlicher Ambition symbiontische, mutualistische und parasitäre Arrangements zwischen verschiedensten Hübens und Drübens zu etablieren. Das intimste ›Hier‹ und ›Drinnen‹, in dem wir sind, stellt der eigene Körper dar, das klar gefasste Ich der eigenen Person. Das größte ›Drüben‹ oder ›Draußen‹, dem wir gegenüberstehen, ist der endliche Planet, den wir miteinander teilen, und das Universum, durch den dieser kreist. Beide Welten können wir mit Hilfe der Phantasie ergründen. Die Geheimnisse der äußeren Welt mühen wir uns mit Hilfe der objektiven Phantasie zu lüften, und der Aufstieg dessen, was man moderne Zivilisation nennt, legt umfassend Zeugnis davon ab, wie erfolgreich hier die Mächte des ›Sehenlassens‹ sind, wenn es gelingt sie in offenen und zugleich strengen Prozessen aufeinander abzustimmen und auszudifferenzieren. Doch wo einerseits die objektive Phantasie über die Materie triumphiert und einer sagenhaften Vermehrung des Komforts förderlich ist, haben andererseits die allzu separatistischen Terrains der subjektiven Befindlichkeitsphantasie, vor allem ihre anthropozentrischen und elitaristischen Seiten, Demütigung und Erschütterungen erlitten.
So pokern bei dem ›Ideenkrieg um das Sein‹[10], wenn sich widersprechende Ansichten und Ambitionen aufeinanderprallen, Gesellschaften vor allem um die Deutungs- und Gestaltungshoheitsposten, wie denn mit der brodelnden und wilden Phantasie-Fähigkeit der Menschen umgegangen werden soll und wie sich Ordnung schaffen lässt in diesem Dschungel aus verführerischen Hirngespinsten, faszinierenden Seltsamkeiten und erhellenden Veranschaulichungen. Die Phantasie und die mit ihr fabrizierte Phantastik sind immerhin schillernde, trügerische Angelegenheiten und deshalb oftmals scheel beäugt, zum einen, weil sie das irre Lodern des Aberglaubens anfachen und Blicke irreleiten können, zum anderen, weil sie die Aufmerksamkeit des Möglichkeitsdenkens auf Dinge zu lenken vermögen, welche von den Betreibern umfassender Projekte und Missionen im Geheimen oder in Verkleidung reibungsloser bewerkstelligt werden können. Bevor man gemeinschaftlichte Tatanstrengen angepacken kann, müssen Visionen geteilt und Träume aufeinander abgestimmt werden, und so tasten sich Leseabenteurer mit Hilfe von Geschichten an Ideale heran oder lernen ihnen zu misstrauen — Ideale die zum Beispiel bestimmen (wollen), was Elite, was das Wahre, Schöne, Gute sei, die Geschlechter- und Klassenrollen beschreiben, wie auch Körper-, Kindheits-, Jugend- und Partnerschaftswelten und Tausenderlei mehr.
Platon schrieb zwar, dass die Götter mit ihren Zeichen, die sie erscheinen lassen, nicht lügen, aber dennoch trennte er z.B. mittels seines Höhlen- und Sonnengleichnisses zwischen dem Wissen für die Masse (d.h. diejenigen, die nur die in einer Höhle aufgeführten Schattenspiele deuten können) und dem für die Eliten (die sich in Zwiebelschalen-Hierarchie um eine Wahrheitssonne tummeln). Der Ernstfall gewährt zuallermeist weder genug Zeit noch Ressourcen, um Entscheidungen friedlich auszudiskutieren, oder um eine musikalische Metapher zu bemühen: das freie Improvisieren ist das Privileg des Einzelnen oder einer kleinen Gruppe virtuoser Könner, vielköpfige Symphonik aber braucht erste Geiger und Dirigenten. Kein Wunder also, dass sich im Zentrum des Meinens und Streitens über Wert und Unwert der Phantastik immer wieder Fragen zu der Verantwortung gegenüber der Wirklichkeit und der Flucht vor derselben finden lassen.
Bei diesem ›Ideenkrieg um das Sein‹ geht es um nichts weniger als die konkret miteinander konkurrierenden Projekte der Gestaltung der Wirklichkeit, es geht darum, wer Architekt von Fundamenten und Navigator von Zielen sein darf, wer welche Stücke vom gebackenen oder erbeuteten Kuchen bekommt, und nicht zuletzt darum an wem die Drecksarbeit hängen bleibt von der zu sprechen oft schon genügt, um den Geistern des Unfriedens Tür und Tor zu öffnen. Die Konvention der guten Botschaften über gloriose Vergangenheiten oder edle Zukunftsprojekte verlangt, dass man die unangenehmen Facetten der eigenen Ambitionen unter den Teppich kehrt oder wiederum umgewendet als etwas Edles, Supremes postuliert. Doch der Globus ist lange schon vernetzt genug, als dass sich Rückmeldungen über die Folgen der miteinander konkurrierenden Exklusivitätsbestrebungen längerfristig unterdrücken oder ausblenden ließen, und so strebt die Schwarmintelligenz Menschheit danach ihre bellezistischen, elitären und pofitmaximierenden Tatunholde, ihre schauerlichen Unterweltmonster und die beschähmenden Opferkrüppel zu integrieren in der moderaten Masse des Allerweltstages. Solange ein Mensch nicht fix darauf programmiert ist, freiwillig und wissend wie ein Apostel oder unfreiwillig und blind wie ein Golem der weisenden Stimme seiner Herren zu folgen, solange genießt der Einzelne das Privileg bzw. muss mit der Zumutung zurechtkommen, selbstständig auf diesem Ozean der Überlieferungen, Meinungen, Visionen und Missionen zu navigieren. Wir alle sind dabei weniger vereinzelte Inseln als vielmehr Schiffe mitsamt ihrer Besatzung, oder um ein klassisches Fabelwesen als Metapher zu bemühen: wir alle sind Zentauren, eine Verschmelzung von Reittier und Reiter, und können nur dann mächtige Jäger, fähige Heiler und findige Spurenleser sein, wenn Tier und Mensch als Einheit miteinander auskommen, oder um diesen Gedanken durch die futuristische Metaphernmangel zu drehen: die Verschmelzungen von Mensch und Technik werden schon lange so heftig herbeigesehent, dass moderne Personen zu Cyborgs mutieren (wer dies nicht gleich radikal am eigenen Körper tut, ist durch die modernen Lebensumstände doch angehalten, sich als zumindest als organischer Teil einer Maschine-Mensch-, Computer-Person-, Fahrzeug-Lenker-Zwei-Einheit zur Verfügung zu halten).
Ginge es bei Phantastik nur um Kinkerlitzchen der Ästhetik, nur um harmlosen Kokolores des Geschmacks, würden sich die Gemüter beim Austausch ihrer Pro- und Contra-Argumente zur Phantastik kaum so erhitzen. Sorge ist durchaus angebracht, wenn Phantastik durch Kulturindustrie- oder Kulturestablishment-Routinen zu Schablonen-Fiktionen ausartet, die, statt zur Aufmerksamkeit und Reflexion zu ermuntern, Passivität und Gleichgültigkeit befördern, wenn Leser sich nicht lustvoll und erkenntnishungrig in einem aus Sprache hingezauberten Bedeutungslabyrinth verirren sollen, sondern eben Reizformeln zur Anwendung gelangen, die als Erwartunghaltungs- und Vorurteilskristalle gehandelt und als Vorstellungscrack konsumiert werden. Die hierbei durchschimmernde Rivalität ist alt, die Reibungen zwischen den Anhängern des Realismus und der Phantastik sind nur ein modenes Echo des Stampfens und Klatschens des alten Watschentanzes der Parteigänger von Logos und Mythos, derjenigen, die für möglichst viele einsehbar im Offenen die gemeinsamen Angelegenheiten verhandeln wollen, und jenen, die mit Blendwerken unhinterfragter Zauberspektakel von ihren hinter den Kulissen ablaufenden Klüngeleien abzulenken gedenken. Gesellschaften funktionieren nur, wenn es gelingt, die Unruhe des diskursiven Verhandelns und die Stabilität von ›Basta!‹-Tabus ins Gleichgewicht zu bringen; und dazu braucht es Individuen die sowohl ihre objektive als auch ihre subjektive Phantasie anhand von Geschichten schärfen können, sodass es möglichst vielen gelingt, zusammen eine große Geschichte miteinander zu fabulieren. Das bedeutet nichts weniger, als eine hinter vorgehaltener Hand geteilte Erkenntnis der Alten zum Allgemeingut zu erheben: dass Phantastik nicht zuletzt das Prinzip der Politik ist.
•••••
ANMERKUNGEN:
[01] Die genannten Protagonisten treten auf in folgenden Romanen:
Kemal Kayankaya in den Krimis von Jakob Arjouni
»Happy Birthday, Türke« (1985),
»Mehr Bier« (1987),
»Ein Mann ein Mord« (1991),
»Kismet« (2001), alle erschienen im Diogenes Verlag. —/—
Leopold Bloom und
Stephen Dedalus sind die beiden mänlichen Helden in
»Ulysses« (engl. 1921 / dt. von Hans Wollschläger 1975) von James Joyce, deutsch erschienen im Suhrkamp Verlag. —/—
Quasimodo,
Claude Frollo,
Pierre Gringoire und
Esmeralda sind Figuren aus dem Roman
»Der Glöckner von Notre Dame« (franz. 1831 / dt. von Hugo Meier 1986) von Victor Hugo. Ich bevorzuge die Ausgabe bei Manesse Bibliothek der Weltliteratur. —/—
Frodo Beutlin und
Sam Gamschie sind die Hobbit-Helden in
»Der Herr der Ringe« (engl. 1954/55) von J. R. R. Tolkien, Deutsch erschienen bei Klett-Cotta. Ich vevorzuge die alte Übersetzung von Margaret Carroux die 1980 erschien. —/—
Winston Smith ist die arme Sau in
»Neunzehnhundertvierundachtzig« (engl. 1948) von Geroge Orwell. Ich bevorzuge die Übersetzung von Kurt Wagenseil, die 1983 bei Diogenes erschien. —/—
Hans Castorp ist die Hauptfigur in
»Der Zauberberg« (1924) von Thomas Mann, erhältlich als Fischer Taschenbuch. •••
Zurück
[02] Die Metapher von Lektüren als (entweder) Fahrkarte & Streichholz (oder) Einrichtung & Inventar eines Gedankenhauses- bzw. Schatzkistchens habe ich von
»An Experiment in Criticism« (engl. 1961) Clive Stapelton Lewis entliehen. Deutsch 1966 als
»Über das Lesen von Büchern – Literaturkritik ganz anders« in der Herder-Bücherei erschienen, übersetzt von Hans Schmidthüs. •••
Zurück
[03] Bei der Aufzählung verschiedener Modi von Fiktionen bezüglich ihrer Haltung zur ›tatsächlichen‹ Wirklichkeit folge ich dem enormen Blogeintrag
»Narrative Grammars« von Hal Duncan, Autor von
»DAS EWIGE STUNDENBUCH«; Band 1:
»Vellum« (engl. 2005 / dt. 2008), Band 2:
»Signum« (engl. 2007 / dt. 2009), kongenial übersetzt von Hannes Riffel. •••
Zurück
[04] Die Umschreibung
›die Welt ist was der Fall ist‹-Wirklichkeit fusst natürlich auf Ludwig Wittgensteins
»Tractatus Logicus Philosophicus« (1921). —/— Die dann beschriebene Trennung ist eine heftige Zusammendampfung der Thesen von Tzetvan Todorovs in
»Einführung in die Fantastische Literatur« (franz. 1970; dt. 1972). •••
Zurück
[06] Zur Aufgabe von Drama und Fiktion habe ich mich leiten lassen von den Ausführugen über den ersten bekannten Literaturtheoretiker & -Kritiker, den Inder Bhamaha, in Peter Watsons
»Ideen – Eine Kulturgeschichte von der Entdeckung des Feuers bis zur Moderne« (engl. 2005 / dt. von Yvonne Badal 2006), C. Bertelsmann Verlag, Seite 466. •••
Zurück
[07] Reichlich flappsige Paraphrase von Ausführungen, die ich entliehen habe aus Ted Hughes Aufsatz
»Mythen und Erziehung« (
»Myth and Education«, 1976) aus dem Essay-Band
»Wie Dichtung entsteht« (ausgewählt und übersetzt von Jutta Kaußen, Wolfgang Kaußen und Claas Bazzer), Insel Verlag 2001, Seite 76ff. •••
Zurück
[08] Diese wundervolle Formulierung habe ich von Peter Sloterdijk. Das Zitat lautet im Ganzen:
All diese Ideen {Vorstellungen von einer Aufhebung & Überwindung des Weltzustandes mittels Erlöserreligion, Weltflucht, Nihilsmus und Utopismus} bezeugen durch ihr Alter und ihre beharrliche Wiederkehr ein Kontinuum revolutionärer Spannungen: seit mehr als zweitausend Jahren erzeugt die Umzingelung des Menschen durch den Menschen heftige Brüche mit den Zwangssystemen mythischen Herkunftsdenkens.
in:
»Weltfremdheit« (Suhrkamp 1993), Seite 55 (Erster Aufsatz
»Warum trifft es mich?«, Kapitel 3:
»Das umzingelte, das harte, das deprimierte Selbst«). •••
Zurück[10] Die Phrase vom ›Ideenkrieg um das Sein‹ beruht auf einer (durch Gedächtisschlamperei verursachten) Variation einer Stelle aus Peter Sloterdijks Werk »Sphären II: Globen – Makrosphärologie« (Suhrkamp 1999). Der mich angeregt habende Abschnitt lautet:
Die gedachte wahre Welt wirft der bloß wahrgenommenen wirklichen Welt den Handschuh hin. {…} Von ihm {Platons Text »Timaios«} her beginnt der ideologische und technische Umbau des Seienden. Es ist offenkundig geworden, daß die Welt selbst nicht eine differenzlos einfache und einstimmige ist und daß, wer Welt sagt, wissenschaftlich oder nicht immer schon Welt-Unterscheidung oder Welt-Krieg meint. Der schon von Platon völlig realistisch als »Gedankenkrieg um das Sein« charakterisierte Urstreit, einmal ausgebrochen, erlaubt es niemanden, sich zum Nicht-Kombattanten zu erklären; in diesem Krieg sind alle Partei, auch jene Naiven, die vorgeben, nicht zu wissen, worum es geht.
Jeff Vandermeer: »Shriek«, oder: Geschwisterringen, Krieg und Rätsel im Untergrund
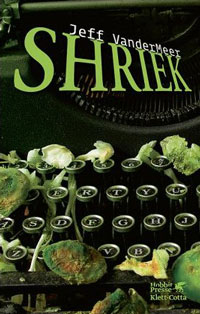 Eintrag No. 554 — Jeff Vandermeer (*1968) hat mich bereits mit seinem Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (= »SDH&V«) angenehm überrascht, genussvoll verwirrt, sprich: reichlich beglückt. Was für eine wohltuende Abwechslung, wenn in einer phantastischen Zweitweltschöpfung nicht Krieger, Magier, Diebe, Heiler und die anderen üblichen Berufsabenteuerpappfiguren im Mittelpunkt stehen. Nein, mit »SDH&V« bot Vandermeer Fantasy (er selbst bezeichnet seine Sachen, trotzdem er Nordamerikaner ist, lieber als Magischen Realismus) über Bücherwürmer, Künstler, unglücklich Verliebte und Anstalltsinsassen an, und statt Trollen, Elfen, Orks und Drachen gabs Masken tragende Verschwörer, Irre, Pilzmenschen und Riesentintenfische als Monster und Exoten.
Eintrag No. 554 — Jeff Vandermeer (*1968) hat mich bereits mit seinem Collageroman »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« (= »SDH&V«) angenehm überrascht, genussvoll verwirrt, sprich: reichlich beglückt. Was für eine wohltuende Abwechslung, wenn in einer phantastischen Zweitweltschöpfung nicht Krieger, Magier, Diebe, Heiler und die anderen üblichen Berufsabenteuerpappfiguren im Mittelpunkt stehen. Nein, mit »SDH&V« bot Vandermeer Fantasy (er selbst bezeichnet seine Sachen, trotzdem er Nordamerikaner ist, lieber als Magischen Realismus) über Bücherwürmer, Künstler, unglücklich Verliebte und Anstalltsinsassen an, und statt Trollen, Elfen, Orks und Drachen gabs Masken tragende Verschwörer, Irre, Pilzmenschen und Riesentintenfische als Monster und Exoten.
Zweifelsfrei haben Leser die »SDH&V« bereits kennen einen gewissen Vorteil, wenn sie sich nun »Shriek« widmen, denn sie sind dann bereits mit mit vielen (Neben-)Figuren und wichtigsten Eckdaten und Eigenarten des Weltenbaues um die quirrlige, heftig zwischen Pracht & Dekadenz, Macht & Verfall schwankenden Stadt Ambra vertraut. Jedoch bin ich nicht wie manche andere Rezensenten der Ansicht, dass es zwingend notwendig ist, »SDH&V« gelesen zu haben um »Shriek« genießen zu können. Immerhin muss man sich auch bei historischen Stoffen und/oder solchen Geschichten, die in unvertrauten realen Weltgegegenden angesiedelt sind erstmal mit einiger Geduld einlesen, um Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen.
Um den Einstieg für unwissende aber neugierige Leser zu erleichtern, hier das mindeste, was man über Vandermeers Ambra-Fantasywelt wissen sollte, egal zu welchem der beiden man zuerst greift. Wer sich bereits auskennt, kann den nun folgenden in Klammern stehenden Absatz überspringen.
{Ursprünglich hieß Ambra Cinsorium und war das blühende Kulturzentrum eines Volkes kleiner Pilzmenschen (die sogenannten Grauhüte), bis der im mächtigen Mündungsdelta des Mott-Flusses gelegene Ort von Piraten-Kaufleuten (den Katten) entdeckt und in gut räuberisch-›merkantil-imperialer‹ Manier erobert wurde. Die Katten metztelten die Grauhüte nieder, die sich daraufhin größtenteils in den Untergrund der Stadt zurückzogen. Einige Jahrhunderte später kam es zu einem monströsen Zwischenfall, der ›Stille‹, bei der über Nacht an die fünfundzwanzigtausend Einwohner von Ambra spurlos verschwanden. Keiner weiß, was da genau geschehen ist, aber man munkelt, dass es sich bei der Stille um einen Racheakt der Grauhüte handelte. Wie harmlos & unzivilisiert oder durchtrieben & mächtig die Grauhüte wirklich sind, ist ein heftig umstrittenes Rätsel für die Bewohner von Ambra. — Ambra selbst ist berühmt berüchtigt für seine Pluralität. Neben den größten monotheistischen Gemeischaften – der quasi-katholischen Truffidischen Kirche und dem rattenverehrenden Maniziismus – tummeln sich in Ambra die Anhänger hunderter verschieder Kulte und Sekten. Lediglich bei den Ausschweifungen des jährlichen Festes des Süßwasserkalmars kommt es immer wieder zu unfeinen Gewaltausbrüchen. Mit schon an religiöse Inbrust gemahnender Heftigkeit verehren die Bewohner von Ambra ihre Künstler und Gelehrten (zum Beispiel den Komponisten Voss Bender oder den Maler Martin See). Die großen politischen und gesellschaftlichen Spannungen werden gespeißt durch die Reibungen zwischen dem Stadtstaat Ambra und seinen Nachbarn (z.B. dem Kalifat des Westreiches, sowie den vielen zersplitterten Überbleibseln des zerbrochenen Saphantenreiches), sowie durch die Konkurrenz der beiden dominantesten Handelshäuser: den Kattenabkömlingen ›Hoegbottem & Söhne‹ und den von der Stadt Morrow operierenden ›Frankwrithe & Lewden‹.}
 Keineswegs abwegig ist die These, dass »Shriek«, was seine Struktur betrifft, die leichtere Erstlektüre die Welt von Ambra betreffend ist. Verglichen mit dem aus mehreren Kurzgeschichten, einem wilden Anhang-Mischmasch und einem Glossar bestehenden »SDH&V« ist »Shriek« nämlich eigentlich ein Spaziergang. ›Eigentlich‹, denn auch diesmal ließ sich Edelfeder Vandermeer einiges einfallen, um dem Roman eine spezielle Komplexitätsglasur zu verleihen.
Keineswegs abwegig ist die These, dass »Shriek«, was seine Struktur betrifft, die leichtere Erstlektüre die Welt von Ambra betreffend ist. Verglichen mit dem aus mehreren Kurzgeschichten, einem wilden Anhang-Mischmasch und einem Glossar bestehenden »SDH&V« ist »Shriek« nämlich eigentlich ein Spaziergang. ›Eigentlich‹, denn auch diesmal ließ sich Edelfeder Vandermeer einiges einfallen, um dem Roman eine spezielle Komplexitätsglasur zu verleihen.
Größte Auffälligkeit und Umstädlichkeit ist, dass der Text des Romanes von zwei Personen — Janice Shriek und ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Duncan — verfasst und von dem Herausgeber Sirin redigiert wurde. Die alte Janice hat sich in einem Hinterzimmer der Kneipe ›Spore des Grauhuts‹ breit gemacht und tippt dort auf einer Schreibmaschine (siehe Umschlagsbild) ein Nachwort zu dem letzten Buch ihres Bruders: »Hoegbottoms Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra«. Wobei ›Nachwort‹ eine Bezeichnung ist, die Janice selbst im Laufe des Textes anzweifelt, denn das, was sie da schreibt, ist weit mehr als das. Ihr Text ist:
- ein anklagend-verzeihender Nachruf auf ihren vor einiger Zeit verschwundenen Bruder und eine rotzig-sentimentale Autobiographie;
- eine gallige Abrechnung mit all jenen, die Duncan und sie im Lauf der Jahre zu Außenseitern der Ambra-Gesellschaft gemacht haben;
- eine wütende Eifersuchtsspuckerei gegen Duncans ehemalige Studentin, einzige Geliebte und spätere Konkurrentin Mary Sabon;
- ein Zeitzeugenschaftsbericht aus der schrecklichen Zeit des ›Krieges der Häuser‹;
- eine Selbstbefragung dazu, was Wahrheit ist, ein Versuch sich schreibend Klarheit zu verschaffen, über die nächsten Schritte auf dem eigenen Lebensweg;
- und ›last but not least‹ eine Liebeserklärung an ihre Heimatstadt Stadt Ambra.
Janice hat ein wildes Leben als umtriebige Gesellschaftsnudel hinter sich. Anfangs wollte sie Malerin werden, doch mangelte es ihr dafür an Disziplin und (ihrer eigenen Ansicht nach) an kreativem Genie. Ihre Karrieren als Kunstgeschichtlerin und Journalistin versandeten ebenso. Aber als Inhaberin der ›Galerie der Verborgenen Faszinationen‹ hatte sie Erfolg, erfuhr Respkt als Programmatikerin und Vermarkterin der Neuen Kunst (einer Mischung der besten Aspekte von Impressionismus und Symbolismus) und war eine Zeitlang berühmt-berüchtigt dafür, die auschweifensten und ungewöhnlichsten Parties von ganz Ambra zu organisieren.
Nun hat der verschwundene Duncan das von Janice im Schreibrausch in kurzer Zeit verfasste Manuskript in die Finger bekommen und konnte sich nicht zurückhalten, seine Schwester zu kommentieren. Durch seine {in geschwungenen Klammern stehenden} Anmerkungen wird aus dem launisch erzählten Text von Janice ein indirekter Dialog zwischen Geschwistern. Duncans meist knappe Kommentare bilden wegen ihres nüchterneren Tons einen Kontrapukt zur ungedändigt subjektiven Schreibe seiner Schwester. Kein Wunder, denn Duncan ist ein Vollbluthistoriker der die Recherche anhand von Originalquellen und vor Ort bevorzugt und dabei keine Kompromisse kennt. Seit er als kleiner Bub bei einer Touristenführung durch den Untergrund von Ambra einem Grauhut begegnete, ist es um ihn geschehen. Von da an setzt er das Lebensprojekt seines Vaters Jonathan (ebenfalls ein Außenseiter-Historiker) fort, nämlich die Wahrheit über die Vergangenheit von Ambra zu ergründen, und welche Rolle die Pilzwesen dabei inne haben. Mit seinem ersten Buch steigt Duncen zum neuem umstrittenden Jungstar der Geschichtspublizistik auf, obwohl, nein gerade weil der oberste Führbitter der Truffidischen Kirche das Werk mit einem Bann belegt. Doch auch Duncans Karriere verläuft unstet und ist von Misserfolgen gezeichnet.
Zu den Höhepunkten des Buches gehört, wie Duncan sich ab seinem zwanzigsten Lebensjahr aufgrund einer mysteriösen Pilzinfektion allmählich verwandelt; wie sein Leben von seiner Besessenheit mit den Geheimnissen der Vergangenheit und seinen langen Forschungswanderungen im Untergrund von Ambra geprägt wird; wie sich seine anfangs wildromantische Liebe zu Mary Sabon in bittertragische Quälerei wandelt.
Mit dem Beginn der zweiten Hälfte des Buches tritt dann der Krieg der Handelshäuser in den Vordergrund der Geschehnisse, und es ist keine Untertreibung festzustellen, das Vandermeer hier mit großem Geschick und Engagement unter anderem die zeitgenössischen Stimmungen seit dem Beginn der US-Interventionen im Irak und des ›War On Terror‹ verarbeitet. (Siehe hierzu auch Vandermeers Essay »Politics in Fantasy« (in »Emerald City« # 125, Januar 2006), Deutsch von Klaas Ilse als »Politik und Fantasy« in »Pandora« # 1, Frühjahr 2007.)
Für Leser, die mit sogenannten ›literarischen‹ Büchern vertraut sind, dürfte der assoziative Stil von Janice (und die unterbrechenden Kommentare Duncans) keine besondere Herausforderung darstellen. Im Großen und Ganzen bemüht sich Janice zwar um eine chronologische Ordnung der Ereignisse, doch Erinnerungen sind nun mal keine gefühlslose Angelegenheit, schon gar nicht bei einer so leidenschaftlichen Person wie Janice Shriek, und so werden wir Leser Zeuge, wie Janice sich von ihren Emotionen zu Vorgriffen und Rückblenden verleiten läßt. Mehrmals hält Janice inne und muss »von vorne beginnen«, muss um Gewissheit ringen und das führt dazu, dass der Leser (in meinem Fall im Guten) verunsichert wird. Für Genreleser, die auf klar erkennbare, von Äktschen und deutlich benannten Quest-Zielen geprägte Spannungsbögen getrimmt sind, mag das mühselig zu lesen sein. Ich selber kann entsprechenden Klagen zur vermeindlichen Spannungslosigkeit nicht zustimmen. »Shriek« war für mich eine aufregende und zugleich sehr berührende Lektüre. Und wie schon bei »Die Stadt der Heiligen & Verrückten« kann ich nur über die Größe, Buntheit und Originalität des Weltenentwurfes von Jeff Vandermmer staunen.
•••
Jeff Vandermeer: »Shriek« (2006), 489 Seiten, (zwei Teile mit 10 und 7 Kapiteln, 135 Abschnitte); 3 Abbildungen; übersetzt von Hannes Riffel; Klett-Cotta (Broschur) 2008; ISBN: 978-3-608-93778-7.
•••
LINK-SERVICE:
- Hier geht es zur englischsprachigen Buch-Website mit Ausszügen, Links zum »Shriek«-Kurzfilm und zur Sonderausgabe mit CD der australischen Gruppe »The Church«.
- Zu Thomas Klingenmaiers Kurz-Rezi für die »Stuttgarter Zeitung«.
- Hier eine Kostprobe für den Prosawahn, den Vandermeer zu verstalten vermag. Duncan Shriek wird wegen seines jüngsten Manuskriptes ins Büro des Verlagsleiters von Frankwrithe & Lewden, Herrn L. Gaudy gerufen, der ihm dann die »Größte Ablehnung« vor den Latz knallt. Da dieser Monolog auf Englisch frei verfügbar ist, denke ich, dass es nur fair ist, diese Passage hiermit auch Deutschen Lesern, der Länge halber als ersten Kommentar zu dieser Rezension, als Schmankerl anzubieten (Deutsche Ausgabe Seite 61f).
Coverpanorama von Moorcocks »Pyat-Quartett«
Eintrag No. 550 — Wie cool ist das denn? Wie hie und da schon gemeldet, habe ich mir für den Mai eine größere Bestellung bei Book Depository in London gegönnt. Neben dem neuen Miéville »The City & The City« habe ich nun auch (endlich) das komplette »Pyat-Quartett« von Michael Moorcock bekommen. Beim Auspacken und zusammenlegen entdecke ich, dass die vier Umschlagsbilder der Vintage-Taschenbuchausgaben von »Byzantinum Endures« (»Byzanz ist überall«), »The Laughter of Carthage«, »Jerusalem Commands« & »The Vengeance of Rome« ein feines Panorama ergeben. —— Nebenbei: es ist eine Schande, dass die Pyat-Bücher (immer noch) nicht komplett auf Deutsch vorliegen, sondern nur der erste Band (antiquarisch zu haben) mal als Bastei Paperback erschienen ist (durchaus fein übersetzt übrigens).

Ist vielleicht (wie irgendwo in den Programmentscheiderkammern gemutmaßt wird) zu heftig (oder zu wenig erfolgsversprechend) für den armen deutschsprachigen Buchmarkt, wenn Moorcock mit seinem ukrainischen Hallodri eine wilde Reise durch die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen veranstaltet. Der am 1. Januar 1900 geborene Pyat ist ein jüdischer Antisemit, Drogenjunkie, Bisexueller, Ingenieur, Spion, Saboteur, Agitator und und und.
{EDIT-Ergänz:
Zur Erholung heute morgen hier eine kleine Übersicht der Vintage Taschenbuchausgabe des »Pyat-Quartetts«, die vier Bücher werden auch »Between the Wars« (»Zwischen den Kriegen«) genannt. Dazu übersetzte ich flappsig mal die Waschzettel (= Texte des Rückumschlages), damit Neugierige einen Einblick erhaschen können, um was es denn geht.
»Byzantinum Endures« (1981; Deutsch 1984 erschienen als Bastei Paperpack: »Byzanz ist überall«, übersetzt von Michael Kubiak): Europakarte; Intro von Moorcock; 18 Kapitel & 2 kurze Anhänge, 404 Seiten.
Im ersten Band des Pyat-Quartetts stellt Michael Moorcock eine seiner großartigsten Schöpfungen vor: Maxim Arturovich Pyatnitski. Geboren in Kiew zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt er als Jugendlicher die Freuden von Sex und Kokain und erhascht einen Blick auf eine fortschrittliche & gebildete Welt jenseits seines Horizontes, bevor das Wüten der Russischen Revolution anhebt.
»The Laughter of Carthage« (1984; etwa »Das Lachen Karthagos«): Intro, 22 Kapitel, 602 Seiten.
Nachdem er dem Grauen des russischen Bürgerkrieges entkommen ist, entdeckt Maxim Arturovich Pyatnitski, daß die Gefahren in Europa wie Nichts erscheinen verglichen mit dem, was ihn in Amerika erwartet. Fast sofort wird er in weitere Skandale verwickelt, bereist das Land als Sprecher für den Ku Klux Klan. Nur das Wiederauftauchen von Pyats ewiger Liebe, der Femme Fatale Mrs. Cornelius, bietet ihm eine Aussicht auf Rettung.
»Jerusalem Commands« (1992; etwa: »Die Befehle Jerusalems«): Intro, 29 Kapitel, kurzer Anhang, 577 Seiten.
Maxim Arturovich Pyatnitski wurschtelt sich durch von New York nach Hollywod, von Cairo nach Marrakesch, von Film-Kulterfolgen bis zu den äußersten Grenzen sexueller Erniedrigung, und hinterläßt dabei eine Spur mechanischer und menschlicher Zerstörung während er auf ein Stelldichein mit der schrecklichsten Katasthrophe des 20. Jahrhunderts entgegensteuert (auf dem Cover ist die Titanic zu sehen).
»The Vengeance of Rome« (2006; etwa: »Die Rache Roms«): Intro, 60 Kapitel, 618 Seiten.
Maxim Arturovich Pyatnitski begeistert sich für den Faschismus. Er himmelt Mussolini als Helden an, findet Einlass zum inneren Kreis um den Diktator und erfreut sich der innigen Freundschaft mit seiner Frau. Der Duce schickt ihn in geheimer Mission nach München, wo Pyat ein Intimfreund des homosexuellen Sturmtruppenführers Ernst Röhm wird. Seine entscheidene Rolle beim Streben der Nazipartei zur Macht bringt ihn dazu, sich auf perverse Sexspielchen mit ›Alf‹ einzulassen. — Pyats außergwöhnliches Glück läßt ihn als Zeugen nach Hitlers Massakrierung von Röhm und der SA zurück. Schließlich verschlingt das Konzentrationslager Lager Pyat. Dreissig Jahre später, nachdem er den Spanischen Bürgerkrieg überlebt hat, lebt Pyat in der Portabello Road in London, wo er seine Lebensgeschichte dem Schriftsteller Michael Moorcock erzählt.}
Und weil ich grad publikationswunschfreudig bin: Auch zwei andere späte Romane des ›anderen‹ Michael Moorcock sollten mal bei uns erscheinen: »Mother London« und »King of the City« (werden wohl nächsten Monat den Weg in mein Heim finden).
 Eintrag No. 577 — Habe ich diese Woche als Diogenes-Taschenbuch aus dem Ramsch gefischt. 1874 erschien die endgültige Fassung dieses vision- und trugbildgesättigten Drama-Romans, an dem Flaubert etwa 40 Jahre gebosselt hat, und den er selbst als Höhepunkt seines Schaffens betrachtete. — Wegen seines (wie Thomas Mann meint) »polyhistorischen Nihilismus« erregte das Buch einiges Aufsehen und den Groll der bürgerlichen Kritik, denn (wiederum Mann) er ist »nicht nur ein phantastischer Katalog aller menschlichen Dummehiten {…} auch der Irrsinn der religiösen Welt wird lückenlos vorgeführt«.
Eintrag No. 577 — Habe ich diese Woche als Diogenes-Taschenbuch aus dem Ramsch gefischt. 1874 erschien die endgültige Fassung dieses vision- und trugbildgesättigten Drama-Romans, an dem Flaubert etwa 40 Jahre gebosselt hat, und den er selbst als Höhepunkt seines Schaffens betrachtete. — Wegen seines (wie Thomas Mann meint) »polyhistorischen Nihilismus« erregte das Buch einiges Aufsehen und den Groll der bürgerlichen Kritik, denn (wiederum Mann) er ist »nicht nur ein phantastischer Katalog aller menschlichen Dummehiten {…} auch der Irrsinn der religiösen Welt wird lückenlos vorgeführt«.