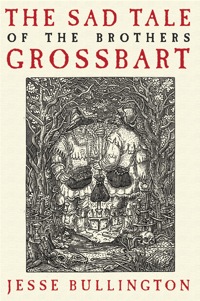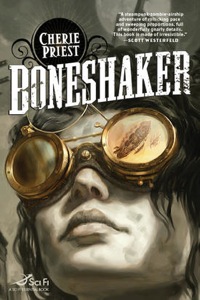Donnerstag, 18. März 2010
China Miéville: »Un Lun Dun« oder: Querfeldein in London diesseits und jenseits des Absurdums
•••
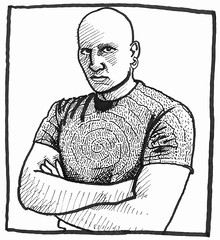 Eintrag No. 610 —Ist man bekennender Fanboy eines Autoren, bekommt man früher oder später Probleme damit, wenn man dessen verschiedene Bücher wertet. Kaum ein Schriftsteller bewegt sich auf einem ständig gleichbleibenden Exzellenzniveau (außer natürlich jenen, die sich im marktgefälligen Mittelmaß behaglich festgeschrieben haben), vor allem dann nicht, wenn besagte Schriftsteller gerne neue Wege einschlagen und zu vermeiden trachten, dass ihre einzelnen Werke sich einander zu ähnlich geraten.
Eintrag No. 610 —Ist man bekennender Fanboy eines Autoren, bekommt man früher oder später Probleme damit, wenn man dessen verschiedene Bücher wertet. Kaum ein Schriftsteller bewegt sich auf einem ständig gleichbleibenden Exzellenzniveau (außer natürlich jenen, die sich im marktgefälligen Mittelmaß behaglich festgeschrieben haben), vor allem dann nicht, wenn besagte Schriftsteller gerne neue Wege einschlagen und zu vermeiden trachten, dass ihre einzelnen Werke sich einander zu ähnlich geraten.
Nein, damit sei keine Apologie angestimmt, die schönreden soll, dass dem englischen ›Weird Fiction‹-Jungmeister China Miéville (*1972) ein Roman missglückt ist, oder dass meine Fan-Erwarungshaltung mehr oder minder eklatant enttäuscht wurde. Aber dennoch muss ich eingestehen, dass mich »Un Lon Don« als Story nicht so wohlig-bratzig überwältigt hat, wie seine drei enormen Bas-Lag-Romane »Perdido Street Station«, »The Scar« und »Iron Council«. Kunststück, denn Bas-Lag wird wohl noch sehr lange einen ganz besonderen Platz nahe meines heiß lodernden Phantastik-Afficionadoherzens innehaben. Die Karten auf den Tisch gelegt kann ich also (leider) sagen: wie schon Miévilles Debüt »König Ratte« oder die ein oder andere Kurzgeschichte der Sammlung »Andere Himmel« durchbricht »Un Lon Don« keine Extraschallmauern der Qualität. Aber immerhin: besagte Ambition, mit jedem Buch etwas wirklich anders anzupacken verhilft auch »Un Lon Don« dazu als lesenswert gelten zu dürfen. Das Neue, das China diesmal wagt, ist, dem äußerst populärem Genre der Abenteuer-Phantastik für Jungleser zuzuarbeiten (oder wie es auf Neudeutsch genannt wird, der ›Jung Adult‹-Sparte), und wenn ich mich umschaue, was ich in den letzten Jahren auf diesem Gebiet mitbekommen habe, dann kann ich »Un Lon Don« als eine durchaus gelungene Bereicherung dieses wildwuchernden Gefildes würdigen.
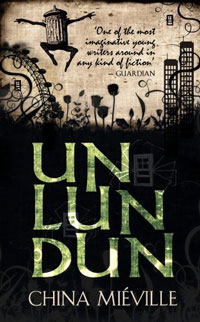 In der Danksagung erwähnt Miéville viele Namen, aber ein paar sind mir besonders aufgefallen und eignen sich, Inhalt und Gebaren des Buches zu skizzieren: Clive Barker, mehr aber noch Michael de Larrabetti und Neil Gaiman haben dem im »Un Lon Don« angestimmten Thema eines phantastischen, seltsamen Anderswelt-London in ihren Werken bereits ausführlich zugearbeitet. Unschwer zu erkennen war für mich die Inspiration, die Neil Gaimans »Neverwhere« auf Chinas neustes Buch hatte, gibt es doch auch dort neben dem ›normalen‹ Allltags-London (London Above) ein befremdliches, undurchschaubar-magisches Neben-London (London Below) in dem sich vor allem aus dem Rahmen des Gewöhnlichen herausgefallene Figuren (und Monster) aus allem möglichen Gefilden der Vergangenheit und Stadtlegende tummeln. — Der Tradition von Michael de Larrabetti (von dem Miéville bereits als Jugendlicher selbst ein großer Fan war, wie ein in »Pandora 2« abgedruckter Text von China belegt) folgt »Un Lon Don« insofern, als dass es auch bei Larrabettis grandiosen Klassiker »Die Borribles« um ungezähmte Jugendliche geht, die gegen die Borniertheit und Gier der Autoritäten und besser gestellten Klassen aufbegehren. — Eine Überraschung war dann, auch den Namen des verehrten Zamonien-Meisters Walter Moers in der Danksagung zu erspähen. Doch eigentlich kein Wunder, denn einige seiner Zamonien-Wälzer wurden in den letzten Jahren ins Englische übersetzt (übrigens: lustig zu lesen), und dass China Miéville begeistert ist von Moers’ rand- und bandloser Frechdachsphantastik passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem, die Art und Weise wie sich bei Moers Erzählung und Illustrationen brillant ergänzen hat es Miéville angetan und wohl unter anderem davon beflügelt hat er sich getraut selber zum Zeichenstift zu greifen und »Un Lon Don« ausführlich zu bebildern. Ein Hoch auf den Bastei Verlag, dass diese Illus auch in der deutschen Ausgabe geboten werden (wohingegen leider das Titelbild von Arndt Drechlser gröblichst enttäuscht).
In der Danksagung erwähnt Miéville viele Namen, aber ein paar sind mir besonders aufgefallen und eignen sich, Inhalt und Gebaren des Buches zu skizzieren: Clive Barker, mehr aber noch Michael de Larrabetti und Neil Gaiman haben dem im »Un Lon Don« angestimmten Thema eines phantastischen, seltsamen Anderswelt-London in ihren Werken bereits ausführlich zugearbeitet. Unschwer zu erkennen war für mich die Inspiration, die Neil Gaimans »Neverwhere« auf Chinas neustes Buch hatte, gibt es doch auch dort neben dem ›normalen‹ Allltags-London (London Above) ein befremdliches, undurchschaubar-magisches Neben-London (London Below) in dem sich vor allem aus dem Rahmen des Gewöhnlichen herausgefallene Figuren (und Monster) aus allem möglichen Gefilden der Vergangenheit und Stadtlegende tummeln. — Der Tradition von Michael de Larrabetti (von dem Miéville bereits als Jugendlicher selbst ein großer Fan war, wie ein in »Pandora 2« abgedruckter Text von China belegt) folgt »Un Lon Don« insofern, als dass es auch bei Larrabettis grandiosen Klassiker »Die Borribles« um ungezähmte Jugendliche geht, die gegen die Borniertheit und Gier der Autoritäten und besser gestellten Klassen aufbegehren. — Eine Überraschung war dann, auch den Namen des verehrten Zamonien-Meisters Walter Moers in der Danksagung zu erspähen. Doch eigentlich kein Wunder, denn einige seiner Zamonien-Wälzer wurden in den letzten Jahren ins Englische übersetzt (übrigens: lustig zu lesen), und dass China Miéville begeistert ist von Moers’ rand- und bandloser Frechdachsphantastik passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem, die Art und Weise wie sich bei Moers Erzählung und Illustrationen brillant ergänzen hat es Miéville angetan und wohl unter anderem davon beflügelt hat er sich getraut selber zum Zeichenstift zu greifen und »Un Lon Don« ausführlich zu bebildern. Ein Hoch auf den Bastei Verlag, dass diese Illus auch in der deutschen Ausgabe geboten werden (wohingegen leider das Titelbild von Arndt Drechlser gröblichst enttäuscht).
Die schöne Zenna und die unauffälligere Debba sind beste Freundinnen und geraten langsam – durch mysteriöse Ereignisse, Unfälle wie auch durch die eigene Neugier – in eine verdrehte Welt jenseits des ›Absurdum‹ (engl. ›The Odd‹), nach Un Lon Dun. Alle Städte unserer Welt haben so ein seltsam-verdrehtes Zwillingsgeschwister, genannt Visavistädte: Lost Angeles, No York, Hongkaum und so weiter. Alles was in den wirklichen Metropolen dem Vergessen anheim gefallen ist, was verloren, aussortiert, abgeschafft, zerstört oder nie umgesetzt wurde, kommt in diesen Visavistädten mehr durcheinander als geordnet zusammen. Ganze Häuser werden in Un Lon Don aus entsprechendem Zeug zusammenimprovisiert, aus ›Graffel‹ (im Englischen: ›Moil‹ für ›mildly obsolete in London‹[01]). So werden zum Beispiel kaputte Hubschrauber zu Windmühlen umfunktioniert, oder ganze Gebäude aus nicht mehr funktionierenden Radios oder Schallplatten errichtet. Ein alter, überwunden geglaubter Schrecken, der Smog, ein zu Bewusstsein und Ambition gekommenes Abgaswolkenmonster, bedroht Un Lon Don und laut der Prophezeiung eines keineswegs unfehlbarem (aber ziemlich eitlem) Orakelbuches ist Zenna die Auserwählte Heldin, die den Smog besiegen wird.
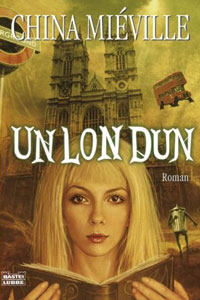 Nun bin ich in der Zwickmühle, nicht offen loben zu können, ohne tolle Kniffe der Handlung zu verraten. So viel sei angedeutet, dass Miéville einigen Fantasy-Konventionen, die sich über die Jahre zur plattesten Routine eingeschliffen haben, gehörig vors Knie tritt und sie erfrischend kritisch ummodelt. Auf den Müll also mit empörendem Auserwähltheits-Schmu, weg mit der sanft-paternalistischen Allwissenheit von Magiern und ihren sprechenden Zauberartefakten, und wie ich finde am brillantesten: hinfort mit der beleidigenden Vorstellung vom Helden-›Sidekick‹ (übersetzt als ›Randfigur‹). Auch habe ich mich köstlich amüsiert, wie im Laufe der Abenteuer das Konzept der Queste genüsslich-brachial demontiert wird. So sehr ich den solcherart vermittelnden Appellen nickend zustimmen kann (Warte nichts auf das Schicksal, sondern gestalte nach nach eigenem Wissen und Gewissen die Welt; Nimm von bestimmungsmächtigen Autoritäten nicht alles unhinterfragt hin; Nicht Sinn suchen, sondern Sinn geben ist wichtig), muss ich doch kritisch einwenden, dass bisweilen dieser Impetus des Aufrütteln-Wollens ein wenig zu sehr … nun ja … mit dem Zeigefinger daherkommt. Aber Miéville ist nicht der einzige, dem solche Ausrutscher passieren, denn derartig ins Auge springende Gutmenschen-Lehren trüben auch bei Philip Pullman oder J. K. Rowling ein wenig den Spaß. Und wenn ich mal vergleiche, wie viele verschwatzte Seiten zum Beispiel der Töpferjunge braucht, um seine Message zu wuppen, dann strahlt »Un Lon Don« bemerkenswert helle auf. Wie auch immer, das beherzigenswerte Anliegen von »Un Lon Don« bringt vielleicht folgende Stelle auf den Punkt, wenn Debba sagt:
Nun bin ich in der Zwickmühle, nicht offen loben zu können, ohne tolle Kniffe der Handlung zu verraten. So viel sei angedeutet, dass Miéville einigen Fantasy-Konventionen, die sich über die Jahre zur plattesten Routine eingeschliffen haben, gehörig vors Knie tritt und sie erfrischend kritisch ummodelt. Auf den Müll also mit empörendem Auserwähltheits-Schmu, weg mit der sanft-paternalistischen Allwissenheit von Magiern und ihren sprechenden Zauberartefakten, und wie ich finde am brillantesten: hinfort mit der beleidigenden Vorstellung vom Helden-›Sidekick‹ (übersetzt als ›Randfigur‹). Auch habe ich mich köstlich amüsiert, wie im Laufe der Abenteuer das Konzept der Queste genüsslich-brachial demontiert wird. So sehr ich den solcherart vermittelnden Appellen nickend zustimmen kann (Warte nichts auf das Schicksal, sondern gestalte nach nach eigenem Wissen und Gewissen die Welt; Nimm von bestimmungsmächtigen Autoritäten nicht alles unhinterfragt hin; Nicht Sinn suchen, sondern Sinn geben ist wichtig), muss ich doch kritisch einwenden, dass bisweilen dieser Impetus des Aufrütteln-Wollens ein wenig zu sehr … nun ja … mit dem Zeigefinger daherkommt. Aber Miéville ist nicht der einzige, dem solche Ausrutscher passieren, denn derartig ins Auge springende Gutmenschen-Lehren trüben auch bei Philip Pullman oder J. K. Rowling ein wenig den Spaß. Und wenn ich mal vergleiche, wie viele verschwatzte Seiten zum Beispiel der Töpferjunge braucht, um seine Message zu wuppen, dann strahlt »Un Lon Don« bemerkenswert helle auf. Wie auch immer, das beherzigenswerte Anliegen von »Un Lon Don« bringt vielleicht folgende Stelle auf den Punkt, wenn Debba sagt:
»Wenn Du wüsstest, dass irgendwo was Schlimmes passieren wird, aber die Menschen dort wüssten es nicht und glaubten sogar, es wäre etwas Gutes, aber du weißt, das ist es nicht und du weißt es nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich weißt du es schon, und du wüsstest nicht, wie du ihnen eine Nachricht schicken kannst und du hörst nie etwas von ihnen, deshalb würdest du nie erfahren, ob es geholfen hat, selbst wenn du ihnen eine Nachricht geschickt hättest …«
[02]Trotz der (für Miéville’sche Verhältnisse) leichten Schwächen, beglückt »Un Lon Dun« mit einem enorm kunterbunten Potpourri schräger Figuren, ungewöhnlicher Orte, pfiffiger Dialoge und berraschender Ideen. Meinen Respekt (und einiges Giggeln) heimst zum Beispiel Chinas Geschick ein, wie er ein banales Milch-Tetrapack mit Leben erfüllt; wie die zu Kreaturen gewordenen Wörter des Königs des Fasellandes (die Schwaflinge) rebellisch herumwuseln; wie ein Berufsabenteurer mit einem Vogelkäfig als Kopf (Rene Magritte läßt grüßen) den Protagonisten dabei hilft, ihren Weg durch ein Haus zu bahnen, in dem sich ein veritabler Dschungel samt Gewässern voller Piranhas befindet; wie aus alten Autos Boote und aus Büchern Klamotten gemacht werden; wie Extremlibristinnen von ihrem gefährlichem Job an den Innenhängen des Bücherturms erzählen; wie Mülltonnen als Elite-Kämpfer umherhüpfen (Englisch: ›Binjas‹). Was den Verlauf angeht, ist »Un Lon Don« bis auf den sich sachte in die Welt jenseits des Absurdum hineinsteigernden Beginn des Buches, eine gehörig atem- und ruhelose Hatz.
Ein Beispiel (von vielen möglichen) für die abwechslungsreiche Monsterschar gefällig? Hier die Beschreibung einer Ausgeburt des Smogs (zudem eine kräftige Stelle um das geschickte Händchen von Übersetzerin Eva Bauche-Eppers zu zeigen):
Die Smoglodyten waren fahl wie Leichenwürmer und farblos. Alle hatten sie entweder riesige schwarze, nur aus Pupille bestehende Augen, damit sie im schmutzig grauen Zwielicht des Smogs sehen konnten, oder gar keine. Alle verfügten über irgendeine Anpassung zum EInatmen der giftigen Melange, wie riesige Nüstern oder mehrere von diesen, um den wenigen vorhandenen Sauerstoff aus den Schwaden zu filtern. Deeba entdeckte ein Wesen, das an eine katzengroße Schnecke gemahnte und sie mit einem Strauß Stielaugen beobachtete. Der Rest des Kopfes war eine organische Gasmaske.
[03]Also, wem (mit Gesellschaftsengagement gewürztes) phantastisches Holterdiepolter taugt, besuche »Un Lon Don« und mache sich dann auf, sich einen eigenen Weg zur anderen Seite des Absurdum zu bahnen, um Perdülin, Krankfurt, Über-die-Wuppertal, Kaputtgardt, Entleibtzig, Verbaselt, Ham-wa-nicht-burg, Fortmund, Kainz und die anderen deutschsprachigen Visavisstädte aufzumischen.
•••••
China Miéville: »Un Lun Dun«; Intro, Epilog, 9 Teile mit 99 Kapiteln auf 591 Seiten; mit ca. 100 S/W-Illustrationen des Autors; 521 Seiten; (UK-Ausgabe) Panmacmillan 2007; ISBN: 978-0-230-01627-9.
Deutsche Ausgabe: »Un Lon Dun«; Aus dem Englischen übertragen von Eva Bauche-Eppers;; Bastei Luebbe Taschenbuch 2008; ISBN: 9-7834-0420-5882.
•••••
ANMERKUNGEN:
[01] In etwa:
›ein bisschen überflüssig in London‹. »Moil« bedeutet im Englischen aber auch, »sich {in einer Mine} abrackern«. Miéville, willkommener Pionier der ökologisch unbedenklichen Recycle-Fantasy! •••
Zurück
[02] Kapitel 36, »Zwischen den Zeilen«, S. 204. •••
Zurück
Sonntag, 14. März 2010
Belgien, Brüssel: Tag 4
Eintrag No. 609 — Am Samstag vor allem die Füße plattgelaufen auf dem launischen Pflaster der Stadt.
Größte Kultur-Unternehmung war eine Wallfahrt zum Horta-Museum.

Über eine halbe Stunde Wartezeit. Aber im Museum dann eine Offenbahrung. Musste mich sehr zügeln, damit meine Gefühle nicht in die Außenwelt überschwappen, so überwältigend schön ist dieses Museum, diese Ballung wohldurchdachten, edlen Jugendstils. Da ist sogar die organische Form von Türklinken sowohl als Ornament schön, als auch angenehm zu greifen für die Hand. — Viktor Horta ist definitif nun Teil meines amœnokratischen Pantheons.
Auf dem Weg durch Saint Gilles haben wir das Fassaden-Ensemble in der Rue Vanderschlick bestaunt, gebaut 1900 bis 1903 von Ernest Blérot. — Und ganz doll: Am rechten Ende befindet sich ein feines, günstiges Eis-Cafe, in dem es den ersten richtig guten Kaffee Brüssels gab.

Weiter durch das Viertel Saint Gilles.
Ich bin wiederum baff, wie schön, wie durcheinander Brüssel ist. Der Phantastik-Fan in mir ruft sofort »Obacht!« als ich dieses Fenster sehe:

Da hat doch tatsächlich jemand sein Fenster mit einer »Frankenstein«-Illustration von Berni Wrightson aufgepimpt. Ich frage mich, ob das in Glas geschliffen und eingefärbt ist? Was für ein Aufwand!
Weiteres Fantasy-Detail. Diesmal sehr coole Drachen, die an der Fassade eines Hauses herumklettern.

Von Saint Gilles aus haben Andrea und ich uns dann ganz gezielt in Richtung Norden verlaufen und sind dabei einmal um den irrwitzigen Justizpalast von Joseph Poelaert herum. Dieser größenwahnsinnige Eklektizismusorgasmus ist wie so manches Gebäude in Brüssel ein möglicher Übergang in die Welt der ›Geheimnisvollen Städte‹ von Schuiten & Peeters. — Ich selbst war zu verstört von diesem Bau und konnte keine Photos machen. Hin und her gerissen war ich zwischen Fluchtreflex (weil mir der Bau tatsächlich Angst einflößte) und Faszination und dem Wunsch, das Trum ausgiebig zu studieren.
Hier eine schöne Ansicht, die Andrea aufgenommen hat:

Brüssel bescherte mir ja so manche unwirkliche Stimmung. Aber jetzt, zwei Tage nach Umrunden des Justizpalastes kommt mir dieses Gebäube tatsächlich wie eine Traumerscheinung vor. Alle anderen außergewöhnlichen Orte wirkten und wirken noch real, die Erinnerungen sind solche des Selbsterlebten, des ›Selbst dort gewesen seins‹. Nur nicht beim Justizpalast. An den erinnere ich mich so, wie man sich an einen Film erinnert, mit der tiefen Überzeugung, hier etwas vorgeführt bekommen zu haben, das nicht echt ist.
Ansonsten? — Natürlich wieder gut Kuchen gegessen mit heißer Schoki. Mich wieder mit Kriek abgeschossen und obendrein noch zwei feine DVD-Schnäppchen gemacht: »Hamlet« in der Brannagh-Fassung (UK-Edition, sogar mit deutscher Tonspur) und »Cosmos« von Carl Sagan.
Sicherlich nicht mein letzter Brüssel-Urlaub! Kaum zurück kann ich’s gar nicht erwarten, wann ich wieder in dieser phantastischen Stadt sein kann.
Freitag, 12. März 2010
Belgien, Brüssel: Tag 3
Eintrag No. 608 — Gestern abend zum ersten Mal derbe belgische Frittches mit Curry- bzw. Remouladetunke gegessen. Fein fein, obwohl … danach etwas unruhig geschlafen.
Heute dann früh raus, bei nicht mehr ganz so kalten (weil windstillen) 5° über Null. Urlaub mit mir ist, bis auf meine Frühaufsteherei, eigentlich ganz unkompliziert. Ich renne gerne durch die Gegend, auch planlos und mit viel versicherndem Geplapper darüber, dass ich mich nicht verlaufen aber Hunger & Durst habe. Museen, Zoos, Galerien, Geschäfte aller Art immer gerne. Architektur auch. Leute gucken aus der Deckung hinter einer Tasse Schoko oder einem weizenartigem Getränk. Alles fein. Abends dann bitte Theater, Kabarett, Kino, oder einfach zuhause bleiben. Kneipe oder ›Disko‹ bitte nicht unbedingt.
Heute kaum aufberochen, gleich hier beim Gemeindehaus Saint-Josse-ten-Noode eingebremst, wegen dieser netten Figur eines typischen ›Bürgers‹. Keine Ahnung, wer der Künstler ist. Hatte nichts zu Schreiben dabei heut.

Dann auf die Rue de Louvain zugehend denk ich mir: »Nanu, Bauarbeiten?«
Aber nein.
Auch hier wieder Kunst im öffentlichen Raum. Diesmal eine rote Holzstruktur mit grauen Einsprengseln. Was für eine irre Arbeit. Da hätte ich gerne zugeschaut, wie die das willenlos zusammenhämmern.

Und diese Struktur geht handbreitnah bis an die Gebäude heran. Würde bei uns kein Brandschutz zulassen! Aber für Kunst, so scheint’s mir, pfeifft der Brüssler auf alles. — {Nachtrag: Es handelt sich hier um die Skulptur »The Sequence« von Arne Quinze.}
Diese Struktur kann man sogar bei Google Map / Google Earth erkennen.

Weiter gings durch einen Park, dessen Grundriss aus 1342 Freimaurersymbolen besteht, und in dem krass kitschige und riesige neo-barock Kindchen-Nackedeis herumstehen und unerträglich Raffael-mäßig süß sind, so dass ich flüchten musste und mich danach über ein eigentlich ziemlich prosaisches Loch im Park freute wie nicht gescheit.
Runter gekommen von der Kitschpanikattacke bin ich dann im Magritte-Museum. Durfte dort keine Photos machen. Aber es lohte sich fett. Ich bin vor allem vom frühen Magritte beeindruckt, und auch seine Zeichnungen sind m.E. schwer unterschätzt. — Seit in der Schirn die pro-punkige Kuh-Periode (Periode Vache) zu sehen war, ist meine ohnehin schon große Sympathie zu Magritte nur noch gewachsen.
Per Kombi-Ticket gings nach dem Magritte weiter ins Museum der Schönen Künste. Im Museumsshop fast bei den Bosch Aktion Figures zugeschlagen. Naja, ein ander’ Mal vielleicht. — Für diesmal reichen mir drei Lesezeichen und zwei Breughel-Poster (»Kampf Karneval vs. Fasten« für mein Arbeitszimmer und »Höllensturz der gefallenen Engel« fürs Schlafzimmer).
Was sehe ich dann im großen Foyer des Museums für Schöne Kunst? Einen maglomanischen Samsa-Traum?

Geht ein paar Schritte zurück …

… und ihr erkennt, dass hier die Welt von Insekten erobert wurde.

Als Erholungskontrast hier eine kecke Keulenmuse. Leider hab ich keine Ahnung mehr, wer die gemalt hat (siehe Schreibzeug vergessen). Sie ist zu sehen auf einem Bild, dass eine Frauengruppe im Malatelier darstellt und dies ist die Schönheit in der Mitte, die Modell steht.

Die revolutionäre Entdeckung des Tages ist für mich das Kirschbier, sogenanntes Kriek, das verschiedene Brauereien anbieten.
Warum muss ich erst selbst mit fast 40 drauf kommen, dass es Kirschbier gibt??!! Warum hat man mir das nicht schon viel viel früher mal gesagt???!!!

Meine größte Sorge ist nun, ob ich im heimatlichen Frankfurt irgendwo dieses Zeug aufstellen kann.
P.S.: Gerade noch mal Tippfehler ausgemerzt. Dabei festgestellt, dass Kirschbier eien furchtbaren Schädel macht, der aber sehr schnell verfliegt. Bin nicht sicher, ob das nun eine gute oder eine schlechte oder eine gute & eine schlechte Nachricht ist.
Belgien, Brüssel: Tag 1 & 2
Eintrag No. 607 — Am Mittwoch angekommen. Gestaunt, wie gut die Belgier ihr Umland vor der Autobahn verstecken. Von der vollbeleuchteten Autobahn-Allee aus könnte man glauben, durch ein Niemandsland zu fahren. Links und rechts nur Bäume oder Lärmschutzwall. Ganz wenige sachte Gewerbe- und Industriegebietsandeutungen und – tada – plötzlich rollt man auf Brüssel herab.
Das Hotel in der Rue Traversie ist schnuckelig. Ich fühle mich wie Jeeves & Wooster oder wie Hercule P. Am ersten Tag sind Andrea und ich einfach nur durch die Innenstadt gelaufen und haben gestaunt.

Am meisten haut mich um, wie Architektur-crazy die Brüsseler sind. Nach 10 Minuten spazieren komme ich mir vor wie in einer Filmkulisse, wie in den Mauern von Samaris. Wie sich hier Neo-Gothik, Gründerzeit-Klassizismus, Art Deco, Betonkunst und Jugendstil gegenseitig um die Hausecken scheuchen ist nicht weniger als eine große Schau.
Habe in der königlichen Passage (St. Hubert) einen Laden mit Westen gesehen. Überlege Schulden zu machen. Anschließend einen großen Pott Muscheln verspeist; im nächsten Cafe noch’n Kirschkuchen druff und supersatt und plattgelaufen um sage und schreibe 21:15 ins Bett gefallen.
Gestern, Donnerstag, dann erster Kulturhubertag.
Ich bin ja kein religiöser Mensch, aber das Comicmuseum weckt in mir schon Gefühle der Ehrfurcht und des Heiligen.

Es ist wirklich erstaunlich, dass man von Frankfurt aus nur um die 300 Kilometer fahren muss, um inmitten von Menschen zu sein, die Comics ganz selbstverständlich als Kunst und Literatur schätzen, die ihre Schulklassen ins dafür gewidmete Museum schicken usw. — Ich habe unter anderem Originale von Andre Franquin, Francois Schuiten, Emile Bravo und Yslaire gesehen und wispere beeindruckt: »Die können zeichnen! So würd ich auch gerne mal zeichnen können.«

Neben der Dauerausstellung über Herge, Jacobs, Peyo und etwa ein Dutzend weitere franko-belgische Klassiker konnten wir zwei tempöräre Ausstellung sehen: einmal über die Mummins (dolle Hitler-Karikatur von Tove Janson), und über die 20 ›besten‹ Comics der letzten 20 Jahre.
Dannach dann ein wahnsinnig heftiges Limobier (Burger Witbeer) im wunderschönen Cafe Horta des Comicmuseums getrunken.
Zu Fuß dann nach Norden, die Chaussee de Haecht hinauf. Blöderweise trotz iTouch-Photo der Google-Map zu doof gewesen, auf Anhieb das Maison Autrique zu finden. Grummelig also nochmal heim, gucken, wie das Haus aussieht und wo es genau steht. Schließlich stehen wir davor und klingeln.

Das Maison Autrique war der erste bedeutende Bau des großen Jugendstil-Architekten Viktor Horta. Unter anderem auf Initiative des großartigen ›Die geheimnisvollen Städte‹-Teams Francois Schuiten und Benoit Peeters wurde dieses bürgerliche Haus restauriert und dezent-theatralisch zu einem Erlebnis hergerichtet.

Besonders entzückend für mich als Fanboy der ›Cités Obscures‹, dass die schräge Mary im ersten Stock herumsteht und sich im Dachkammerl inmitten einer Menge obskuren Gerümpels Eugen Robick findet. Und wenn an einen Blick durch den Türspion des Obergeschosses riskiert, dann kann man in die andere Welt der geheimnisvollen Städte gucken, in den (ich nenns mal so) ›Maschinenraum der Narration‹.

P.S.: Tausend Dank Andrea!, dass Du so nett warst, die Photos zu machen auf denen ich zu sehen bin.
Freitag, 19. Februar 2010
Helene Hegemann
Eintrag No. 606 — Eigentlich geht mir die ganze Sache am Gemüth vorbei. In das Buch »Axolotl Roadkill« habe ich ca. 10 Minuten rein- und quergelesen. Nicht mein Ding. Zu aufdringlich, zu planlos, spürbar zu sehr auf Effekt und Schock kalkuliert, keine erkennbare Erzählung und die Figuren sind mit Namen wie Ophelia und Mifti geschlagen. — Die Streiterei darum, ob Hegemann das Buch nun durch kunstvolles Remixen oder tadelnswertes Zusammenklau(b)en erschaffen hat, geht mir auch Gemüth vorbei. — Wirklich nervig finde ich jedoch, dass die Verlagswelt nun scheints im Jahrestakt ein ›freches junges Weib‹ auf den Markt puscht, und mit dem Rummel zu besagten Provokationsnudeln die Aufmerksamkeits- und Diskurs-Ressourcen verschwendet werden, die man besser anderen, besseren, relevanteren Büchern und Leuten angedeihen lassen sollte.
Trotzdem habe ich mich, wohl von einer dämonischen Einflüsterung getrieben, gestern hinreissen lassen, die schöne Helene zu zeichnen. Bitteschön.
Helene Hegemann: vom Bildschirm nach einem Web-Photo abgezeichnet (nicht aufgepasst und vergessen, wo ich da unterwegs war. Ich glaub »TAZ« oder »Die Zeit«); Faber-Castell Grip 1347-Druckbleistift 0.7 mm mit HB-Mine auf roten Zettel; 90 x 90 mm.

Dienstag, 16. Februar 2010
Auf die Schnelle: »Die verrückte Welt der Paralleluniversen« von Tobias Hürter & Max Rauner
Eintrag No. 605 — In der Schirn kann man derzeit wunderschöne Gemälde des ›Pünktchenmalers‹ Georges Seurat, und seine (in meinen Augen) noch viel wunderbareren Graphiken bestaunen. Richtig gut besucht. (Ich frage mich, ob man den Herrn Schäuble mal aufmerksam machen sollte auf Renter-Rotten, die auf der Suche nach Pläsier unangemeldet(!) z. B. ein Kunsthaus – und dessen Gardarobe – mit ihrer vielköpfigen Anwesenheit bis zur Grenze ihrer Kapazitäten und darüber hinaus belasten.) Der Abbau der vergangenen Moholy-Nagy-Schau und der Aufbau der nächsten Ausstellung rauben mit die Zeit und zehren an meinen Kräften, so dass ich hier in meiner Molochronik mal wieder zu nix komme.
Also wenigstens mal anfangen mit ‘ner neuen Rezi.
 Schon letzten Monat habe ich »Die verrückte Welt der Paralleluniversen« von Tobias Hürter & Max Rauner gelesen. Unfairerweise erwähne ich zuerst, dass die Illustrationen von Vitali Konstantinov im Buch viel besser sind, als das gestalterisch fragwürdige Cover vermuten läßt. Besonders praktisch ist die doppelseitige Verbildlichung der verschiedenen Levels an Multiversums-Theorien. Das Buch selbst bietet einen ganz guten und vor allem kurzweiligen Überblick zu dieser recht neuen und (wie mir etwas zu oft erwähnt wird) umstrittenden Theorie-Schule der Teilchen- & Astrophysik und eben der Kosmologie an.
Schon letzten Monat habe ich »Die verrückte Welt der Paralleluniversen« von Tobias Hürter & Max Rauner gelesen. Unfairerweise erwähne ich zuerst, dass die Illustrationen von Vitali Konstantinov im Buch viel besser sind, als das gestalterisch fragwürdige Cover vermuten läßt. Besonders praktisch ist die doppelseitige Verbildlichung der verschiedenen Levels an Multiversums-Theorien. Das Buch selbst bietet einen ganz guten und vor allem kurzweiligen Überblick zu dieser recht neuen und (wie mir etwas zu oft erwähnt wird) umstrittenden Theorie-Schule der Teilchen- & Astrophysik und eben der Kosmologie an.
Hürter (»P. M.«-Autor) und Rauner (»Die Zeit«-Redakteur) wissen, wie man Kompliziertes aus der Wissenschaft mundgerecht zubereitet. Unter anderem, indem man die menschliche Facette des Ringens um Erkenntnis beachtet, und also den wichtigsten an der Entwicklung von Vielweltentheorien wirkenden Wissenschaftlern & Denkern kleine muntere Biographissimos widmet, oder (vor allem zu Kapitelbeginn) szenische Schilderungen aufführt, so als wäre man dabei.
Höhepunkt waren für mich die Boltzmann-Gehirne. Die haben ihren Auftritt, als es um Ludwig Boltzmann geht, der folgende Ansicht vertrat:
(S. 79) Überall gelten die gleichen Naturgesetzte, nur die Anordnung der Teilchen variiert nach dem Zufallsprinzip. Weil der Raum unendlich groß ist, tritt auch der unglaublichste Zufall irgendwo, irgendwann auf.
Boltzmann fand (phantastisches) Spekulieren durchaus nützlich, um das Ziehen größerer Ideenkreise und damit verbundene Horizonterweiterungen zu üben. Als Beispiel für etwas extrem Unwahrscheinliches regen Hürter und Rauner die Leser an, sich vorzustellen, dass …
{…} die Atome in Ihrem Zimmer {sich} spontan zu einem bewusst denkendem Gehirn formieren {würden}. {…} Es ist enorm unwahrscheinlich, aber nicht wider die Naturgesetzte. »Boltzmann-Gehirne« nennen Kosmologen solche Spontanschöpfungen.
Woraus sich ganz neue Ängste und Hoffnungen ableiten lassen: Ich bin einsam, warum ploppt kein sexy Boltzmann-Gehirn vor mir aus dem Nichts! — Oh weh, ich bin selbst vielleicht nur ein Boltzmann-Gehirn! — Hoffentlich verwandelte ich mich nicht spontan in einen Wal!
Empfehlenswertes Buch für Zwischendurch. Geeignet als Sachbuch-Erstkontakt was Multiversumtheorien angeht. Besonders freut, dass die Autoren keine Scheu haben zu erwähnen, dass (phantastische) Autoren wie Borges, Moorcock, Kehlmann, Nabokov und Pynchon den Wissenschaftlern manchmal beim Formulieren und/oder Druchspielen der Ideen von den vielen Welten voraus waren/sind. (Lediglich die Erwähnung von Julie Zeh tat mir weh.) — Zudem: das Buch ist eine feine Ergänzung (ich verrat aber nicht genau warum) zu dem neuen Neal Stephenson-Roman »Anathem« (der nun, etwa ein Jahr nach der englischsprachigen Orginalausgabe gut übersetzt auf Deutsch erschienen ist).
Tadeln muss ich, dass weder Personen- noch Sach-Index vorliegen. Die am Ende zu findenden 49 biographischen Skizzelchen und das Literaturverzeichnis vermögen diesen Makel nicht wett zu machen.
{Will noch ein paar Worte über das Buch ergänzen. Mehr in den nächsten Tagen. — Ein Monat keine Zeit für einen neuen Blogeintrag. Herrgottsackra! Ich hab zu viel Stress.}
•••••
Samstag, 16. Januar 2010
Deutsche (Bullshit-Bingo)Fantasy: zwei Beispiele
Eintrag No. 604 — Unsortierte Gedanken die in meinem Hirn herumschwirren, seit ich die Uffegung über deutsche Fantasy im »Reality Sucks«-Blog entdeckt und kommentiert habe.
Dem Tenor der dortigen Klage stimme zwar zu (die hiesige Fantasy ist vergleichsweise mau, denn es gibt keine Tradition auf die man bauen könne), auch wenn ich in den Kommentaren relativiere (gibt wohl eine Tradition an fantasyartiger deutscher Phantastik, nur baut man eben zu wenig darauf).
Bereits geäußert habe ich den Verdacht, dass die neuere deutsche Fantasy, vor allem da wo sie erfolgreich ist, erstaunlich und zeihenswert wenig auf literarischem (Traditions-)Bewußtsein fußt, sondern ihre Mühlen vielmehr und nervigerweise überwiegend von Franchise- und Derivat-Strömungen antreiben läßt.
Am vielleicht meisten irritieren mich dabei die Mängel, dass Figuren und Weltenbau vieler Bücher heimischer Produktion geprägt sind von minderem Oberflächenglitzer, Posertum und dadurch die gerade für Phantastik so wichtige Glaubwürdigkeit der Handlung & des Weltenbaus schnell verlustig geht.
Zwei Beispiele aus Romanen von erfolgreichen deutschen Autoren. Um dem Verdacht vorzubeugen, dass ich nur hämisch vorzuführen will, lasse ich Titel und Namen ungenannt.
- Eine mittelalterlich anmutende Fantasywelt. Ein Verurteiler wird bestraft, man sperrt ihn in einen Eisenkäfig in dem er verhungern soll. Das ist ja bekannt aus Spielen wie »Stronghold« oder Filmen wie »Der König der letzten Tage«. Da dient diese Art der Bestrafung dazu, die Bevölkerungsmoral zu zähmen, und durch Einstreichen einer Besichtigungsgebühr Gewinn zu machen. In dem Fantasyroman aber bringt man den Käfig in einen abgelegen Teil des Waldes, womit die ganze Aktion ihre gedachte Wirkung einbüßt. Noch dazu gäbe es in dieser Fantasy-Welt eine billige Möglichkeit für Rohstoffgauner an Metall zu kommen.
- Eine Alternativwelt-Version der 1920er-Jahre mit Fabelwesen und Magie. Im fernen Asien hat ein Tyrann in großer Berghöhe eine Palastfestung, vollgestopft ist mit wertvollem Zeug. Darunter auch ein Gemälde von Caspar David Friedrich. Der Roman erwähnt, dass es kalt ist (es ist Januar) und die Bediensteten des Tyrannen deshalb in dicken Klamotten rumlaufen. Nun sind Ölgemälde sowohl klima- als auch temperaturempfindlich. Ein Ölgemälde würde bei derart ungünstigen Raumklima schnell Schaden nehmen, die Farbe brüchig werden, reißen und platzen. Also: so ehrenwert es ist, Lesern mittels eines Homage-Cameoauftritts die schönen Künste nahezubringen, so wenig durchdacht ist die Platzierung und damit der gutgemeinte Effekt perdü.
Beiden Szenen begegnet der Leser sehr früh zu Beginn der beiden Romane. Muss ich noch extra erwähnen, dass es nach solchen Schnitzern schwer ist, den Rest dieser Bücher ernst zu nehmen?; Und dass man somit verführt wird, sie gegen den Strich zu lesen und sich seine Lesefreude dadurch zu bereiten, indem man Genre-Fantasy-Bullshit-Bingo spielt?
Freitag, 8. Januar 2010
Jesse Bullington: »The Sad Tale of the Brothers Grossbart«, oder: Hexenzauber, Pestdämonen, Nixengesang & zwei Grabräuber auf der Suche nach ganz viel Gold
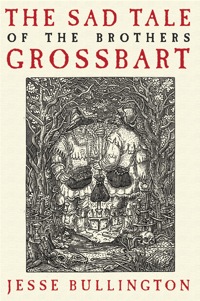 Eintrag No. 603 — Auch wenn ich mittlerweile wegen meines Brotjobs weniger Zeit habe, versuche ich mindestens ein-, zweimal im Monat einige Stunden frei zu machen für Anlese-Sessions im großen örtlichen Buchkaufhaus. Da geraten mir empörend viele Romane in die Finger, die sich offenbar an den so genannten ›Durchschnittsleser‹ wenden. Romane, die ich nach 10 bis 20 Seiten zur Seite lege, weil sie eben, nun ja, zu zahm, zu charakterlos und zu konformistisch sind. Wenn ich mal ich Bock auf solchartig stromlinienförmig-narrative Stangenwahre habe, dann vertraue ich mich lieber Filmen, TV-Stoffen an (und auch Comics; ich sag nur: Schauwerte). Da kann ich es verstehen, wenn Geschichten vor Angepasstheit strotzen, wenn das Produkt nicht zuuuuu schräg und originell sein darf und kann, da hohe Herstellungskosten wieder reingeholt werden sollen und/oder man auf die Befindlichkeiten von Sendern und Werbekunden Rücksicht zu nehmen hat. Bei Literatur hege ich allerdings höhere Ansprüche. Hier erwarte ich, dass sich der eine Macher darum bemüht, eine wirklich eigene, unverwechselbare Stimme und Geschichte zu bieten, und mich nicht langweilt mit Kompromissgedöns.
Eintrag No. 603 — Auch wenn ich mittlerweile wegen meines Brotjobs weniger Zeit habe, versuche ich mindestens ein-, zweimal im Monat einige Stunden frei zu machen für Anlese-Sessions im großen örtlichen Buchkaufhaus. Da geraten mir empörend viele Romane in die Finger, die sich offenbar an den so genannten ›Durchschnittsleser‹ wenden. Romane, die ich nach 10 bis 20 Seiten zur Seite lege, weil sie eben, nun ja, zu zahm, zu charakterlos und zu konformistisch sind. Wenn ich mal ich Bock auf solchartig stromlinienförmig-narrative Stangenwahre habe, dann vertraue ich mich lieber Filmen, TV-Stoffen an (und auch Comics; ich sag nur: Schauwerte). Da kann ich es verstehen, wenn Geschichten vor Angepasstheit strotzen, wenn das Produkt nicht zuuuuu schräg und originell sein darf und kann, da hohe Herstellungskosten wieder reingeholt werden sollen und/oder man auf die Befindlichkeiten von Sendern und Werbekunden Rücksicht zu nehmen hat. Bei Literatur hege ich allerdings höhere Ansprüche. Hier erwarte ich, dass sich der eine Macher darum bemüht, eine wirklich eigene, unverwechselbare Stimme und Geschichte zu bieten, und mich nicht langweilt mit Kompromissgedöns.
In entsprechend lebhaftes Entzücken versetzte mich schon der Beginn des Debüts von Jesse Burlington »The Sad Tale of the Brothers Grossbart«. Bereits der erste Satz (hier in meiner Stegreifübersetzung) faselt nicht um den heißen Brei:
Zu behaupten, die Brüder Grossbart seien grausame und selbstsüchtige Briganten, hieße selbst die garstigsten Wegelagerer zu verunglimpfen, und sie mordlustige Schweine zu nennen wäre gegenüber der dreckigsten Sau noch eine Beleidigung.
Und ich denke nicht, dass ich unbotmäßig viel verrate, wenn ich die 6-einhalb Seiten des ersten Kapitels stichpunktartig zusammenfasse:
Die Zwillinge Manfried und Hegel Grossbart stammen aus einer Grabräuberfamilie. Mama war geistig zurückgeblieben. Papa hat sie mit den Kleinen sitzen gelassen und wurde irgendwo im Norden gelyncht. Ein Onkel hat die beiden erzogen und ihnen das Grabräubern beigebracht. Manfried und Hegel wollen dem Vorbild ihres Großvaters folgen, der es laut Familienlegende bis zu den opulenten Gräbern der Heiden von ›Gyptland‹ geschafft hat. Nun schreibt man das Jahr 1364, und in Bad Endorf wollen sich die Brüder sich für ihre Reise ausstatten, indem sie den Hof des Rübenbauern Heinrich plündern, aus Rache, weil Heinrich einst die rübenstehlenden jungen Grossbarts mit der Schaufel verdroschen hat. Als sie das Haus des Bauern stürmen, greift dessen Frau die Brüder mit einer Axt an. Im Handgemenge bekommt Manfried die Axt zu fassen und erschlägt damit die Frau. Dann haut er beim Stöbern durchs Haus der ebenfalls wehrhaften Tochter die Axt übern Kopf. Heinrich will in die nahe Ortschaft fliehen um Hilfe zu holen, doch die Grossbarts drohen das Haus, in dem sich noch die zwei Babies der Familie befinden, in Brand zu stecken. Heinrich bleibt, doch es nützt nichts: Die Brüder schlitzen dem Sohn vor den Augen seines Vaters die Kehle durch und zünden das Haus an (und die Babies verbrennen mit kläglichen Geschrei), klauen Karre, ein Pferd, Brauchbares aus dem Haus und Rüben und machen sich davon. — Kurz: die ›Helden‹ des Romanes sind richtig finstere Kerle.
Doch nicht nur der Umstand, dass die Hauptfiguren des Romanes brutale, erschreckend rücksichtslose und eigensüchtige Kerle sind ist dazu geeignet sanftere und sich nach kuscheligen Fantasy-Träumen sehnende Leser abzuschrecken. Das 14. Jahrhundert von Jesse Bullington hat so gar nichts mit glatten, sauberen romantischen Mittelalter-Verklärungen gemein (a la »Der erste Ritter« mit Richard Gere), sondern beschwört nach Kräften ein schmutziges, matschiges, grindiges ›finsteres Mittelalter‹ (siehe z. B. »Jabberwocky« von Terry Gilliam). Wenn bei »Brother Grossbarts« gekämpft wird — und es gibt eine Reihe effektvoll und packend inszenierte lange Kampfszenen –, ist das eine blutige und schmerzvolle Sache. Und Bullington ist studierter Historiker und Volkskundler. Gehe ich also mal davon aus, dass er wohlrecherchierte Gründe hat, seinen Lesern ein harsches Mittelalter zusammenzubrauen.
Bullington schöpft aus dem Vollen, was hahnebüchenden Aberglauben und die Grenze zur Häresie übertretenden haarsträubenden (un-)christlichen Glauben betrifft. Das wird ebenfalls früh im Buch anhand einer theologischen Plauderei der Brüder Grossbart im dritten Kapitel offenkundig. Das geht ungefähr so:
Hegel fragt sich, wie es sein kann, dass die Heilige Jungfrau Maria einen gar so verzagten Sohn zur Welt gebracht hat. Immerhin hat sich Jesus am Kreuz nicht ›ehrenvoll‹, sondern wie ein Weichei verhalten. Er hätte einen seiner Peiniger ja wenigstens mal treten können. Manfried erklärt seine theologische Sicht: der HErr wollte Maria schwängern, doch die wollte reine Jungfrau bleiben und ließ den lieben GOtt abblitzen. GOtt schwängerte sie dennoch (und wie Manfried später erklärt, blieb Maria trotzdem weiterhin Jungfrau, denn eine Vergewaltigung zählt ja nicht), und dafür hat sich Maria gerächt, indem sie Jesus zum Waschlappen erzog. Manfried stimmt ein Lob auf die Jungfrau an (Seite 28, Übersetzung von Molo):
»{…} And that’s why She’s holy, brother. Out a all the folk the Lord tested and punished, She’s the only one who got him back, and worse than he got Her. That’s why She intercedes on our behalf, cause She loves thems what stand up to the Lord more than those kneelin to’em.
Und darum ist Sie heilig, Bruder. Von allen Leuten die der Herr geprüft und bestraft hat, ist die Sie die einzige die es im heimgezahlt hat, und zwar schlimmer als er es Ihr besorgt hat. Deshalb setzt Sie sich auch für uns ein, denn Sie liebt diejenigen, die dem Herren die Stirn bieten, mehr als jene, die vor ihm knien.«
Kein Buch also für Leser die ein empfindliches christliches Gemüth haben.
Was gibt’s noch? Ach ja, Monster vom Feinsten! Und die Magie dieses Mittelalters ist stark vom überlieferten Volksglauben geprägt und entsprechend eklig (Eiter, Speichel, Samen und andere übelriechendere Körperflüssigkeiten quellen stellenweise reichlich). — Beeindruckend der Auftritt eines der Hölle entflohenen Pestdämons, der in den Körper eines jungen Reisen geschlüpft ist, wenn er nackt, vor Fieber im kältesten Alpenwinter dampfend auf einem Eber dahergeritten kommt. — Wunderbar die Darstellung der Hexe Nicolette und ihrer wahrhaftig grauenvollen Brut. Nicolette ist ein ganzes Kapitel Vorgeschichte gewidmet, Dank dem diese Widersacherin mehr ist als nur ›böse‹ (na ja, eigentlich kein Kunststück, wenn die Protagonisten selbst von derart zweifelhafter Moral sind, dass sie in den allermeisten Geschichten die besten Übeltäter abgäben). Aber dass Nicolette und ihr Dämonengatte im einsamen Wald die kargen Winter überstanden, indem sie Kinder zeugten die sie dann verspeisten ist schon starker Tobak. Wird aber noch gesteigert, wenn Nicolette zwei frische kleine Monsterbälger mit den über Jahren gesammelten Kinderzähnen versorgt, so dass dieser Brut dann am ganzen Körper gierig schnappende Mäuler wachsen. — Ach ja: eine geheimnisvolle (weil stumme) Nixenschönheit sorgt für (dezente) erotische Wirren, vor allem bei dem sensibleren Manfried.
Neben Wäldern, winterlichen Bergstraßen, menschenverlassenen Klöstern gibt’s zur Abwechslung im weiteren Romanverlauf Abenteuer im frühlingsdurchlüfteten Norditalien und für einige Kapitel sind die Grossbarts im Stadtpalast eines ziemlich rumpeligen Piraten-Kaufmanns in Vendig zu Gast. Schließlich überquert man das Mittelmeer und erreicht Alexandria mit dem christlichen Kreuzzug-Überfallheers unter der Leitung von König Peter I. von Zypern.
Einige Leser haben bemängelt, dass die Episodenfolge des Roman einen etwas ruckelnden Verlauf bildet. Ich fand das keineswegs störend, sondern ließ mich berauschen von der bisweilen munter-knartzigen Sprache und genoss es, mich in ein magisches Mittelalter entführen zu lassen, in dem reichlich ungewöhnliche, sperrigere Figuren auftreten und das mich nicht nervt mit den üblichen langweiligen glatten Typen (der naive Gutmein-Held, die Unschulds-Trulle, der hämische Fiesling, der weise Kuttenopa ect pp ff).
Anfang Dezember 2009 hat Jesse Bullington froh verkündet, dass Bastei Luebbe die Rechte für eine deutsche Ausgabe des Romanes erworben hat. Ich hoffe inbrünstig, dass man für die hiesige Ausgabe der Umschlaggestaltung der englischsprachigen Originalausgaben treu bleibt und das Vexierbild von Istvan Orosz verwendet. Wenn nicht, möge die Heilige Jungfrau mit ihren gerechten Zorn Luebbe strafen!
Ich bin schon gespannt auf Bullingtons zweiten Roman »The Enterprise of Death«, der im November 2010 auf Englisch erscheinen soll und im selben Weltenbau wie die Grossbarts angesiedelt ist, allerdings diesmal zur Barock-Zeit der Spanischen Inquisition, und es soll weniger darum gehen, Gräber zu öffnen und Leut’ in selbige hineinzuprügeln, sondern darum, die Toten aus Gräbern wieder auferstehen zu lassen.
•••
LINK-SERVICE:
Ende November, Anfang Dezember 2009 hat Jesse eine Werktagswoche als Gastautor für das »Amazon«-Bücherblog »Omnivoracious« beigetragen:
•••••
Montag, 28. Dezember 2009
Grenzübergang 2009/2010
Eintrag No. 602 — Kann nicht mehr viel passieren, was folgende Auflistung ergänzen könnte (und wenn, dann pack ich es in den nächsten Grenzübergang). — Die fett markierten Links führen auf eigene Beiträge, der Rest ins WWW.
Gut-Buch (Fiktion):
Zuerst meine beiden obersten lebenden Phantastik-Meister …
… die es wunderbar verstanden mit ihren Weird Noir-Romanen ungewöhnliche Phantastik-Krimis zu bieten;
- (Von Vandermeer hat mich zudem auch »Shriek« entzückt;)
- Thomas Pynchon: »Inherent Vice«, einfach nur saukomisch und die wohl beste Art, ohne Dope stoned zu werden;
- Dan Simmons: »Drood«, berührend, verstörend und ein verdammt schlauer-unheimlicher Roman über Freundschaft, Konkurrenz und die (finstere) Macht des Geschichtenerzählens;
- Douglas Coupland: »Generation A«, medizinische und fabulatorische Gesellschafts-Science Fiction mit Bienenstich;
- Cervantes: »Don Quijote von La Mancha«, Neuübersetzung bei Hanser ist ein Genuss, auch wegen der vielen feinen Anmerkungen;
- »Eine andere Welt« von Anonymus mit Illustration von Grandville, worüber ich hoffentlich fürs »Magira 2010« mehr berichten werde.
- Und als letztes kurz vor Jahreswechsel habe ich »The Sad Tale of the Brothers Grossbart« von Jesse Bullington verschlungen. Ein wirklich unglaublicher Roman. Dieser finstere, brutale, lustige, gewitzte und berührende Fantasystoff der im Europa und Ägypten des 14. Jahrhunderts spielt erfüllt lang von mir gehegte Geschmackswünsche
Gut-Buch (Sach):
Gut-Buch (Comic):
- Fane & Jim: »Sonnenfinsternis«, Beziehungsproblemdrama. Klingt schrecklich? Ist genau das Gegenteil;
- Naoki Urasawa: »20th Century Boys« (englische Ausgabe), ich bin erst beim englischsprachigen Band 5 (von 22) und kann nicht sagen, dass ich groß durchblicke. Aber eine spannende Lesesucht hat sich bereits eingestellt und Urasawa ist ein gewiefter Erzähler mit allen Tricks;
- Max: »Bardin, der Superrealist«, ein bunter Kessel kurzer Strips von überwältigender Abseitigkeit. Wunderbares Beispiel, was für irre Hirntrips die moderne Kunst ermöglicht, wenn man nur mit dem richtigen Humor hantiert;
- David B.: »Nocturnal Conspiracies«, unheimlich, rätselhaft, wunderschön diese Traumprotokolle;
- Joan Sfar (& Hervé Tanquerelle): »Professor Bell«, feine humorig-dreiste OkkultAbenteuer mit einem Sherlock Holmes-artigen Menschenhasser plus Gespenstern, wehrhaften Frauen, Riesenaffen, Teufeln und was nicht noch alles;
- Kazuo Koike & Gôseki Kojima: »Lone Wolf & Cub«, hab alle 28 Bände durch und freue mich schon auf den Urlaub, in dem ich diese episch-tragische Rachestory am Stück noch mal lese;
- Brian Azzarello & Eduardo Risso: »100 Bullets«, 100 Hefte, mindestens doppelt so viele Gangster in einem x-bödigen Finten- und Intrigenspiel, dass einem die Luft wegbleibt;
- Manu Larcenet: »Der alltägliche Kampf«, passiert auch nix großes, außer eben den kleinen Dingen des Lebens. Nimmt das Herz sachte in die Hände und hebt es zur Sonne.
Gut-Mukke (neu):
- Amanda Palmer: »Who killed Amanda Palmer«; ‘ne manisch-melancholische Aggrofrau die in die Tasten hämmert und Texte bietet, die unter die Haut gehen;
- Suzanne Vega: »Beauty & Crime«, endlich wieder eine rundum perfekte Platte der New Yorker Baladeuse;
- The Beatles (Digital Remasterd): »Rubber Soul«, »Revolver«, »Sgt.Peppers Lonley Hearts Club Band«, »Magical Mystery Tour«, »(White Album)«, »Let It Be«, hat mich voll erwischt. War über einen Monat ausschließlich am Beatles-Hören mit meinem iPod.
Gut-Mukke (alt):
Gut-Film:
- »Inglourious Basterds«, Tarantino läßt in seiner originellen Kollision von WKII, Situationskomödie und Italo-Western wieder eine Riege Darsteller glänzen;
- »Star Trek«, so macht auch mir die Enterprise und ihre Crew vollends Freude;
- »Zeiten des Aufruhrs«, ein ergreifendes Drama der stillen Töne und kleinen Unglücke;
- »Gran Torino«; Clint überzeugt als grummeliger Witwer der widerwillig seine Fremdenfeindlichkeit überwindet;
- »Avatar«, trotz der nicht gerade originellen Handlung ein Fest des SF-Fantasy-Weltenbaus das mich überzeugt hat. Ich freue mich schon auf weitere Geschichten.
Beste Momente:
- Alleine, womöglich im Dunkeln, durch die Darwin-Ausstellung gehen;
- Finanziell so gut aufgestellt zu sein, dass ich meiner Partnerin ein neues iBook schenken konnte;
- Eine Partnerin zu haben, die von ihren Reisen in den Süden feine Paisleymuster-Kravatten aus Italien versorgt
- In Dreieich dabei gewesen zu sein, als Ju Honisch für »Das Obsidianherz« den Deutschen Phantastik Preis für den besten Roman-Debut gewonnen hat;
- Meine Sinne entdecken die »Dalwhinnie Distillers Edition«.
Schlimmster Moment:
- Nach Jahren des ›geht so‹ plötzlich nicht mehr mit größeren Höhen zurechtzukommen.
Vorsätze (blöderweise gleiche wie letztes Jahr):
- Schande über mich, aber ich kann nur sagen: Siehe letztes Jahr.
Samstag, 19. Dezember 2009
Cherie Priest: »Boneshaker«, oder: Alternativwelt-Seattle 1880 mit Luftschiffen & Zombies
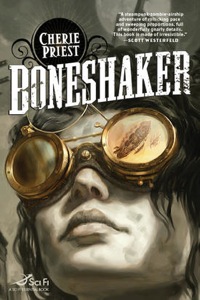 Eintrag No. 601 — Okey, ich geb’s ja zu, dass ich derzeit eine Steampunk-Phase durchmache. Aber ich habe schon länger eine Schwäche für in Alternativ- oder Zweitschöpfungs-Welten angesiedelte Phantastik, welche entsprechend als Inspiration auf das 19. Jahrhundert (plus/minus einiger Generationen früher oder später) zurückgreift. Mir sind Wells und Verne als Väter von Fantasy-Bastards allemal lieber als die üblichen ollen verdächtigen Mittelalter- und Archaik-Schönträumer a la Tolkien. (Eigentlich müsste man mal anfangen ›Tolkien‹ statt Tolkien zu schreiben, besser noch ›McTolkien‹, denn sein Name wird in Phantastik-Argumentationen eh nur als Platzhalter verwendet … auch von mir freilich).
Eintrag No. 601 — Okey, ich geb’s ja zu, dass ich derzeit eine Steampunk-Phase durchmache. Aber ich habe schon länger eine Schwäche für in Alternativ- oder Zweitschöpfungs-Welten angesiedelte Phantastik, welche entsprechend als Inspiration auf das 19. Jahrhundert (plus/minus einiger Generationen früher oder später) zurückgreift. Mir sind Wells und Verne als Väter von Fantasy-Bastards allemal lieber als die üblichen ollen verdächtigen Mittelalter- und Archaik-Schönträumer a la Tolkien. (Eigentlich müsste man mal anfangen ›Tolkien‹ statt Tolkien zu schreiben, besser noch ›McTolkien‹, denn sein Name wird in Phantastik-Argumentationen eh nur als Platzhalter verwendet … auch von mir freilich).
Auf »Boneshaker« von Cherie Priest wurde ich durch Empfehlungen des deutschen Steampunk-Blogs »Clockworker«, Hinweisen von Scott Westerfield und Jeff Vandermeer aufmerksam. Das Buch ist noch nicht auf Deutsch erschienen, die Übersetzungen liefere ich aus dem Stegreif. (Schon mal zum Seufzen, dass die beste Entsprechung für das knappe englische ›Boneshaker‹ das umständlich klingendere aber dennoch schöne ›Mark- und Beinerschütterer‹ ist.)
Zum Glück für den Roman hat mich beim Anlesen im Laden bereits der eröffnende 6-seitige Auszug des in Arbeit befindlichen fiktiven Sachbuchs »Unwahrscheinliche Ereignisse aus der Geschichte des Westens« eines gewissen Hale Quarter aus dem Jahre 1880 überzeugt. In »Kapitel 7: Der seltsame Zustand des ummauerten Seattles« wird prall das Setting vorgestellt: Goldrausch an der Westküste: Entdeckung einer großen Goldader unter Permafrosteis. Seattle ist noch nicht Teil der Vereinigte Staaten. Eine russische Interessensgruppe lobt einen fetten Rubelbetrag für eine Machine aus, die das Gold schürfen kann. Ein Erfinder names Leviticus Blue baut ein Riesenbohrerfahrzeug, verursacht damit 1863 bei einem Testlauf ein ansehnliches Desaster, mit dem das Geschäftsviertel von Seattle lahmgelegt wird. Aus den in den Untergrund gebohrten Tunneln wabert ein schweres Pestgas (engl. ›Blight‹) an die Oberfläche, das massenweise die Leute krepierten läßt und sie zu willenlosen frischfleischgierigen Untoten, vulgo, Zombies macht. Die Überlebenden bauen geschwind eine 61 Meter hohe Mauer um das verseuchte Gebiet und fünfzehn Jahre später setzt die eigentliche Handlung ein.
Fast hätte ich dann bei den ersten vier Kapiteln das Handtuch geschmissen, denn Priest meidet raffende Dramaturgie und läßt sich nicht hudeln, um die Heldin Briar Wilkes und ihren Sohn Zeke vorzustellen. Da wird Arbeitsklamottenausziehen, Essenmachen, jeder Wechsel von einem Zimmer ins andere, fast jede Wendung eines Dialoges mit entsprechender Mimikreaktion und Mimikdeutung beschrieben. — Briar schuftet in einer Wasserfilterungsfabrik im Siedlungsgürtel um das verseuchte Seattle. Als Witwe des verschollenen wahnsinnigen Wissenschaftlers Blue hat sie mit dem Groll der Leute zu ringen. Allerdings war ihr Vater ein legendärer Sherriff, der bei der Blight-Katastrophe sein Leben ließ um Gefängnisinsassen vor dem Tod zu retten. Immerhin sind also einige Leut der zwielichtigen Gesellschaftsschicht ihr wohlgesonnen. Ihr fünfzehnjähriger Sohn Zekes macht die Pubertätsphase durch, nicht auf Authoritäten und Anweisungen hören zu wollen, und bricht gegen den Rat seiner Mutter auf, mehr über seinen Vater zu erfahren, mit dem Ziel in dem ummauerten Seattle Beweise zu finden, um Leveticus Blues schlechten Ruf zu tilgen.
Der Roman steigt dann richtig in die Eisen, kaum dass die Handlung sich ins von Zombiehorden (die hier ›rotters‹, also ›Verwesende‹ genannt werden) geplagten (Ex-)Seattle verlagert. Im Prinzip eine Variation des »Die Klapperschlange«-Motivs. Gesperrtes, mordsgefährliches Gebiet mit lauter hartgesottenen Durchgeknallten; wichtiges Quest-Ziel ist dort zu finden und dann heißt es wieder heil rauszukommen. — Da erscheint mir auch die Ausführlichkeit von Priests Prosa sinnvoll, wenn das Fluchttunnel- und Rettungsleitern-, AntiZombiebarrieren-, Luftschleusen- und Belüftungssystem der Überlebenszonen geschildert wird (übrigens sehr reizvoll wie sehr diese der tödlichen Blight-Gasumwelt abgetrotzten ÜberLebebsräume einer Raumstation gleichen. Buchstäblich die gleiche spannende Athmosphäre wie in Weltraum-Sagas, wo oftmals die Gefahr der lebensunmöglichen Weite des Alls beschworen wird.)
Zeke findet mit einem Tag Vorsprung durch die ehemaligen Kanalisiationstunnel unter der Mauer hindurch seinen Weg in die Stadt. Briar folgt ihrem Sohn, doch muss sie wegen eines die Tunnel zerstörenden Erdbebens mit Hilfe von Luftschiffschmugglern einen Weg über die Mauer finden. — Kein Zweifel: Neben den Zombies ist die waschechte Steampunk-Athmo der Luftschiffe eine der Hauptattraktionen dieses Phantastikweltenbaus. Und so darf der geneigte Genreleser sich auf kernige Männer, exotische Crewmitglieder mit entsprechenden Piratengebahren, Luftkämpfe und Absturztumult freuen. Zu den Besonderheiten des Blights gehört, dass sich aus diesem Unglücksgas eine opiumartige Droge herstellen läßt (die zum Beispiel bei den Soldaten des länger als in unserer Echtwelt andauernden amerikanischen Bürgerkrieges immer größerer Beliebtheit erfreut). Die Luftpiraten machen ein gutes Geschäft als Zwischenhändler dieses Stoffes, und lassen sich deshalb auf den eigentlichen Herrscher des ehemaligen Seattles ein, den geheimisvollen und gefährlichen Dr. Minnericht.
Cherie Priest weiß wirklich überwiegend mit einer gut arrangierten Reihe hervorragend inszenierter Kapitel zu unterhalten. Leider nervte sie mich aber manchmal mit einer Dramaturgie, in der durch den Wechsel der beiden Hauptfiguren, Briar und Zekes, Informationen doppelt und dreifach ausgebreitet werden, und Zufallsbegegenungen und -Ereignisse mir etwas zu oft aus der Klemme halfen oder diese erst bereiteten. Aber als schnell wegzublätternde Zwischendurch- und Unterwegslektüre fand ich »Boneshaker« unterm Strich durchaus gut.
»Boneshaker« ist der erste Roman aus einer Reihe für sich stehender Erzählungen aus der Alternivwelt des »Uhrwerk-Jahrhundert«. Zwar habe ich das Gefühl, dass ich ich, ähnlich wie bei Gordon Dahlquist, schon durch ein Buch gesättigt bin, aber wenn mich die kommenden Romane von Preist beim Anlesen ködern können (Dahlquists Fortsetzung konnte das nicht), greif ich gerne wieder zu.
P. S.: Vor kurzen in die Sparte ›Kunst‹ meiner Linkliste aufgenommen wurde die Website von »Boneshaker«-Coverkünstler Jon Foster.
••••
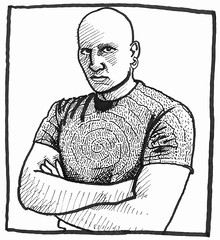 Eintrag No. 610 —Ist man bekennender Fanboy eines Autoren, bekommt man früher oder später Probleme damit, wenn man dessen verschiedene Bücher wertet. Kaum ein Schriftsteller bewegt sich auf einem ständig gleichbleibenden Exzellenzniveau (außer natürlich jenen, die sich im marktgefälligen Mittelmaß behaglich festgeschrieben haben), vor allem dann nicht, wenn besagte Schriftsteller gerne neue Wege einschlagen und zu vermeiden trachten, dass ihre einzelnen Werke sich einander zu ähnlich geraten.
Eintrag No. 610 —Ist man bekennender Fanboy eines Autoren, bekommt man früher oder später Probleme damit, wenn man dessen verschiedene Bücher wertet. Kaum ein Schriftsteller bewegt sich auf einem ständig gleichbleibenden Exzellenzniveau (außer natürlich jenen, die sich im marktgefälligen Mittelmaß behaglich festgeschrieben haben), vor allem dann nicht, wenn besagte Schriftsteller gerne neue Wege einschlagen und zu vermeiden trachten, dass ihre einzelnen Werke sich einander zu ähnlich geraten.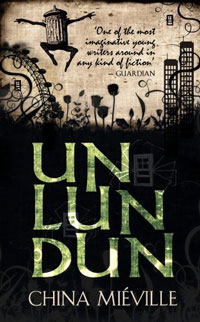 In der Danksagung erwähnt Miéville viele Namen, aber ein paar sind mir besonders aufgefallen und eignen sich, Inhalt und Gebaren des Buches zu skizzieren: Clive Barker, mehr aber noch Michael de Larrabetti und Neil Gaiman haben dem im »Un Lon Don« angestimmten Thema eines phantastischen, seltsamen Anderswelt-London in ihren Werken bereits ausführlich zugearbeitet. Unschwer zu erkennen war für mich die Inspiration, die Neil Gaimans »Neverwhere« auf Chinas neustes Buch hatte, gibt es doch auch dort neben dem ›normalen‹ Allltags-London (London Above) ein befremdliches, undurchschaubar-magisches Neben-London (London Below) in dem sich vor allem aus dem Rahmen des Gewöhnlichen herausgefallene Figuren (und Monster) aus allem möglichen Gefilden der Vergangenheit und Stadtlegende tummeln. — Der Tradition von Michael de Larrabetti (von dem Miéville bereits als Jugendlicher selbst ein großer Fan war, wie ein in »Pandora 2« abgedruckter Text von China belegt) folgt »Un Lon Don« insofern, als dass es auch bei Larrabettis grandiosen Klassiker »Die Borribles« um ungezähmte Jugendliche geht, die gegen die Borniertheit und Gier der Autoritäten und besser gestellten Klassen aufbegehren. — Eine Überraschung war dann, auch den Namen des verehrten Zamonien-Meisters Walter Moers in der Danksagung zu erspähen. Doch eigentlich kein Wunder, denn einige seiner Zamonien-Wälzer wurden in den letzten Jahren ins Englische übersetzt (übrigens: lustig zu lesen), und dass China Miéville begeistert ist von Moers’ rand- und bandloser Frechdachsphantastik passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem, die Art und Weise wie sich bei Moers Erzählung und Illustrationen brillant ergänzen hat es Miéville angetan und wohl unter anderem davon beflügelt hat er sich getraut selber zum Zeichenstift zu greifen und »Un Lon Don« ausführlich zu bebildern. Ein Hoch auf den Bastei Verlag, dass diese Illus auch in der deutschen Ausgabe geboten werden (wohingegen leider das Titelbild von Arndt Drechlser gröblichst enttäuscht).
In der Danksagung erwähnt Miéville viele Namen, aber ein paar sind mir besonders aufgefallen und eignen sich, Inhalt und Gebaren des Buches zu skizzieren: Clive Barker, mehr aber noch Michael de Larrabetti und Neil Gaiman haben dem im »Un Lon Don« angestimmten Thema eines phantastischen, seltsamen Anderswelt-London in ihren Werken bereits ausführlich zugearbeitet. Unschwer zu erkennen war für mich die Inspiration, die Neil Gaimans »Neverwhere« auf Chinas neustes Buch hatte, gibt es doch auch dort neben dem ›normalen‹ Allltags-London (London Above) ein befremdliches, undurchschaubar-magisches Neben-London (London Below) in dem sich vor allem aus dem Rahmen des Gewöhnlichen herausgefallene Figuren (und Monster) aus allem möglichen Gefilden der Vergangenheit und Stadtlegende tummeln. — Der Tradition von Michael de Larrabetti (von dem Miéville bereits als Jugendlicher selbst ein großer Fan war, wie ein in »Pandora 2« abgedruckter Text von China belegt) folgt »Un Lon Don« insofern, als dass es auch bei Larrabettis grandiosen Klassiker »Die Borribles« um ungezähmte Jugendliche geht, die gegen die Borniertheit und Gier der Autoritäten und besser gestellten Klassen aufbegehren. — Eine Überraschung war dann, auch den Namen des verehrten Zamonien-Meisters Walter Moers in der Danksagung zu erspähen. Doch eigentlich kein Wunder, denn einige seiner Zamonien-Wälzer wurden in den letzten Jahren ins Englische übersetzt (übrigens: lustig zu lesen), und dass China Miéville begeistert ist von Moers’ rand- und bandloser Frechdachsphantastik passt wie die Faust aufs Auge. Vor allem, die Art und Weise wie sich bei Moers Erzählung und Illustrationen brillant ergänzen hat es Miéville angetan und wohl unter anderem davon beflügelt hat er sich getraut selber zum Zeichenstift zu greifen und »Un Lon Don« ausführlich zu bebildern. Ein Hoch auf den Bastei Verlag, dass diese Illus auch in der deutschen Ausgabe geboten werden (wohingegen leider das Titelbild von Arndt Drechlser gröblichst enttäuscht).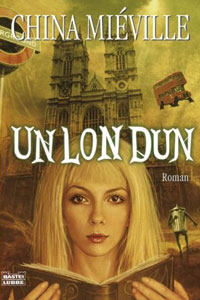 Nun bin ich in der Zwickmühle, nicht offen loben zu können, ohne tolle Kniffe der Handlung zu verraten. So viel sei angedeutet, dass Miéville einigen Fantasy-Konventionen, die sich über die Jahre zur plattesten Routine eingeschliffen haben, gehörig vors Knie tritt und sie erfrischend kritisch ummodelt. Auf den Müll also mit empörendem Auserwähltheits-Schmu, weg mit der sanft-paternalistischen Allwissenheit von Magiern und ihren sprechenden Zauberartefakten, und wie ich finde am brillantesten: hinfort mit der beleidigenden Vorstellung vom Helden-›Sidekick‹ (übersetzt als ›Randfigur‹). Auch habe ich mich köstlich amüsiert, wie im Laufe der Abenteuer das Konzept der Queste genüsslich-brachial demontiert wird. So sehr ich den solcherart vermittelnden Appellen nickend zustimmen kann (Warte nichts auf das Schicksal, sondern gestalte nach nach eigenem Wissen und Gewissen die Welt; Nimm von bestimmungsmächtigen Autoritäten nicht alles unhinterfragt hin; Nicht Sinn suchen, sondern Sinn geben ist wichtig), muss ich doch kritisch einwenden, dass bisweilen dieser Impetus des Aufrütteln-Wollens ein wenig zu sehr … nun ja … mit dem Zeigefinger daherkommt. Aber Miéville ist nicht der einzige, dem solche Ausrutscher passieren, denn derartig ins Auge springende Gutmenschen-Lehren trüben auch bei Philip Pullman oder J. K. Rowling ein wenig den Spaß. Und wenn ich mal vergleiche, wie viele verschwatzte Seiten zum Beispiel der Töpferjunge braucht, um seine Message zu wuppen, dann strahlt »Un Lon Don« bemerkenswert helle auf. Wie auch immer, das beherzigenswerte Anliegen von »Un Lon Don« bringt vielleicht folgende Stelle auf den Punkt, wenn Debba sagt:
Nun bin ich in der Zwickmühle, nicht offen loben zu können, ohne tolle Kniffe der Handlung zu verraten. So viel sei angedeutet, dass Miéville einigen Fantasy-Konventionen, die sich über die Jahre zur plattesten Routine eingeschliffen haben, gehörig vors Knie tritt und sie erfrischend kritisch ummodelt. Auf den Müll also mit empörendem Auserwähltheits-Schmu, weg mit der sanft-paternalistischen Allwissenheit von Magiern und ihren sprechenden Zauberartefakten, und wie ich finde am brillantesten: hinfort mit der beleidigenden Vorstellung vom Helden-›Sidekick‹ (übersetzt als ›Randfigur‹). Auch habe ich mich köstlich amüsiert, wie im Laufe der Abenteuer das Konzept der Queste genüsslich-brachial demontiert wird. So sehr ich den solcherart vermittelnden Appellen nickend zustimmen kann (Warte nichts auf das Schicksal, sondern gestalte nach nach eigenem Wissen und Gewissen die Welt; Nimm von bestimmungsmächtigen Autoritäten nicht alles unhinterfragt hin; Nicht Sinn suchen, sondern Sinn geben ist wichtig), muss ich doch kritisch einwenden, dass bisweilen dieser Impetus des Aufrütteln-Wollens ein wenig zu sehr … nun ja … mit dem Zeigefinger daherkommt. Aber Miéville ist nicht der einzige, dem solche Ausrutscher passieren, denn derartig ins Auge springende Gutmenschen-Lehren trüben auch bei Philip Pullman oder J. K. Rowling ein wenig den Spaß. Und wenn ich mal vergleiche, wie viele verschwatzte Seiten zum Beispiel der Töpferjunge braucht, um seine Message zu wuppen, dann strahlt »Un Lon Don« bemerkenswert helle auf. Wie auch immer, das beherzigenswerte Anliegen von »Un Lon Don« bringt vielleicht folgende Stelle auf den Punkt, wenn Debba sagt: